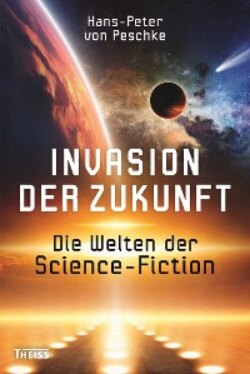Читать книгу Invasion der Zukunft - Hans-Peter von Peschke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Technoträume 1. Alles ist machbar: Die Technik der Zukunft
ОглавлениеWenn es um Fortschritt geht, beginnen fast alle Science-Fiction-Geschichten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So auch diese, in der ein durchschnittlich intelligenter US-Marshall mit seiner pubertären Tochter eine Autopanne im Nordwesten der USA hat. Er landet in einer Kleinstadt mit putzigen Holzhäusern, die aber anders ist als gewöhnliche Kleinstädte. Solarautos fahren herum, Roboter reinigen die Straßen und pflegen die Bäume und der Getränkeautomat gibt dem Kunden Empfehlungen. Kurzum, in der Stadt Eureka scheint der amerikanische Traum des „anything goes“ verwirklicht.
Weil gerade der Posten des Sheriffs durch einen Unfall frei geworden ist, übernimmt der Cop aus Los Angeles diesen Job. Eine seiner ersten merkwürdigen Erfahrungen macht Carter, als er in sein neues Haus einzieht. Alle Funktionen werden von S. A. R. A. H. übernommen, einer künstlichen Intelligenz, die als „Selbstständig Arbeitendes Rundum Automatisiertes Haus“ nicht nur Geschirrspülen und Putzen steuert, sondern sich auch als Beraterin in Lebens- und Liebesfragen von Vater und Tochter einmischt.
Erst später wird der wackere Sheriff herausfinden, wohin er da geraten ist: Die von der Öffentlichkeit abgeschirmte Stadt Eureka wurde in Oregon auf Anregung Albert Einsteins im Zweiten Weltkrieg gegründet, als Think Tank für streng geheime Experimente. Seitdem leben hier Nobelpreisträger und Wunderkinder, verschrobene Genies und fanatische Forscher. Die meisten von ihnen arbeiten in einem riesigen unterirdischen Laborkomplex der Firma „Global Dynamics“, hinter deren klangvollem Namen sich das US-amerikanische Verteidigungsministerium verbirgt.
Und dann sind da gewisse Vorfälle. Energiewirbel lassen riesige Löcher im Boden entstehen, in denen sogar Menschen verschwinden. Ursache ist ein Experiment im Keller eines von seiner Forschung besessenen Wissenschaftlers. Da werden plötzlich verschiedene Metalle zu Gold, zerfallen aber bald zu Rost. Später tauchen Duplikate von Einwohnern auf, mitten im Sommer wird ein Wissenschaftler zur Eisstatue, mittels eines Supermagneten werden Tonnen von Weltraumschrott Richtung Eureka angezogen. Es gibt Expeditionen in den Weltraum, Begegnungen mit Aliens und die Erfindung von Superwaffen. Als die Ereignisse immer turbulenter und dramatischer werden, greift man zur Zeitreise als letztem Mittel, um in der Vergangenheit die Gegenwart zu ändern, mit fatalen Folgen …
Vielen geht es ähnlich wie Sheriff Carter, wenn sie sich darauf einlassen, die Welten der Science-Fiction mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten zu betreten. Verblüfft und etwas naiv lassen sie sich von diesem „anything goes“ faszinieren, staunen über die möglichen Wunder der Technik und fragen, ob das vielleicht bald schon alles Wirklichkeit wird. Sie schaudern ein wenig, wenn sich wieder einmal ein Wissenschaftler als Zauberlehrling versucht, sind froh über ein Happy End und nachdenklich, wenn es zur Katastrophe kommt.
Technoträume gibt es, seit es die Menschheit gibt. Zum Beispiel die Sage von Daedalus und Ikarus, der Traum vom Fliegen, eine Geschichte, die aber auch von Hybris und der Gefahr des Scheiterns berichtet. Noch mehr begeisterten sich frühe Erzähler für Wunderwaffen, Zauberstäbe, die Blitze verschleuderten oder Fluten auslösten, für Schwerter wie Balmung oder Excalibur. Im Zeitalter der industriellen Revolution und vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Visionen wissenschaftlicher und konkreter, sie orientierten sich an der technischen Entwicklung.
Im Roman Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf das Jahr 1887 von Edward Bellamy wird nicht nur das „Theatrophon“ beschrieben, eine spektakuläre Weiterentwicklung des gerade erfundenen Telefons, mit dem man die Musik ferner Orchester hören kann. Es gibt dort auch Flugautos, die Fußgänger werden durch Baldachine über den Gehsteigen vor schlechtem Wetter geschützt und in Fabriken wie im Haushalt erleichtern Maschinen den Menschen das Leben.
Auch bei den beiden größten Pionieren der Zukunftsromane – zu dieser Zeit gibt es den Begriff Science-Fiction noch nicht – Jules Verne und H. G. Wells ist die Technikbegeisterung des Jahrhundertendes zu spüren. Verne beschreibt Reisen zum Mond und durch das Sonnensystem, in das Erdinnere und auf den Grund des Meeres. Erst in seinem Spätwerk machte er sich wie Wells Gedanken über die Gefahren der Technik.
In Deutschland wurde 1910 der Sammelband Die Welt in 100 Jahren zum Bestseller. Dem Journalisten Arthur Brehmer war es gelungen, 26 bekannte Persönlichkeiten, unter ihnen etwa Bertha von Suttner, für Artikel zu allen möglichen Aspekten zu gewinnen.
In seinem Beitrag Das drahtlose Jahrhundert beschreibt Hugo Stoss eine Entwicklung, die die meisten von uns noch vor einem Vierteljahrhundert für höchst utopisch gehalten hätten: das Telefon in der Westentasche. Da heißt es:
„Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem ‚Empfänger‘ herumgehen … Einerlei, wo sie auch sein werden, sie werden bloß den ‚Stimm-Zeiger‘ auf die entsprechende Nummer einstellen brauchen, die sie zu sprechen wünschen, und der Gerufene wird sofort seinen Hörer vibrieren oder das Signal geben können, wobei es in seinem Belieben stehen wird, ob er hören oder die Verbindung abbrechen will. Solange sie die bewohnten und zivilisierten Gegenden nicht verlassen, werden sie es nicht nötig haben, auch einen ‚Sendapperat‘ bei sich zu führen, denn solche ‚Send-stationen‘ wird es auf jeder Straße, in jedem Omnibus, auf jedem Schiffe, jedem Luftschiffe und jedem Eisenbahnzug geben … Und in dem Bestreben, alle Apparate auf möglichste Raumeinschränkung hin zu vervollkommnen, wird auch der ‚Empfänger‘ trotz seiner Kompliziertheit ein Wunder der kleinen Mechanik sein.“ Ein Jahr später beschreibt Hugo Gernsback in seinem Buch Ralph 124C 41+ das 27. Jahrhundert. Gernsback, der später als Vater der Science-Fiction bezeichnet werden wird, ist selbst ein „124C 41+“, ein „one to (two) forsee (four-c) for (four) one plus“. In seiner Vision verrichten mechanische Wesen – noch werden sie nicht Roboter genannt – menschliche Arbeit. In der Welt des Jahres 2660 gibt es Elektromotoren und Leuchtstoffröhren, Radar und Solarzellen, Fernsehen und bemannte Raumfahrt. Seine Prognosen, dass die Schwerkraft aufgehoben, ein Mensch unsichtbar werden könne oder das Wetter in Zukunft kontrollierbar sei, sind aber auch heute noch utopisch.
Spätestens von diesem Zeitpunkt an bekommen viele Utopien und Zukunftsvorstellungen eine technische Komponente. Die Autoren versuchen, ihren Geschichten eine wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Legitimation zu geben, die Fiction wird mit der Science kombiniert. Im Film geschah das vorerst nicht. Die Drehbuchautoren waren unbefangener und die dämonischen Hypnosekräfte eines Doktor Mabuse wurden, wenn überhaupt, nur sehr rudimentär erklärt.
Wegweisend für den deutschsprachigen Raum war Hans Dominik, der die frühe deutsche Science-Fiction geprägt hat und nach dem Ersten Weltkrieg zum Vorbild für Generationen von Autoren bis in die Fünfzigerjahre wurde. 1872 in Sachsen geboren, besuchte er das Gymnasium in Gotha, wo sein Mathematik- und Physiklehrer Kurd Laßwitz war, der als Erster die „Zukunftsliteratur“ im Deutschen Reich populär machte. Dominik wurde später Maschinenbau- und Elektroingenieur bei Siemens und Halske und war an mehreren Patenten beteiligt. Bald übernahm er dort das Literaturbüro – eine Vorform der Pressestelle – und machte sich später als freier Schriftsteller selbstständig. Er schrieb eine Reihe von „technischen Märchen“ für Zeitungen und Das neue Universum.
Nach dem Ersten Weltkrieg gelang ihm der Durchbruch mit seinem ersten Zukunftsroman Die Macht der Drei. Dieser enthielt schon die Muster, die Dominik später zum Erfolgsautor machen würden. Der Roman spielt im fiktiven Jahr 1955, in dem ein Krieg der USA mit dem britischen Empire droht. Drei Wissenschaftler haben einen teleenergetischen Strahler erfunden, mit dem sie die Weltmächte in die Schranken weisen. In den meisten seiner Romane stehen auf der einen Seite deutsche oder zumindest europäische Ingenieure oder Wissenschaftler, die ihre Errungenschaften gegen multinationale Konzerne oder Regierungen – oft sind es nicht ohne rassistische Untertöne Asiaten oder Afrikaner – verteidigen oder ihren Missbrauch verhindern müssen. Dominiks Romane beschäftigen sich mit Raketenantrieben, synthetischem Kautschuk, Tarnkappen, die unsichtbar machen, Strahlenwaffen, Hypnose und der Nutzung der Atomenergie. Auch ein Projekt, das Solarstrom von Afrika nach Europa bringt, wird angedacht. Der Erfolgsautor war erkennbar deutschnational und ließ sich durchaus vom Dritten Reich hofieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden seine Bücher neu aufgelegt und „gesäubert“, teils bis zu einem Drittel gekürzt. Trotzdem ist er – was den technischen Zukunftsroman betrifft – Vorbild für Utopien westdeutscher Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg.
Neben Waffen und Visionen über den Krieg der Zukunft – in einem Jahrhundert mit zwei Weltkriegen und Dutzenden lokaler Konflikte nur zu verständlich – versuchten die Science-Fiction-Schreiber, die nähere Zukunft vom Stand der Wissenschaft und Technologie abzuleiten. Das erste zivile Gebiet war die Entwicklung der Kommunikation. Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde das „Fern Sehen“ oder das „Telefon in der Westentasche“ beschrieben.
Während das Handy heutzutage eine unvorhergesehene Verbreitung gefunden hat, stecken die Übersetzungsgeräte, die sogenannten Translatoren, noch in den Anfängen. Die schriftliche Übersetzung im Computer funktioniert trotz gelegentlicher Heiterkeitseffekte inzwischen recht gut. An einem akustischen Sprachaustausch wird zwar intensiv gearbeitet, aber bislang ist das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend. Ohne Simultandolmetscher geht es noch nicht. Anders in der Science-Fiction: Bei Perry Rhodan NEO können Menschen sich einen Chip ins Gehirn einpflanzen lassen, der jede menschliche Sprache direkt in die eigene übersetzt. Bei Aliens haben die Translatoren hingegen Schwierigkeiten, weil deren Kommunikation oft auf einer den Menschen fremden Logik und Kultur basiert. Von der Gegenwart überholt wurden dagegen die Vorstellungen eines weltweiten Kommunikationsnetzes. Zwar beschrieben schon in den Vierziger- und Fünfzigerjahren Autoren Verbindungen über Satelliten und durch riesige Leitungen verbundene Supercomputer, doch das Internet in der heutigen Form konnten sie sich nicht vorstellen.
Visionen entwickelten die Autoren utopischer Romane auch darüber, wie und vor allem mit welcher Geschwindigkeit wir uns fortbewegen können. In dem kurz nach der Jahrhundertwende gedrehten Kurzfilm Der ‚?‘ Motorist lässt der englische Filmemacher Walter R. Booth ein futuristisch anmutendes Auto so schnell werden, dass es abhebt und durch das Sonnensystem fliegt – ohne sich um eine wissenschaftliche Legitimation zu bemühen. Dagegen sind in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte Vorstellungen von Eisenbahnen, die über 300 km/h und in großen Tunnels durch das Meer fahren, ebenso wie Visionen von riesigen Überschallpassagierflugzeugen heute schon Wirklichkeit. Wir sind gar nicht so weit entfernt davon, dass der Automobilfernverkehr von einer Zentrale aus automatisch gelenkt wird. Die in Filmen gern gezeigten fliegenden Autos dürften dagegen ebenso ein Gag bleiben wie die rollenden Fußgängerwege, auf denen Menschen von den ganz langsamen Wegen außen zu den extrem schnellen Wegen ganz innen springen können. Wahrscheinlicher ist die Bevölkerung des Himmels durch Luftgleiter und Lastenschweber auf unsichtbaren Straßen, auf denen auch Drohnen, die Päckchen oder sonstige Güter bringen, Platz haben dürften.
Eindeutiger Liebling der heutigen Science-Fiction-Autoren ist das Portal, auch Materietransmitter genannt. In der einen Variante werden Menschen in der Ausgangsstation in ihre atomaren Bestandteile zerlegt und durch eine übergeordnete Dimension in die Empfangsstation geschickt, wo sie wieder zusammengesetzt werden, Unfälle nicht ausgeschlossen. Einfacher machen es sich andere Autoren, indem sie die beiden Stationen mit einem Wurmloch oder einer „Einstein-Rosen-Brücke“ verbinden. Dann geht es ganz schnell wie bei Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise, wenn er Ingenieur Scotty „Beam me up“ befiehlt.
H. G. Wells nahm in seinem Roman Befreite Welt aus dem Jahr 1914 die Diskussion über die Nutzung der Kernenergie auf. Als Waffe im Krieg wurde sie meist als Gefahr angesehen, ihre friedliche Nutzung sahen die meisten Autoren als große Chance für die Menschheit, auch wenn Robert A. Heinlein 1940 in seiner Kurzgeschichte Katastrophen kommen vor die psychische Belastung von Menschen, die in einem Kernkraftwerk arbeiten, schildert und auf mögliche Gefahren hinweist. Erst in den Siebzigerjahren kippte die Stimmung, vor allem nach den Unfällen von Three Miles Island und Tschernobyl. Das zeigte sich auch in Romanen, die die Auswirkungen solcher Unfälle in Kernkraftwerken nach Katastrophen oder Sabotageakten schilderten. Gleichzeitig sahen die Science-Fiction-Autoren voraus, dass Grundstoffe für Energie wie Kohle, Öl oder Erdgas begrenzt sind. So ließen sie atomare und fossile Energiegewinnung mehr und mehr beiseite und erzeugten den Strom für ihre Zukunftsstädte lieber durch Sonnen- und Windenergie. Was blieb, war die Vision der Kernfusion als eine durch den überall vorhandenen Wasserstoff unerschöpfliche Energiequelle, eine saubere, strahlenfreie Methode. Gefährlicher, aber für manche Schriftsteller faszinierender war die Idee, aus dem Zusammenprall von Materie und Antimaterie Energie zu gewinnen oder eine übergeordnete Dimension anzuzapfen, etwa mittels eines schwarzen Lochs.
Näher an der Realität sind da schon die Überlegungen über die Medizin der Zukunft. Zwar können sich – anders als in vielen Romanen und Filmen – verletzte oder verstümmelte Menschen noch lange nicht in eine Art Regenerationstank legen, aus dem sie nach einigen Tagen Heilschlaf gesund und mit nachgewachsenen Gliedern herauskommen. Aber die Fortschritte bei der Transplantation von Gliedern und Organen sind in den letzten Jahren frappant und die Wissenschaftler scheinen auch die Zellen, die ein Nachwachsen anregen, bald finden zu können. Der Axolotl, ein mexikanischer Schwanzlurch, dessen Glieder sich regenerieren, dient ihnen als Vorbild. Vorerst Romanen und Filmen vorbehalten bleibt der Versuch, einen Organismus aus verschiedenen Teilen zusammenzusetzen und dabei einen menschlichen Kopf zu verpflanzen wie es Dr. Viktor Frankenstein getan hat. Dagegen könnten künstliche Glieder, die vom Gehirn gesteuert werden und eine von vielen Autoren vorausgesehene Mensch-Maschine-Schnittstelle enthalten, bald Realität werden.
Die Fortschritte im Bereich der Medikamente scheinen dagegen weniger spektakulär. Antibiotika, gegen die Bakterien keine Resistenzen mehr entwickeln (und mit denen sich ein Riesengeschäft machen lässt) sind Gegenstand von Medizinthrilllern, die in der nahen Zukunft spielen. Noch schauerlicher, aber in Ansätzen schon heute realistisch ist das Szenario einer Welt, in der die Mafia oder große Konzerne den Organhandel kontrollieren und sogar Menschen züchten, um ihnen später Organe zu entnehmen. Eine große Hoffnung ist dagegen die individualisierte Medizin. Heute noch ein Schlagwort der Pharmaindustrie, gehen die Science-Fiction-Autoren davon aus, man könne sogenannte Biomarker, also Zellen oder Gene, Hormon- oder Enzymzusammensetzungen, die bei jedem Menschen anders sind, analysieren, die für den Patienten besten Therapien und Arzneimittel ermitteln und anschließend produzieren. Ein solches individualisiertes Medikament könnte etwa in die Blutbahn gespritzt werden, um Krebszellen gezielt anzugreifen, sie zu zerstören und weitere Tumore im Organismus schon im Ansatz zu verhindern. So wundern sich im vierten Star Trek-Film Captain Kirk und Doktor McCoy, als sie die Erde des 20. Jahrhunderts besuchen. Sie hören in einer Klinik Ärzte über eine Chemotherapie diskutieren. McCoy schüttelt den Kopf und sagt: „Das ist ja wie im Mittelalter!“
Wie aber kann ein heute unheilbar kranker Mensch von der Medizin der Zukunft profitieren? Er lässt sich einfrieren und dann auftauen, wenn ein Heilmittel gefunden ist! Dies ist, zumindest was das Einfrieren betrifft, nicht nur Science-Fiction. In den USA und jetzt auch in Russland gibt es Institute, die inzwischen knapp 300 Menschen in flüssigem Stickstoff lagern. Die meisten sind Tote, die irgendwann in der Zukunft auf eine Wiederbelebung hoffen. Aber es gibt auch krebskranke Menschen, die sich in einen Kühlschlaf versetzen lassen. Der Beweis, dass sich der Organismus und vor allem das Gehirn ohne Schaden erhalten und dann wiederbeleben lässt, steht allerdings noch aus.
Autoren und Filmemacher sind fasziniert von dieser Idee. Schon Edward Bellamys Held überspringt durch einen hypnotischen Tiefschlaf 100 Jahre und erwacht in einer futuristischen Welt. Zufällig oder absichtlich eingefrorene Menschen lassen sich ausgezeichnet für staunende oder entsetzte Schilderungen einer Gesellschaft der Zukunft verwenden. Der eisige Tiefschlaf dient in einigen Romanen und Filmen wie Avatar dazu, die lange Reise zu fernen Sternen zu überbrücken. Und in der fünften Episode von Star Wars wird Harrison Ford alias Han Solo in Karbonit eingefroren, um Jahre später im sechsten Teil von seinen Freunden befreit zu werden.
Überhaupt, die Weltraummediziner der Zukunft! Murray Leinster und James White lassen ihre Ärzte in riesigen Raumschiffen durch die Galaxis fliegen, wo sie Menschen und Aliens heilen. Im Gegensatz zu den dort kniffligen Behandlungsmethoden hat es Doktor McCoy vom Raumschiff Enterprise eher leicht. Er hat einen handlichen Apparat namens Tricorder dabei, mit dem er seine Patienten scannt und sofort die wichtigsten Informationen über deren Gesundheitszustand erhält. Was in Ansätzen nicht allzu utopisch ist: Kleine auf dem Körper getragene Geräte messen Fieber, Puls und Blutdruck und können diese Werte über das Internet an medizinische Überwachungsstationen übermitteln. Ein auf diesem Weg übermitteltes EKG, aufgenommen von einem implantierten Chip, ist so wenig utopisch wie ein Urintest, dessen Streifen mit einer App fotografiert und die Daten direkt an den Arzt gesendet werden können. So überholt die rasche Entwicklung der Medizin oft die Science-Fiction.