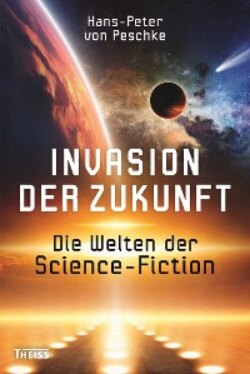Читать книгу Invasion der Zukunft - Hans-Peter von Peschke - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Alles ist machbar – auch Wunderwaffen
ОглавлениеDie Visionen von utopischen Maschinen und Techniken, die dem Menschen das Leben erleichtern, begeistern nicht nur die Science-Fiction-Fans. Noch mehr faszinieren uns – auch wenn wir es ungern zugeben – futuristische Waffen, selbst wenn sie uns bangen und gruseln lassen. Die Star Wars-Filme bieten ein ganzes Arsenal von Laserschwertern über schnittige Raumjäger und Körper auflösende Desintegratoren bis hin zum gigantischen Todesstern, einem riesigen Raumschiff, das ganze Planeten pulverisiert. Es ist die Kombination von Schauder und Allmachtsfantasie, die seit Generationen Leser wie Zuschauer in ihren Bann zieht.
Dies begann schon bei den Vätern der Science-Fiction, Jules Verne und H. G. Wells. Kapitän Nemo, der das von Jules Verne erdachte U-Boot „Nautilus“ steuert, ist ein indischer Prinz, dessen Familie umgekommen ist und der die Weltmeere als eine Art Rächer aller Unterdrückten durchquert. Seine Nautilus wird elektrisch betrieben, kann tief tauchen und verfügt über eine dicke Panzerung. Vor möglichen Enterungen ist das Schiff durch ein Elektroschocksystem geschützt, mit seinem Rammsporn und Seeminen versenkt es die modernsten Kriegsschiffe anderer Völker. In die Lüfte erheben kann sich dagegen die „Albatros“, die Verne als fliegende Plattform schildert, durch Schrauben vorne und hinten angetrieben und steuerbar und von Rotoren in der Luft gehalten. Das an einen Hubschrauber erinnernde Gefährt ist ein machtvolles Instrument. Gesteuert wird es von einem größenwahnsinnigen Genie namens Robur.
Nemo und Robur sind vermutlich auch Vorbilder für die größte deutsche utopische Heftserie vor dem Ersten Weltkrieg. Der Luftpirat und sein lenkbares Raumschiff erschien von 1908 bis 1912 mit insgesamt 165 Ausgaben. Die Familie von Kapitän Mors (dem lateinischen Namen für Tod) wurde von Anarchisten ermordet. Auf einer Insel im Pazifik hat er einen geheimen Stützpunkt, von dem aus er mit seinem lenkbaren Luftschiff Rache an ihnen nimmt und danach gegen alle Unruhestifter, vor allem aus der sozialistischen Ecke, kämpft. Der Bezug zur russischen Revolution 1905 ist unverkennbar. Später baut er zusammen mit einem Professor auch ein „Weltenfahrzeug“, mit dem er die Planeten unseres Sonnensystems erreichen kann.
H. G. Wells steht stellvertretend für eine Reihe von Autoren, die um die Wende zum 20. Jahrhundert die Technologie der kommenden Kriege vorhergesehen haben. Im 1903 geschriebenen Roman The Land Ironclades werden gepanzerte Wagen als Schreckenswaffe dargestellt. Vor allem britische Schriftsteller malten sich aus, wie Luftschiffe und U-Boote in einem Weltkrieg eingesetzt werden. Den verheerenden Stellungskrieg, in dem Millionen auf beiden Seiten verbluteten, haben sie allerdings nicht geahnt. Der wichtigste utopische Roman entstand kurz vor dem Weltkrieg und wurde ebenfalls von Wells verfasst. In Befreite Welt beschreibt er die Nutzung von Atomenergie für den Krieg, er spricht von „Atombomben“. So hießen sie denn auch, als sie entwickelt wurden.
Der durch utopische Romane bestärkte Glaube, im Bereich Waffentechnik sei alles möglich, verdichtete sich vor allem in Deutschland zu der Überzeugung, kriegsentscheidende „Wunderwaffen“ könnten den Konflikt rasch beenden. Hatten schon die Krupp-Hinterlader-Geschosse im Krieg 1870/71 nicht unwesentlich zum Sieg über Frankreich beigetragen, erhoffte man dies im Ersten Weltkrieg von der erstmals sogenannten „Dicken Bertha“ und dem „Paris-Geschütz“. In der Weimarer Republik waren es die Romane Hans Dominiks, die den Erfindungsreichtum europäischer, meist deutscher Ingenieure beschrieben. Von 1933 bis 1936 unterstützten in der von Paul Alfred Müller verfassten 150-bändigen Heftserie Sun Koh geniale Wissenschaftler den Prinzen von Atlantis im Kampf um sein Erbe. 1935 konzipierte der gleiche Autor eine den neuen Machtverhältnissen angepasste Serie. Die Hauptfigur Jan Mayen ist ein deutscher Millionärssohn, der wie einst der Luftpirat Verbrecher in der ganzen Welt bekämpft. Er tut dies in einem Flugzeug mit Atomantrieb und weiteren technologischen Gimmicks, um dann nach 120 Bänden Grönlands Eis zu schmelzen und darunter das „sagenhafte Wunschland Thule“ zu errichten.
In den USA sorgten die „Pulp-Magazine“ – Pulp steht für das damalige billige Zeitschriftenpapier – für die Verbreitung der Science-Fiction und damit auch des technologischen Wunderglaubens. Mit dem Slogan „Heute noch übertrieben … morgen schon Tatsache“ warb Hugo Gernsback für seine Amazing Stories. Auch die Namen der anderen Pulps wie Science Wonder Stories, Thrilling Wonder Stories, Astounding Stories charakterisierten deren Inhalt: sagenhafte technische Erfindungen und viel Action, also auch viel Kampf und Waffentechnik, natürlich im galaktischen Ausmaß. In Jack Williamsons 1934 erschienener Weltraumlegion kämpfen die „Wächter des Alls“ mit gigantischen Raumschiffen und Strahlenwaffen. Edward E. „Doc“ Smiths Lensmen-Zyklus beginnt als Kampf des Guten mit dem Bösen in unserem Sonnensystem, weitet sich auf die Milchstraße aus und endet im Krieg der Galaxien. Dabei werden auch die Waffen immer gigantischer. Frühe Vorfilm-Serien wie Flash Gordon und Buck Rogers kamen zu den Pulps hinzu und bestärkten die junge amerikanische Generation in der Überzeugung, dass technologisch alles möglich sei.
Das nationalsozialistische Regime, aber auch seine Kriegsgegner benutzten den Glauben an mögliche Wunderwaffen für ihre propagandistischen Zwecke. Je schwieriger die Lage im Zweiten Weltkrieg wurde, umso mehr schürte die Goebbels-Presse die Hoffnung auf im Geheimen arbeitende Wissenschaftler, die mit Raketen, ultraschnellen Flugzeugen und neuen Superpanzern die Wende zum „Endsieg“ bringen würden. Die Medien der Alliierten rekurrierten ihrerseits auf die Berichte von den Wunderwaffen, auch wenn sie nicht unbedingt daran glaubten. So sollte die eigene Bevölkerung zu noch größeren Anstrengungen gegen den Kriegsgegner motiviert werden.
Der Glaube an das Können der Wunderwaffen-Ingenieure reichte bis in die Nachkriegszeit, als deutsche Forscher und Techniker in die Länder der Siegermächte exportiert wurden und dort großen Einfluss auf die Militärtechnik hatten. In der englischsprachigen Science-Fiction spiegelte sich diese Entwicklung wider, immer utopischere Waffen und Waffensysteme wurden detailliert beschrieben. Bis heute ist daraus ein ansehnliches Arsenal geworden, im Wörterbuch der Science-Fiction werden weit mehr als 100 aufgelistet.
Die harmlosesten Waffen sind die Paralysatoren, die den Gegner bewegungsunfähig machen, oder der Hypnostrahler, der Feinde in willfährige Befehlsempfänger verwandelt. Mit Desintegratoren, Phasern und allen Arten von Laserpistolen dagegen kann alle Materie, also auch menschliche Körper, aufgelöst werden. Antiquiert, wenn auch spektakulär erscheinen dagegen die Lichtschwerter der Jedi-Ritter in Star Wars. Bodentruppen setzen auch Energiewerfer, Schallgranaten und sogar Antimateriebomben ein. Raumschiffe kämpfen mit allen Arten von Strahlenkanonen und Raumtorpedos. Fast eine ultimative Waffe ist Douglas Adams „30-Megatöt-Definit-Kill-Photrazon-Kanone“, der Name spricht für sich selbst.
Die Schutzanzüge dienen nicht nur dem Aufenthalt im luftleeren Weltraum, sondern auch als Vielzweckrüstung. Sie machen die Kämpfer dank eines „Chamäleonüberzugs“ oder mittels Deflektortechnik, die das Licht um sie herum lenkt, fast unsichtbar. Manchmal sind sie wie beim Superhelden Iron Man schwer gepanzert, eleganter sind den Körper umflimmernde energetische Schutzschirme, die selbst den Beschuss durch Strahlenwaffen aushalten.
Dazu kommen mechanische Einheiten wie alle Arten von Drohnen, von den kleinsten, nur fliegengroßen, bis zu riesigen ferngelenkten Waffenträgern. Auf dem Schlachtfeld zu finden sind noch Kampfroboter, die humanoide Umrisse haben und meist stur den einprogrammierten Befehlen folgen. Eine besondere Variante sind die „Mechs“, bis zu 14 Meter hohe und gut 100 Tonnen schwere Maschinen, die in dem aus einem Brettspiel entstandenen und später in mehr als 100 Romanen beschriebenen Battletech-Universum spielen. Gelenkt werden sie von darin sitzenden „Warriors“, die heutigen Kampfpiloten nicht unähnlich die Ungetüme steuern. In Star Wars bekämpfen mechanische Stoßtruppen, die „imperialen Kampfläufer“, die Rebellen. Ultimative Waffe ist hier die Starkiller-Basis: Sie zerstört gleichzeitig mehrere Planeten.
Ebenfalls gigantisch ist das Waffenarsenal der Perry Rhodan-Serie. Schon 1961 beschrieb Karl-Herbert Scheer die Arkonbombe, die einmal gezündet eine planetenweite Kettenreaktion auslöst und so eine ganze Welt auslöscht. Noch schrecklicher ist das „Hyperinmesotron“, das Perry Rhodan im Kampf gegen die Herren der Andromeda-Galaxis, die „Meister der Insel“, einsetzt. Diese auf einem Raumschiff installierte Geheimwaffe kann eine Sonne mit „Hyperinmesionsschwingungen“ überfluten und durch den „Wiezold-Effekt“ Teile der Sonnenmasse in Antimaterie verwandeln. Da Antimaterie und Materie nebeneinander nicht existieren können, verwandelt sich die bestrahlte Sonne in eine gigantische Bombe. Das ist natürlich purer Unsinn, aber Science-Fiction-Leser lieben diesen sogenannten „Technobabble“ (ein Mix aus den Worten Technologie und Gebrabbel), mit dem die Science-Fiction-Autoren versuchen, die von ihnen erfundenen technologischen Errungenschaften oder Vorgänge mit wissenschaftlich klingenden „Fachausdrücken“ zu legitimieren.
Kein Wunder, dass ein neuer Trend in der Wissenschaft wie in der Science-Fiction, nämlich die Nanotechnologie, die Autoren zu ganz neuen Waffenerfindungen anregt. Kann man sich gegen Millionen vom Wind getragene Teilchen in Nanogröße wehren, die Bomben, Panzer und anderes Material fressen oder sich erst im feindlichen Lager zusammenbauen, um zu explodieren? Denkbar ist auch die Spionage mittels Minikameras, die Sabotage feindlicher Waffenfabriken oder Infrastruktur und die Umprogrammierung von Kampfrobotern oder Soldaten des Gegners durch Nanoteilchen.
Dann gibt es Waffen, die nicht im physischen Kampf eingesetzt werden, aber ebenso wirksam sind. Zunächst sind das alle Arten des Cyberkriegs: Hacker spionieren nicht nur gegnerische Waffenkonstruktionen und Strategien aus, sie können auch die gesamte Infrastruktur lahmlegen. In den Fünfzigerjahren beschrieb C. L. Moore, wie eine Waffe alle elektrischen Geräte außer Betrieb setzt, heute ist diese Vorstellung durch den „Nuklearen elektromagnetischen Impuls (NEMP)“ potenzielle Realität. Denkbar sind auch Strahlen, die menschliches Verhalten beeinflussen oder steuern können. Dies können „Friedensstrahler“ sein, aber auch „Emotio-Strahler“, die Aggressionen schüren. Poul Anderson imaginierte schon 1950 The Perfect Weapon: Scheinbar relativ harmlos zerstört diese Waffe Papier. Aber ohne schriftliche Aufzeichnungen und Bücher bricht die Wissenschaft zusammen und schließlich die ganze Zivilisation. Als Anderson das schrieb, gab es noch keine Computer. Heute beschreiben die Autoren den völligen Zusammenbruch der Welt, wenn durch eine Waffe oder Computerviren alle digitalen Geräte zerstört werden.
Dass Science-Fiction eine mögliche technologische Weiterentwicklung und die Projektion einer künftigen Gesellschaft auf wissenschaftlicher Basis beschreibt, war seit Hugo Gernsback Vision aller „ernsthaften“ Autoren des Genres. Sie mussten aber erleben, dass Wildwestgeschichten im Weltraum und Angriffe schrecklicher Monster meist mehr Leser fanden. Dennoch prägte die „Science“ in den wirklich großen Romanen die Literaturgattung. Am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts scheinen die Technoträume nicht mehr so wichtig. Vielleicht weil die gegenwärtige technologische Entwicklung rascher verläuft als je zuvor und die Menschen in dieser Hektik und Überforderung mehr an spannungsgeladener Ablenkung und magischen Elementen interessiert sind. Futuristische Geräte und Wunderwaffen sind notwendige Accessoires für Romane und Drehbücher, wobei sich die Autoren ziemlich schamlos bei ihren Vorgängern bedienen. Es gibt kaum eine Waffe oder technische Errungenschaft, die nicht schon irgendwo beschrieben worden ist und deshalb zur Ausschmückung einer Zukunftsgesellschaft oder eines ganzen Universums dienen kann. Zum Dekor der actiongeladenen Geschichte dienen aber auch Zauberei und Rückgriffe auf antike Gesellschaftsformen, deren Realitätsgehalt nicht hinterfragt wird. Deshalb kommt es immer mehr zur Vermischung von Science-Fiction-Elementen mit den magischen und esoterischen Vorstellungen der Fantasy. Der frühere Glaube „Alles ist machbar“ wird durch ein umfassenderes und nicht immer fantasievolles „Alles ist denkbar“ ersetzt.
SF-Spezial
Mad Scientists
Mit dem Spruch „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör“ wird der schusslige, aber liebenswerte Diplom-Ingenieur Daniel Düsentrieb beschrieben. Er erfindet so ziemlich alles, neben eher skurrilen Dingen wie dem tragbaren Loch, Kaugummibäumen, behaarten Wintertürklinken und dem Telefon mit eingebautem Bügeleisen eine Reihe von in die Zukunft weisenden Produkten. Dazu gehört ein unzerstörbarer Kunststoff für Geldspeicher, ein Luftroller wie in Zurück in die Zukunft, das „Dunkellicht“, das den Tag zur Nacht macht, sich selbst leerende Mülltonnen samt einem vollautomatisierten Haus. Natürlich ist das ganz ohne ernsteren wissenschaftlichen Hintergrund, die Disney-Zeichner bedienen sich aber gern bei der amerikanischen Science-Fiction. Plötzlich kann Düsentrieb auch ein Raumschiff bauen, das schneller als das Licht fliegt und damit gleichzeitig Tachyonen nachweisen. Seine genialste Erfindung ist aber sein kleiner Roboter „Helferlein“, der mit künstlicher Intelligenz und einer Prise Kritik an seinem Herrn gesegnet ist.
Daniel Düsentrieb ist ein typischer „mad scientist“ der guten Sorte wie auch Doktor Emmett Brown in Zurück in die Zukunft. In Comics und im Film erinnern solche Wissenschaftler ein wenig an Albert Einstein. Sie tragen wirres weißes Haar und leicht schlampige Kleidung. Neben diesen äußeren Merkmalen sind sie so freundlich wie naiv, so hilfsbereit wie zerstreut.
Anders die „bösen“ verrückten Wissenschaftler: Sie sind nur an ihren Experimenten und nicht an den Folgen für die Menschheit interessiert, sie sind zynisch und grausam, sogar sadistisch. Schon 1920 hypnotisiert im Stummfilm Das Cabinet des Dr. Caligari der dämonische Forscher seine Diener, die dann auf seinen Befehl Morde begehen. Auch er geht an seiner eigenen Hybris zugrunde so wie andere Doktoren von Faust über Frankenstein und Jekill bis zu Mabuse. In den amerikanischen Pulp-Storys war der verrückte Wissenschaftler, dessen Erfindungen die größten Katastrophen herbeiführen, ein beliebtes Thema. Manch einer von ihnen strebt sogar nach der Weltherrschaft wie Dr. No oder Ernst Stavro Blofeld in den James-Bond-Filmen, die beide mit futuristischen Waffen ausgestattet sind.
Der sicher populärste „mad scientist“ ist Dr. Strangelove (dt.: Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben) in Stanley Kubricks gleichnamigem Film aus dem Jahr 1964. Er erzählt die Geschichte eines wahnsinnigen amerikanischen Generals, der einen vernichtenden Atomschlag gegen die UdSSR führt und dabei einen ebenso vernichtenden sowjetischen Gegenschlag auslöst. Im fiktiven „War Room“ des Pentagons sitzt Dr. Seltsam im Rollstuhl, ein deutscher Wissenschaftler, der für die amerikanische Regierung arbeitet und dessen rechte Armprothese immer wieder ungewollt zum Hitlergruß emporschnellt. Angesichts der hoffnungslosen Situation macht der von Peter Sellers gespielte Mann den Vorschlag, einen kleinen Teil ausgesuchter Menschen für 100 Jahre tief in Bergwerken unterzubringen und durch ein Zuchtprogramm ihr Überleben zu sichern. Am Ende des Films steht er mit den Worten „Mein Führer, ich kann wieder gehen“ aus seinem Rollstuhl auf.
Manchmal sind die Forscher aber weder liebenswert noch verrückt, sondern können nur hilflos staunen. So kreiert der amerikanische Teilchenphysiker Gregory Benford in seinem Roman Cosm ein „Universum in der Westentasche“. Im amerikanischen Teilchenbeschleuniger auf Long Island lassen Wissenschaftler für Sekundenbruchteile Uranatome aufeinanderprallen, um die Reaktion und den Zerfall zu beobachten. Unerwartet entsteht durch das Experiment eine merkwürdige, silbern schimmernde Kugel. Nach eingehender Untersuchung stellt sie sich als Miniaturuniversum heraus, das man über eine Art Wurmloch beobachten kann. Es ist ein Weltall, in dem die Zeit millionenfach schneller vergeht als bei uns. So können die Wissenschaftler verfolgen, wie aus der Urmaterie Galaxien hervorgehen und Planeten mit blühenden Zivilisationen erscheinen, die andere Sternsysteme besiedeln und dann wieder untergehen. Schließlich kommt für das kleine Universum der Wärmetod. Hinterfragt wird in diesem Roman auch die Rolle des Wissenschaftlers. Darf er ein Experiment, das in das Weltgefüge eingreift, durchführen?