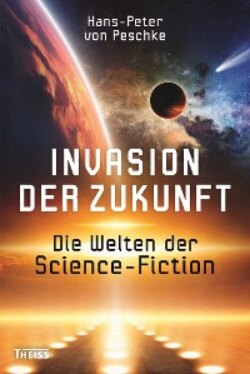Читать книгу Invasion der Zukunft - Hans-Peter von Peschke - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Die Nanos kommen
ОглавлениеDas jüngste Beispiel für den engen Zusammenhang von technologischer Entwicklung und Science-Fiction ist die Nanotechnologie. Seit gut einem Vierteljahrhundert ist sie eines der beliebtesten Sujets im utopischen Genre, obwohl sie einen langsamen, wenn auch „phantastischen“ Start hatte. Lange Zeit machten sich Science-Fiction-Fans gedanklich auf die Reise in „unendliche Weiten“ und Sternensysteme, „die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“. In eine ganz andere Welt schickte der amerikanische Regisseur Richard Fleischer die Kinobesucher im Jahr 1966: Sein Film Die phantastische Reise findet vor dem Hintergrund des Kalten Krieges statt. Auf einen tschechischen Wissenschaftler, der übergelaufen ist, wird ein Attentat verübt, das einen Thrombus verursacht. Um an sein Wissen heranzukommen, muss innerhalb von einer Stunde das Blutgerinnsel entfernt werden. Das ist nur durch eine neue Erfindung möglich, die es erlaubt, Menschen und Maschinen auf Mikrobengröße zu verkleinern. Mit einem durch eine Spritze in die Blutbahn applizierten Miniatur-U-Boot kämpft sich die miniaturisierte Besatzung durch die Arterien zum Gehirn, wo sie mittels eines Lasers den Thrombus beseitigt. Die Story ist banal, doch die Reise durch den menschlichen Körper in psychedelischen Farben begeisterte die damaligen Zuschauer.
Um den Plot plausibel zu machen, engagierten die Filmemacher sogar den berühmten Science-Fiction-Autor Isaac Asimovfür ein Begleitbuch, in dem die Miniaturisierung mit einem plausiblen pseudowissenschaftlichen Hintergrund beschrieben wurde. Wenn auch seine Erklärungen – man merkt dem promovierten Biochemiker Asimov seine Skepsis durchaus an – wenig mit heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden zu tun haben, werden im Buch einige potenzielle Anwendungen aufgegriffen: Man könne so ein U-Boot in den Körper schicken, um gefährliche Wucherungen und Tumore zu beseitigen, oder kleine Roboter aussenden, die regelmäßig alle Blutbahnen durchforsten und dort für Ordnung sorgen. Heute sind solche Vorstellungen schon näher an der Realität: Am Stuttgarter Max-Planck-Institut etwa wurde eine künstliche, haargroße Muschel entwickelt, die von Magneten gesteuert schon in naher Zukunft durch den Körper manövriert werden kann. Die Arbeitsgruppe „Mikro-, Nano- und Molekulare Systeme“ hofft, dass mit diesen Mikroschwimmern Heilmittel an Krankheitsherde transportiert werden können.
Mit dem Film Die phantastische Reise kam die Nanotechnologie – auch wenn die Bezeichnung noch nicht geboren war – in die Science-Fiction. Auch vorher gab es in der fantastischen Literatur Miniaturwelten – denken wir nur an die Liliputaner und alle Sorten von Kobolden. Der deutsche Science-Fiction-Pionier Kurd Laßwitz ließ einen seiner Romane auf der Oberfläche einer Seifenblase spielen, Verkleinerungsfaktor 1:100 Millionen. Damit sind wir bereits im Bereich der Nanotechnologie. Hier geht es um Teilchen mit einer Größe von 100 nm (ein Nanometer ist ein milliardstel Meter) bis hin zum einzelnen Atom. Solche Größenordnungen versuchen die Wissenschaftler mit zwei entgegengesetzten Ansätzen zu erreichen: einmal „top-down“ durch eine immer weitere Verkleinerung von Werkzeugen und Produkten, einmal „bottom-up“, indem man vor allem in der Chemie und Oberflächenphysik Atome und Moleküle zu größeren, aber noch immer winzigen Verbindungen zusammenbaut. Einige der wenigen gegenwärtig erhältlichen Nanoprodukte sind schon seit Jahrzehnten auf dem Markt, haben aber die Vorsilbe „Nano“ aus Marketinggründen erst heute erhalten. Es handelt sich um Beschichtungen und Lacke für Autos und schmutzabweisende Kleidungsstücke.
In den Neunzigerjahren etablierten sich alle Arten von „Nanos“ vermehrt in den Welten der Science-Fiction. Ein Grund war das Buch Engines of Creation des amerikanischen Ingenieurs Eric Drexler. Er ist davon überzeugt, dass man Atome so manipulieren kann, dass sie wie Legosteine zusammengefügt werden können. Winzig kleine Roboter – sogenannte Assembler – setzen in Nanofabriken Atome und Moleküle zusammen und schaffen so Produkte für die Makrowelt: Nahrungsmittel, Computer, Organe, Häuser und sogar Raumschiffe. Vorbild für diese Nanowerkstätten ist nach Drexler die Natur, da in allen Lebewesen molekulare Maschinen für chemische und physikalische Prozesse verantwortlich sind. Als Beispiel für einen Nanocomputer nennt er die menschliche Erbsubstanz, das Genom. Immerhin enthält ein einziges DNA-Molekül alle Informationen, um einen Menschen zu erzeugen. Aber können wir das nachahmen? Auch wenn bis heute einige kleine Schritte in Richtung Drexlers Vision umgesetzt wurden, halten die meisten Wissenschaftler seine Ideen für unrealistisch, weil es zu viele energetische und mechanische Probleme gibt, die den Zusammenbau maßgeschneiderter Moleküle verhindern.
Die größten Hoffnungen setzen Wissenschaftler wie Autoren auf Fortschritte in der Medizin, vor allem auf den Einsatz von Nanoteilchen als eine Art Polizei im menschlichen Körper. So beschreibt Nancy Kress 1994 in ihrem Buch Bettler und Sucher einen nanotechnischen „Zellreiniger“, der dem Patienten in eine Arterie injiziert wird, sich vermehrt und im ganzen Körper ausbreitet. Er kann Bakterien von menschlichen Zellen unterscheiden und schädliche vernichten oder zumindest isolieren. Einen Schritt weiter geht der deutsche Autor Andreas Eschbach in Herr aller Dinge. Bei ihm sind die Nanoviren, die Krebszellen abtöten können, direkt mit dem Gehirn des behandelnden Arztes verbunden, der sie steuern und gegebenenfalls falsche Maßnahmen verhindern kann.
Dass solche euphemistisch beschriebene Nanomedizin nicht ungefährlich ist, malt Greg Bear in seinem Roman Blutmusik aus. Ein Wissenschaftler spritzt sich heimlich die in seiner Firma entwickelten und für zu gefährlich gehaltenen Nanoorganismen ins Blut. Erst scheint alles besser. Er ist nie mehr erkältet und sieht schärfer. Dann aber entwickeln die kleinen Teilchen eine Art Schwarmintelligenz, optimieren den ganzen Körper in ihrem Sinne und übernehmen ihn schließlich.
Um der Dramatik willen schreiben die Autoren lieber über Horrorvisionen, in denen die Nanotechnik außer Kontrolle gerät. Michael Crichton schildert in seinem Roman Beute, wie einige eigentlich harmlose Nanoteilchen zusammen mit ein paar „Assemblern“, Mikrofabriken mit der Fähigkeit, die Nanos zu reproduzieren, aus einem Labor entkommen. Im Verbund entwickeln die Teilchen ein gemeinsames Bewusstsein und lernen, die Menschen zu verstehen und schließlich zu imitieren. Am Ende jagen die Nanoroboter Lebewesen und zerstören die Biosphäre, um Rohstoffe für ihre Vermehrung zu erlangen.
„Haarsträubend, aber plausibel“, so nennt der amerikanische Romancier Jeff Carlson seine Nanotrilogie: Nano, Plasma und Infekt. Darin sterben 5 Milliarden Menschen an Nanoviren und eine Wissenschaftlerin kämpft verzweifelt darum, einen Impfstoff zu entwickeln. In solchen Thrillern wird aktuell die Nanotechnologie zum Szenario, auf das die Menschen ihre Ängste projizieren können. Die Autoren orientieren sich weniger am Stand und dem Wissen um diese Technologie als vielmehr an viel Spannung und Horrorelementen, um damit mehr Leser zu gewinnen. Ganz anders die deutsche Wissenschaftlerin Antonia Fehrenbach, die in ihrem Krimi Der Lotus-Effekt Alltag, Intrigen und Einfluss der Pharmaindustrie schildert, wobei sie die wirklichen Probleme der Nanoforschung schildert und die übertrieben dargestellten Gefahren ihrer Science-Fiction-Kollegen widerlegt und relativiert.
Neal Stephenson versucht in seinem Roman Die Grenzwelt eine Lösung anzubieten. In einer fortschrittlichen Informationsgesellschaft müsse es ein „Protokoll“ geben, auf das sich alle Länder und Wissenschaftler verpflichten: Wenn die Nanoteilchen ihre Aufgabe erfüllt haben, müssen sie sich deaktivieren und in harmlose Stoffe umwandeln. Eine internationale Behörde müsse über dieses Protokoll wachen und auch in der Lage sein, Verstöße und wissenschaftliche Fehlversuche zu beheben.
Inzwischen wird mit dem Präfix „nano“ geradezu inflationär umgegangen. Dies gilt vor allem für Fernsehserien und Filme. So hält die Nanotechnologie im Star Trek-Universum Einzug. Raumschiff Enterprise begegnet intelligenten „Naniten“, die das Schiff kurzzeitig übernehmen. Die Borg, ein aggressives und expansives Kollektivvolk, injizieren anderen Intelligenzwesen Nanoteilchen, mit denen sie sich all ihr Wissen aneignen, sie mit Implantaten verbessern und schließlich der Borg-Zivilisation einverleiben. Im dritten Teil von Iron Man wird der Anzug des Haupthelden Tony Stark nanotechnisch aufgerüstet, sodass er auch über Entfernung mit seinem Besitzer kommunizieren kann. In Terminator 3: Rebellion der Maschinen verfügt die aus der Zukunft gekommene „Terminatrix“ über die Möglichkeit, andere Computer und Roboter mittels Nanoteilchen zu infiltrieren. Der aus dem Marvel-Universum bekannte Hulk ist im Film nicht nur Strahlenphysiker, sondern auch Nanotechnologe.
Weil es gerade Mode ist, taucht die Nanotechnologie in immer mehr Romanen, in Filmen und Serien als Accessoire auf, ohne dass ihre wissenschaftlichen Hintergründe auch nur ansatzweise reflektiert werden. Aber das scheint nicht nur in diesem Bereich ein allgemeiner Trend der Science-Fiction des 21. Jahrhunderts zu sein.
SF-Spezial
Was ist Science-Fiction?
„By ‚scientifiction‘ I mean the Jules Verne, H. G. Wells and Edgar Allan Poe type of story — a charming romance intermingled with scientific fact and prophetic vision … Many great science stories destined to be of historical interest are still to be written … Posterity will point to them as having blazed a new trail, not only in literature and fiction, but progress as well.“ So definiert der oft als Vater der Science-Fiction bezeichnete Hugo Gernsback in der April-Ausgabe seiner Amazing Stories 1926 das neue Genre.
Science-Fiction hat sich zunächst in der Literatur entwickelt, ist inzwischen aber auch in allen audiovisuellen Medien präsent. Der von Gernsback erstmals verwendete Begriff verbindet die Worte Wissenschaft und Fiktion. In diesem engeren Sinne geht es darum, ausgehend vom jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft und Gesellschaft realistische Spekulationen über die zukünftige Entwicklung anzustellen. Der wissenschaftliche Gehalt soll – so die Verfechter der reinen Lehre – Science-Fiction-Geschichten von anderen Genres der fantastischen Literatur abheben.
Auf der Grundlage dieser unscharfen, aber in der Medienwissenschaft weitgehend anerkannten Definition wird die Science-Fiction in eine „Hard-SF“ und eine „Soft-SF“ unterteilt. Als „harte“ Themen gelten solche, die sich aus den Naturwissenschaften und ihrer praktischen Anwendung ergeben, etwa Spekulationen über die Entwicklung der Computer, die künftige Raumfahrt oder genetische Manipulationen an Mensch und Natur. Zu den „weichen“ Bereichen zählt alles, was sich mit Mensch und Gesellschaft beschäftigt und sich eher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften herleitet. Die Autoren beschäftigen sich mit der Entwicklung der zukünftigen Gesellschaft, ihrer politischen Konstruktion und ihren Wertvorstellungen, beschreiben Aufstieg oder Fall von Zivilisationen. Aber auch die Entwicklung des Individuums und seines Geistes gehört in diese Kategorie.
Was unter Science-Fiction zu verstehen ist, ist einem ständigen Wandel unterworfen, nicht nur in der Literaturwissenschaft, sondern auch bei den Konsumenten. Schon Hugo Gernsback musste erkennen, dass die Leser seines Magazins vor allem spannende und abenteuerliche Zukunftsgeschichten lesen wollten, ob sie nun einen wissenschaftlichen Hintergrund hatten oder nicht. Auch in den Dreißiger- bis Fünfzigerjahren, die man später als „Golden Age“ der Science-Fiction bezeichnete, waren die Weltraumschlachten der Space Operas beliebter als technisch ausgefeilte Utopien.
In den letzten Jahrzehnten, in denen zunehmend Filmepen und Fernsehserien sowie Computerspiele unser Bild der Fantastik geprägt haben, wird unschärfer, was vom Publikum als Science-Fiction gesehen wird. Autoren und Produzenten bedienen sich bei Geschichten, die in der Zukunft spielen, ungeniert in den Genres Horror und Fantasy, sogar bei Märchen und Mythen. Die modernen Ritter der Tafelrunde kämpfen mit Laserschwertern und Raumschiffen, Zaubereien werden mit PSI-Kräften durchgeführt, die Herrscher der Galaxis ähneln antiken Imperatoren und in apokalyptischen Endzeitszenarios wimmelt es von Zombies. All dies wird dann unter dem Kürzel „SciFi“ oder „SF“ verkauft. Die klassische Science-Fiction gibt es so – auch in der Literatur – kaum mehr. Manche Medienunternehmen verwenden das Kürzel SF nicht mehr für Science-Fiction, sondern für „Speculative Fiction“. Im deutschsprachigen Raum ist oft nur noch von fantastischer Literatur die Rede.