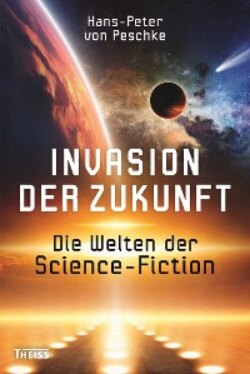Читать книгу Invasion der Zukunft - Hans-Peter von Peschke - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Der Roboter, dein Freund und Helfer
ОглавлениеZwei seltsame Gestalten gehen durch die Wüste eines fernen Planeten. Eigentlich gehen sie nicht. Der Kleinere schlurft mit seinen Metallfüßchen durch den Sand, der große Goldene stelzt mit eckigen Bewegungen hinterher, ständig vor sich hin murmelnd: „Wir müssen Prinzessin Leia retten! Vorwärts, R2-D2!“ Der kleine Roboter, dessen Rumpf in einer gewölbten Kugel endet, blinkt vor sich hin und gibt Piepstöne von sich. Der menschenähnliche Roboter hinter ihm, übersetzt die schrillen Geräusche und antwortet gleich: „Du meinst, dass wir unsere Wichtigkeit überschätzen. Ich überschätze meine Wichtigkeit keineswegs. Ich behaupte sogar, der bescheidenste Droide zu sein, den ich kenne. Ich bin nur ein Protokolldroide mit einer exzellenten Datenbank und beherrsche lediglich sechs Millionen Formen der Kommunikation.“ R2-D2 bleibt abrupt stehen, die roten Lichter in seinem Kugelkopf flackern. „Natürlich kannst du mehr, mein Kleiner“, sagt C-3PO, „Anakin Skywalker hatte dir einige Extras spendiert: Gasdüsen zum Fliegen im Weltraum, Energiezellen, Audio- und Photorezeptoren, Gyrometer und Lebenszeichenscanner. Und vor allem kannst du mit deinem beweglichen Computerinterface-Arm mit anderen Systemen kommunizieren und sie sogar kontrollieren.“
R2-D2 und C-3PO, der liebenswerte Kleine und der malerische Angsthase, treten in allen Star Wars-Filmen auf und sind – wie George Lucas, der Erfinder des Star Wars-Universums sagt – „die eigentlichen Helden der Saga“. Deshalb sind sie derzeit die bekanntesten und auch beliebtesten Roboterfiguren aller Science-Fiction-Welten. Ganz anders tritt uns der Schiffsroboter HAL im Film 2001: Odyssee im Weltraum gegenüber.
Eigentlich ist HAL nur das Gehirn des Raumschiffs „Discovery“, dessen Funktionen er allumfassend steuert. HALs Name bedeutet nach eigener Aussage „Heuristic ALgorithmic“. Filmrezensenten vermuten aber, dass hier auf die Firma IBM angespielt wird, deren Name sich ergibt, wenn man im Alphabet von HAL um jeweils einen Buchstaben zurückgeht. Das elektronische Bordgehirn will nach einer falschen Messung den Flug zum Jupiter abbrechen. Als die Besatzung ihn wegen dieser Fehlfunktion abschalten will, empfindet er dies als Mord und wehrt sich dagegen, indem er alle Menschen an Bord umbringt bis auf einen, der sich retten kann. Dieser schaltet den neurotischen Computer schrittweise ab, der dabei wie ein Mensch regrediert. Aus dem hochintelligenten Bordgehirn wird ein trotziger Pubertierender und schließlich ein Kind, das „Hänschen klein“ singt. (In der englischen Fassung ist es das Lied „Daisy Bell“, das 1962 auf einem IBM-704-Computer programmiert wurde.) HAL steht für eine künstliche, aber menschenähnliche Intelligenz, die lernfähig ist und Emotionen zeigen kann.
Die Science-Fiction-Autoren unterscheiden zwischen Robotern und meist unbeweglichen Großrechnern. Roboter sind bewegliche Maschinen, die irgendwelche Tätigkeiten ausführen, deren „Herz“ irgendein Energiespeicher oder eine Energiezelle und deren „Hirn“ ein Computer ist. Die meist unbeweglichen Großrechner steuern Raumschiffe, große Industrieanlagen oder überwachen den Verkehrsfluss von Metropolen. Die Gefahr bei all diesen künstlichen Intelligenzen ist, dass sie den Befehlen der Menschen nicht mehr gehorchen oder sogar zu Gegnern der Menschen werden.
Eine Lösung für dieses Problem bietet der berühmte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov in seinen Robotergeschichten. Seine von der „US Robots and Mechanical Men Inc.“ hergestellten Maschinenmenschen haben eine hohe künstliche Intelligenz, die Sachlagen und Probleme mit reiner Logik und ohne Emotionen angehen. Es gibt trotzdem ausnahmsweise Fehlfunktionen, die sich für Kurzgeschichten gut eignen und von einer seiner Lieblingsfiguren, der Robotpsychologin Susan Calvin, behandelt werden. Damit sich diese Roboter als gute Diener und Werkzeuge erweisen, folgen sie den drei Gesetzen der Robotik:
1. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
2. Ein Roboter muss den Befehlen gehorchen, die ihm von Menschen erteilt werden, es sei denn, dies würde gegen das erste Gebot verstoßen.
3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange solch ein Schutz nicht gegen das erste oder zweite Gebot verstößt.
Diese 1942 entwickelten „Asimov’schen Robotergesetze“ werden auch heute noch von den Wissenschaftlern diskutiert und anerkannt, obwohl die künstliche Intelligenz von Computern noch nicht so weit entwickelt ist, dass ihre Einführung heute schon sinnvoll wäre. Aber vielleicht wird in wenigen Jahrzehnten eine solche Roboterethik nötig sein. Übrigens hat Asimov später in seinem Roman Das galaktische Imperium – er gehört zum berühmten Foundation-Zyklus – noch ein „nulltes“ Robotergesetz hinzugefügt:
0. Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird.
Dieser den drei Gesetzen übergeordnete Grundsatz – übrigens von einem Roboter erdacht und in die Gehirne seiner Kollegen eingeführt – dient der Spannung des Zyklus, ist aber höchst problematisch. Denn er besagt nicht weniger, als dass ein Roboter über das Schicksal der Menschheit urteilen kann, indem er den Grundsatz über das erste Gesetz stellt. Bei Asimov sind die Roboter höchst ethisch und arbeiten im Hintergrund, um den Menschen zu helfen und sie notfalls vor sich selbst zu retten. Vor Asimov waren die Maschinenmenschen in vielerlei Hinsicht eher Schreckgespenster.
Da herrschte das Frankenstein-Muster „Monster erhebt sich gegen seinen Schöpfer“ vor. Im 1921 gedrehten italienischen Stummfilm L’uomo meccanico (Der mechanische Mensch) wird ein mechanischer Riese von Gangstern für Überfälle benutzt, um schließlich von einem zweiten Maschinenmenschen zerstört zu werden. In Fritz Langs Metropolis erschafft der Wissenschaftler Rotwang eine mechanische „falsche Maria“, einen verführerischen Roboter. Der Begriff selbst stammt aus der Heimat des Golems – der Figur aus einer mittelalterlichen jüdischen Legende aus Prag – und kommt erstmals in Karel Čapeks Theaterstück R. U. R. – Rossum’s Universal Robots vor. Hier wird die in vielen Science-Fiction-Geschichten beschriebene Angst thematisiert, dass Roboter den Menschen die Arbeit wegnehmen und schließlich nach der Weltherrschaft greifen.
Roboter sind in der Science-Fiction Alleskönner. Sie sind Maschinen – inzwischen auch in der Realität des Jahres 2016 –, die in tiefere Erdschichten vordringen und die Tiefsee erforschen können, auf Planeten und Asteroiden landen und diese untersuchen. Sie sind nicht nur einfache Arbeiter, sondern auch Chirurgen und sogar Kindermädchen. Dass sie als verführerische Gespielinnen von Männern käuflich zu erwerben sind, sei nur am Rande erwähnt. Sie nehmen hoheitliche Aufgaben als unbestechliche Richter wahr. Ganz besonders funktional erscheinen sie als Polizeiroboter, der berühmteste ist R. (steht für Roboter) Daneel Olivaw, der sich in Asimovs Foundation-Zyklus vom brillanten Detektiv zum Hüter der Menschheit entwickelt. Anders die Robocop-Variationen, die in Filmen und Fernsehserien als praktisch unzerstörbare Maschinen agieren. In Szenarien, die auf fernen Sternen und in Weltraumtiefen spielen, ist der Typus „Kampfroboter“ allgegenwärtig. Meist riesig und auf klobigen Stahlbeinen durch die Gegend stampfend zielt er mit seinen in die Arme eingebauten Laserwaffen auf alles, was ihm in den Weg kommt.
Manche Roboter werden im wahrsten Sinne des Wortes als Menschen verkleidet. Sie unterscheiden sich von den oft klobigen, ganz aus sichtbaren Metallteilen bestehenden Maschinenmenschen dadurch, dass sie von einem Gewebe überzogen sind, das an Haut erinnert, und ihr Gesicht menschenähnliche Züge zeigt. In einigen Geschichten werden solche humanoiden Maschinen als Doppelgänger eingesetzt, die in Verschwörungen hochrangige Politiker ersetzen. Im Vergnügungspark Futureworld werden heimlich menschliche Doppelgänger produziert, in Westworld agiert ein von Yul Brunner gespielter Maschinenmensch als Revolverheld und revoltiert gegen seine Schöpfer. Der Kampf der Roboter, die sich unterdrückt fühlen und zugleich als die „besseren Menschen“ sehen, ist ein in der Science-Fiction sehr beliebtes Szenario. In den Filmen über den Battlestar Galactica und in den vier Staffeln der gleichnamigen Fernsehserie kämpfen die letzten Überlebenden der Menschheit gegen Maschinen, die praktisch nicht mehr von Menschen zu unterscheiden sind. Ganz anders Data aus der Star Trek-Serie Raumschiff Enterprise – das nächste Jahrhundert. Er ist wie die Roboter R2-D2 und C-3PO ein Sympathieträger, besonders weil er durch einen „Emotions-Chip“ sogar menschliche Gefühle zeigen kann. Nicht in die Kategorie Roboter fallen die sogenannten Cyborgs, die eine Art verbesserter Menschen sind und deren Körper durch künstliche Bausteine ergänzt wurden, sodass manchmal nur noch das Gehirn übrig geblieben ist.
Weit mehr als mit allen Arten beweglicher Roboter beschäftigt sich die Science-Fiction mit den unbeweglichen Großrechnern oder „Positronengehirnen“, die zur Bedrohung für die Menschheit werden. Manche Autoren beschreiben die schleichende wachsende Abhängigkeit von diesen Computern, die schließlich zu einer Diktatur der Maschinen führt. Als immer größere Bedrohung der Menschheit schildern verschiedene Autoren Computer, die jeden Schritt und jede Meinungsäußerung überwachen können. In den meisten Fällen kontrollieren Menschen und Regierungen diese Programme, es besteht aber die Gefahr, dass sich diese Großrechner von ihren Machern emanzipieren und selbst zu ‚Führern‘ der Menschheit werden. Im Film Colossus tun sich die Supercomputer der UdSSR und der USA zusammen und errichten ihre Diktatur dadurch, dass sie die Waffensysteme und Energienetze der Erde übernehmen. In zahlreichen Filmen wie in dem bereits erwähnten 2001: Odyssee im Weltraum bedrohen intelligente Supercomputer Menschen und die ganze Menschheit.
Aber könnten Roboter nicht auch die Retter der Menschheit sein? In seinem Roman Wing 4 lässt sie Jack Williamson das Sonnensystem besetzen. Es ist eine friedliche Invasion, aber eben eine Invasion. Die humanoiden Roboter, die vom Planeten Wing 4 kommen, sind den Menschen unendlich überlegen. Mit sanfter, aber unwiderstehlicher Gewalt verbieten sie den Menschen alles, was ihnen schaden könnte. Dem Wissenschaftler Clay Forrester untersagen sie seine elektromagnetische Forschung, weil sie zur Waffenentwicklung missbraucht werden kann, und schlagen ihm vor, sich doch mit einer Geisteswissenschaft zu beschäftigen. Außerdem muss er mit dem Rauchen seiner geliebten Zigarren aufhören. Als er sich widerspenstig zeigt, schlagen ihm die Humanoiden eine sanfte Behandlung vor, die alle rebellischen Gedanken abtötet. Forrester denkt gar nicht daran, sondern schließt sich eine Widerstandsgruppe an, mit der er eine Bombe baut, die den Planeten Wing 4 sprengen soll. Das Komplott wird aufgedeckt, Forrester kann fliehen, beginnt aber in der Einsamkeit darüber nachzudenken, ob nicht die Weiterentwicklung des Geistes für die Menschheit wichtiger ist als Technik und Naturwissenschaft. Er begreift, dass die humanoiden Roboter wirklich die Diener der Menschheit sind, was sie immer behauptet haben. Sie haben die Welt von Kriegen, Krankheiten und anderen üblen Machenschaften befreit und die Möglichkeit zu geistiger Weiterentwicklung gegeben. Clay Forrester hat seinen Frieden mit den Invasoren gemacht.
In der vom Zweiten Weltkrieg und Kalten Krieg geprägten Welt des Jahres 1947 fragt Jack Williamson, ob es der Menschheit unter der sanften Diktatur der Roboter nicht besser ginge, ob eine totale Kontrolle – auch wenn sie als Hilfe getarnt ist – nicht humaner ist als das ständige Leben in Angst vor Krieg und Vernichtung. Eine Fragestellung, die von nun an in zahlreichen Science-Fiction-Romanen auftaucht.
In eine ganz andere Richtung geht die Frage, ob und wieweit solche künstlichen Intelligenzen menschliche Gefühle oder ganz andere Emotionen entwickeln können. Dies ist vor allem bei Androiden der Fall, also bei Robotern, die dank biologischer Komponenten äußerlich nicht von Menschen zu unterscheiden sind. In manchen Geschichten verlieben sich Menschen in solche künstlichen Intelligenzen wie in dem Film Ex Machina und manche künstliche Intelligenz verzweifelt an der Frage, ob sie denn Mensch oder Maschine ist. In der Zeitschrift The Independent warnt Stephen Hawking davor, die Entwicklung hochintelligenter Maschinen als Science-Fiction abzutun. Künstliche Intelligenz könne Finanzmärkte oder gar Menschen beeinflussen und selbstständig Waffen herstellen. Diese Technologie sei „entweder das Beste oder das Schlechteste, was der Menschheit jemals passiert“.
Kein Wunder, dass sich bei solchen Perspektiven in den Weiten der Galaxis auch Roboterzivilisationen entwickelt haben. In Fred Saberhagens Berserker-Zyklus ist es ein scheinbar unbesiegbares Roboterheer, das über die Planeten herfällt und alles menschliche Leben auslöscht. In der Perry Rhodan-Serie tauchen die „Posbis“ auf, die die Verbindung von Positronik mit Biokomponenten für das „wahre Leben“ halten und die Menschheit deshalb bekämpfen. Ein erfolgreiches Szenario, das in abgewandelter Form später bei den „Borgs“ im Star Trek-Universum und bei den „Replikatoren“ in der Stargate Atlantis-Serie Anwendung findet. Letztere sind vor langer Zeit als Waffen erschaffen worden und wenden sich nun gegen ihre Schöpfer. Überhaupt sind solche Maschinenzivilisationen nur Überbleibsel – oder aber eine Höherentwicklung – vergangener biologischer Gesellschaften. So lassen einige Autoren ihre Geschichten in einer Zeit spielen, in der die Menschheit ausgestorben ist. Für die verbliebenen Roboter ist die Menschheit nur noch eine Legende, die zur Suche nach dem Ursprung und ihren Schöpfern anregt.
In Roboterfragen hat Isaac Asimov das letzte Wort. In seiner Geschichte Wenn die Sterne verlöschen – im englischen Original treffender The last Question – wird dem größten von Menschen je gebauten Supercomputer die Frage gestellt, ob die Entropie umgekehrt werden und damit das Ende des Universums abgewendet werden kann. Erst im allerletzten Moment, als das Weltall bereits kollabiert, antwortet der Rechner. Er schafft mit den Worten „Es werde Licht“ ein neues Universum …