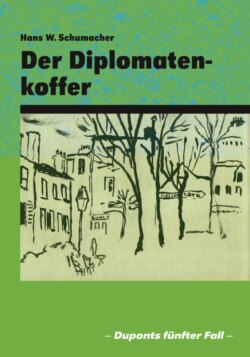Читать книгу Der Diplomatenkoffer - Hans W. Schumacher - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеAuf der morgendlichen Redaktionskonferenz der Tages-Zeitung La Voix du Sud verteilte der Chefredakteur Marius Barre die Aufgaben, u. a. sollte sich einer der Mitarbeiter um die Jahrestagung der europäischen Finanzminister im Palais Réaumur kümmern, bei der der Präsident der Republik die Eröffnungsrede halten würde, ein anderer sollte über die Sicherheitsmaßnahmen für die Konferenz schreiben, die Reporterin Farnèse sollte den französischen Finanzminister interviewen, der Reporter Ménard über einen Prozess vor dem Schwurgericht berichten usw.
Da meldete sich Cellier. Er war Lokalreporter der Zeitung und zuständig für „Vermischtes“ und „Gesellschaft“. So schrieb er etwa über die Feste der Reichen und Schönen, die Filmschauspieler, die Eröffnung neuer Nachtclubs, das Programm von Varietés, die Jahrestagungen der Tauben-, Hunde- oder Pétanque-Vereine, das Jubiläum des provenzalischen Sparkassenverbands, die Renovierung der Stadthalle, die Einweihung des neuen Spielkasinos oder er versuchte, die täglichen Informationen der Polizei über Einbrüche und Verkehrsunfälle in lesbares Französisch zu übertragen.
„Ich würde gern einen Artikel beisteuern und möchte Platz dafür haben.“
„Worüber?“ fragte Barre.
„Das möchte ich noch nicht sagen, es hängt davon ab, ob ich im Archiv etwas finde, was mir noch dafür fehlt.“
„Wie lang soll der Artikel denn werden?“ fragte Makoulian, der Lokalredakteur, „wir hätten noch Platz für einen Dreispalter.“
„Das kommt auf jeden Fall hin“, meinte Cellier.
„Also gut, ich brauche ihn mindestens eine halbe Stunde vor Redaktionsschluss.“
„O.K. Und was ist, wenn ich ihn nicht zustandekriege?“ fragte der Reporter.
„Das ist kein Problem. Dann füllen wir die Lücke mit einer Anzeige.“
Cellier nickte, mischte sich unter die zur Tür drängenden Kollegen, eilte durch den Flur zum Aufzug und fuhr zum dritten Stock, wo die Lokalredaktion residierte.
Barre nahm die Treppe zum ersten, trat in sein Büro ein, setzte sich an seinen Computer und begann ohne zu zögern mit dem Leitartikel für die nächste Ausgabe. „Politik und Moral“, tippte er als Überschrift.
„Moral“, schrieb er weiter, „gleicht der Immunabwehr im Körper. Aber was dort unwillkürlich vor sich geht, wirkt im Geist allein durch bewusste Entscheidungen. Nur die Folgen der Immunschwäche sind wieder vergleichbar: Bei Aids wird der menschliche Körper zerstört, bei einem Moraldefizit der Staatskörper. Anfälligkeit für Korruption, das ist heute das HIV-Syndrom unserer politischen und administrativen Klasse.“
Barre nickte befriedigt und sah an seinem Computer vorbei auf das Redaktionsbüro vor sich, das durch eine Glaswand von seinem Raum geschieden war. Ein Mittelgang, der von der Eingangstür direkt auf diesen zuführte, trennte den langen Saal in zwei Hälften, in denen die Arbeitstische durch Regale getrennt hintereinander rangierten. Gut drei Dutzend Redakteure, Reporter, Volontäre und Hilfskräfte arbeiteten an ihren Schreibgeräten oder standen, über einen Tisch gebeugt, diskutierend beisammen.
Seit den ungeheuerlichen Ereignissen des 11. September 2001 und dem Krieg in Afghanistan hatte sich die Weltpolitik wieder etwas beruhigt, und Barre konnte sich in seinen Kommentaren wieder der Innenpolitik zuwenden, die sein Lieblingsressort war, denn da blühten die Skandale: Doping im Sport, illegale Parteispenden, gekaufte öffentliche Bauaufträge, verschwiegene BSE-Fälle, vergiftete Lebensmittel, was Barre, der gern und gut aß, besonders naheging.
Er löschte den ersten Absatz seines Leitartikels und begann gegen seine Gewohnheit von vorn:
„Machiavelli beurteilte die Menschen und ihre Handlungen nicht danach, wie sie sein sollten, sondern wie sie wirklich sind. Die Fürsten, sagte er, streben in allem, was sie tun, nach Machtgewinn und -erhalt und wenn sie sich moralisch verhalten, d.h. uneigennützig handeln, verlieren sie diese Macht. Da nun ein Fürst den Staat repräsentiert, steht und fällt mit ihm auch das Wohl des Staates. Um es zu fördern, muss also der Fürst verräterisch, wortbrüchig, lügnerisch und heuchlerisch sein, d.h. er muss der Staatsräson folgen, die höher steht als die individuelle Moral. Ja, es kann paradoxerweise sogar unmoralisch sein, sich moralisch zu verhalten, wenn das Wohl einer größeren Zahl von Menschen gegen das eines einzelnen gehalten wird. Muss man einem Geiselnehmer, der vielleicht schon jemand erschossen hat, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, das gegebene Wort halten, ihn mit seinen Opfern entkommen zu lassen? Ist es nicht unchristlicher, ihn nicht zu töten, als es ihm zu erlauben, noch weitere Unschuldige zu ermorden? Würde das Gebot ‚Du sollst nicht töten‘ unbedingt gelten, dann wäre jeder, der sich gegen einen Mörder wehrte, ein Sünder und bald wären die Unmenschen unter sich.
Bedeutet das nun, dass Moral unwirksam ist? Keineswegs. Sie mag aktuell nicht helfen, aber sie besitzt für uns den zwingenden Wert einer Utopie. Es gibt sie nicht, sie muss erst noch werden. Wer uns diese Hoffnung nimmt, muss es büßen.“
Barre lächelte etwas verwirrt über seine Schlussfolgerungen. Manchmal trieben ihn seine Gedanken als praeceptor populi in die seiner Absicht entgegengesetzte Richtung.
„...muss es büßen wie Helmut Kohl, der einst gefeierte Kanzler unseres Nachbarlandes, als bekannt wurde, wie die ominösen Geldköfferchen mit gebündeltem Barem aus den Händen der Großindustriellen in die seiner Schatzmeister wechselten. War die öffentliche Empörung, die die Spendenskandale begleitete und die Christlich-demokratische Partei in das tiefste Loch ihrer Geschichte fallen ließ, nicht pure Heuchelei? Aber wie bei allen wirklichen Dingen muss die Antwort entschieden ‚Jein‘ lauten.“
Barre löschte den letzten grotesken Satz und entwickelte den Gedanken klarer:
„Geht man den Dingen auf den Grund, erscheinen sie immer paradox.
Mochte die Empörung auch heuchlerisch sein - und sie war es bewiesenermaßen, weil die Richter selbst keine reine Weste hatten, wie sich später herausstellte - sie bewirkte immerhin, dass die illegalen Praktiken angeprangert und gesetzlich indiziert wurden. Ob sie dadurch verschwinden werden, ist jedoch die Frage. Wahrscheinlich wird man sie nur besser tarnen.
Natürlich ist nicht alle Moral Heuchelei, denn es gibt gewiss eine Menge guter Menschen unter uns, die die zehn Gebote uneigennützig befolgen, auch wenn es ihnen zum eigenen Schaden gereicht. Ihr Schaden ist der Nutzen, den die anderen, die weniger skrupulös sind, daraus ziehen. Der Moralische, heißt es im Volksmund, ist immer der Dumme. Und nur im Märchen wird der anständige Dummling am Ende belohnt.
Trotzdem kann sich kein Politiker erlauben, die Moral anzutasten. Wer sich früher zu Machiavelli bekannte, war geächtet. Aber vielen ist es gelungen, ihn öffentlich zu verleugnen, seine Maximen aber im Geheimen zu befolgen, allerdings nur so lange ihnen die Öffentlichkeit nicht auf die Schliche kam. Man kann zwar mit dem Predigen von Moral Wahlkämpfe gewinnen, aber mit ihr keine erfolgreiche Politik machen. Deswegen muss der Politiker vor allem ein Heuchler sein. Das elfte Gebot ,Sich nicht erwischen lassen’ ist seine Kardinaltugend. Anmerkung: Mitterands Rat an seine Untergebenen im Falle berechtigter Anschuldigungen lautete: Leugnen, leugnen, leugnen!“
Barre schrieb und löschte, löschte und schrieb – zwischendurch beantwortete er Telefonanrufe oder ging mal dahin, wohin auch der Kaiser zu Fuß geht. Als er so in sich gekehrt dem stillen Örtchen zustrebte, folgten ihm die teils mitleidigen, teils belustigten Blicke seiner Redaktionsgenossen. Vor fünfundzwanzig Minuten würden sie ihn nicht wieder sehen. Barres Dauersitzungen waren bekannt. Tatsächlich aber erschien er wieder nach einer Viertelstunde mit zugleich gequälter wie befreiter Miene, setzte sich in sein gläsernes Séparé und bearbeitete weiter seinen PC.
Aber er schien mit seinem Artikel nicht fertig zu werden. Das war für seine Mitarbeiter recht ungewohnt und verwirrend. Als die Zeit zum Mittagessen heranrückte, schrieb er den Schlusssatz, ohne sich um dessen gedanklichen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden zu kümmern - denn er sah schon Jason Thíerry, den Herausgeber der Zeitung, nahen, mit dem er gewöhnlich zu speisen pflegte:
„Nicht nur der Politiker ist ein Heuchler, sondern selbstverständlich auch sein Wähler: Er verlangt gerade das von ihm, was guter Politik im Wege steht, nämlich Glaubwürdigkeit. Das heißt Übermenschliches von ihm fordern: Der Politiker muss auch noch Glaubwürdigkeit heucheln können.“
Thierry, der neben ihn gelangt war und über seine Schulter spähte, rief: „Bravo, mein Bester, ich sehe, Sie haben die Katze wieder einmal aus dem Sack gelassen. Darf ich noch den Anfang sehen?“ Barre ließ den Text gehorsam vor den Augen Thierrys über den Bildschirm laufen und weidete sich am amüsierten Mienenspiel seines Lesers.
„Und was lernen wir daraus?“ fragte dieser im Stil eines Oberlehrers.
„Nichts“, bekannte Barre zerknirscht.
„Und das soll auf der ersten Seite stehen? Dann können wir sie ebenso gut leer lassen und sparen die Druckerschwärze.“
„Es gibt einen Unterschied zwischen Nichts und absolut Nichts, ist Ihnen das schon einmal aufgefallen?“ erwiderte Barre, packte Thierry bei der Schulter und schob ihn grinsend zum Ausgang.
Unterwegs zum Restaurant „Mille Ecus“, das in der Ecke der Place Giraud schräg gegenüber dem Verlagshaus lag, schlossen sich ihnen noch Hubert Brice, der Wirtschaftsredakteur und der Finanzmarktredakteur Jean-Pierre Sagan, der Schwiegersohn des Zeitungsbesitzers, an. Sie nahmen an dem für sie reservierten Tisch unter dem Vorbau Platz. Barre nickte Makoulian zu, der am Nebentisch mit seiner Frau Lisette und ihrem Mitarbeiter Strelitzer speiste. Die beiden letzteren waren für das Archiv verantwortlich.
Im hellen Licht der Aprilsonne lag der Zeitungspalast vor Barres Augen. Das Gebäude war vor zehn Jahren renoviert und aufgestockt worden, um dem wachsenden Platzbedarf Genüge zu tun, der mit der zunehmenden Bedeutung des Blattes einherging. Diese war hauptsächlich Barres Verdienst. Er hatte in den fünfundzwanzig Jahren, in denen er an der Zeitung arbeitete, dafür gesorgt, dass aus einem Provinzblatt ein Organ wurde, das in einem Atemzug mit Le Monde und Figaro genannt wurde. Dementsprechend wurde er auch von den Mächtigen hofiert oder angefeindet. Sein Wahlspruch war: Victrix causa diis placuit sed victa Catoni. (Die siegreiche Sache gefällt den Göttern, aber die besiegte dem Cato.)
Seine Sympathie galt den Unterlegenen und den Opfern der Zeitgeschichte, aber er wusste auch, dass die Niederlage häufig nicht demütig und resigniert, sondern rachsüchtig macht und dass Unterdrückte, wenn sie ans Ruder kamen, schlimmer sein konnten, als diejenigen, von denen sie einmal geplagt worden waren. Solche Ansichten brachten ihm Schelte von beiden Seiten ein: die Linken sahen in ihm einen Konservativen, die Rechten einen Anarchisten. Das kümmerte ihn wenig, solange die Auflage stieg oder zumindest nicht zurückging.
Dank der Konferenz, die nicht weit davon stattfand, wurde der sonst so stille Ort von ungewohntem Lärm in Mitleidenschaft gezogen. Hupend brausten schwarze Limousinen, eskortiert von donnernden Motorrädern, vorüber, obwohl der Platz in der Fußgängerzone lag oder eine Gruppe von Demonstranten zog geräuschvoll, Fahnen und Transparente schwenkend, in Richtung Place de Gaulle, wo die Tagungsstätte lag.
Barre schien zu frösteln, obwohl die Infrarotheizung eingeschaltet war, war da eine Grippe im Anzug? Thierry bemerkte seine Einsilbigkeit und versuchte, ihn mit alten Witzen aufzuheitern, aber Barre hatte nur ein müdes Lächeln dafür übrig. Da er immer so viel um die Ohren hatte, musste er einen Notizkalender von der Größe eines Lexikons mit sich führen. Während ihm der Kellner sein Bier servierte, zog er das Buch aus der Brusttasche, kontrollierte die Eintragungen, aber nichts lag vor. Plötzlich juckte es ihm am rechten Handballen, er kratzte sich mit der Linken heimlich unter der Tischkante, aber der Reiz nahm zu, dann juckte es hinter dem rechten Ohr, eine Hitze flog über die Gesichtshaut und auf dem Handrücken breiteten sich rote und weiße Quaddeln aus.
„Das ist eine Sonnenallergie“, meinte Sagan, der interessiert seinem Kampf zusah.
„Und was macht man dagegen?“ fragte Barre.
„Calcium“, sagte Miranda Farnèse, die Reporterin, die eben ihren gewohnten Platz zwischen Barre und Sagan einnehmen wollte. „Ich hole Ihnen etwas aus der Apotheke.“
Barre krempelte den Ärmel auf, um zu sehen, wie sein Unterarm rot anlief.
„Nicht kratzen“, riet der Herausgeber, „dann wird es nur noch schlimmer.“ Er bestellte beim Kellner vorsorglich eine Flasche Selters.
Miranda eilte mit einem kleinen Karton herbei, wehrte Barres Bemühungen ab, den Preis dafür zu erfahren, öffnete eines der Cachets und ließ es in das Glas mit Thermalwasser fallen.
„Schlucken“, rief sie und hielt wie eine Krankenschwester das sprudelnde Getränk an Barres Lippen. Der schlürfte gehorsam und fühlte verwundert, wie Hitze und Juckreiz allmählich nachließen. Nach fünf Minuten hielt er Miranda einen weißen Arm entgegen:
„Hohepriesterin, du kannst mich für geheilt erklären.“
Er wollte ihr die Schachtel zurückgeben. Sie fand das verfrüht, man könne nicht wissen, ob er das Mittel nicht noch einmal brauchen würde.
Da nichts interessanter ist, als über die eigenen Krankheiten zu reden, drehte sich das anschließende Gespräch nur noch um Allergien: auf Pollen, auf Milch, Erdbeeren, Krebsfleisch, Penicillin, Beizen, Farben.
Thierry erzählte, wie er einmal von einem Kontrastmittel, das ihm vor dem Röntgen seiner Nieren gespritzt worden war, beinahe „hops gegangen“ wäre, wie er sich ausdrückte.
„Mir war, als ob wenn mein Kopf platzte, der Puls schlug gegen die Schläfen wie ein Vorschlaghammer, ich erstickte beinahe, hörte schon die Engel im Himmel kreischen...“
„Dann waren es wohl eher die Teufel, die sich auf dich freuten“, meinte Barre. Thierry schüttelte in sich gekehrt das graue Haupt, als sei ihm nicht zum Scherzen zumute.
„Und, wie haben Sie es überlebt?“ fragte Miranda Farnèse gespannt.
„Man gab mir ein Gegenmittel. Da war es vorbei. Aber den Schrecken vergess‘ ich nie.“
Sagan hatte hastig gegessen, weil er einen wichtigen Termin hatte, wie er sagte, stand auf und verabschiedete sich von allen so, wie er sie begrüßt hatte, per Handschlag und mit angedeutetem Diener.
Barre, der ihn eigentlich nicht recht leiden mochte - er musste ihn einstellen, weil es der alte Bétancourt verlangte - fand aber seine altmodischen Manieren sympathisch. Der weiß doch wenigstens noch, was sich gehört, dachte er. Sagans Artikel fand er solide und langweilig, soweit er den Inhalt überhaupt verstand, allzu tief war er in die Geheimnisse des Kredit- und Börsenwesens nicht eingedrungen. Bedenklich erschienen ihm Sagans immer öfter vorgebrachten Tiraden gegen „die in Brüssel“, die Hinneigung zum Protektionismus Chévènements, sogar Le Pen bekam zuweilen gute Noten ab. Stellte Barre den Finanzredakteur zur Rede, konnte es sein, dass dieser ihm höflich, aber eiskalt antwortete und durch die Blume zu verstehen gab, dass der Chef von Finanzpolitik wenig Ahnung habe. Er hielt sich für unangreifbar, weil er der Rückendeckung seines Schwiegervaters sicher war. Da Barre das selbst wusste, musste er zurückweichen, aber es war verständlich, warum er ihm nicht recht grün war.
Mit Arthur Bétancourt dagegen hatte er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten arrangieren können, was die politische Ausrichtung des Blattes betraf, denn die Achtung des Kapitalisten für ihn stieg mit dem wachsenden Gewinn der Zeitung. Und Geld besänftigt auch ideologische Bedenken.
Der Unternehmer residierte in einer prachtvollen Villa auf einer ins Meer vorgeschobenen Klippe östlich von Nizza. Er war dreiundachtzig Jahre alt und hatte schon lange keinen Fuß außerhalb seines Grundstücks gesetzt. Barre, der mit ihm ausschließlich telefonisch verkehrte, wusste wenig über seinen eigentlichen Gesundheitszustand. Mal wurde kund, Arthur werde das Jahresende wohl nicht mehr erleben, dann wieder trompetete man, er würde bestimmt hundert, so gut sehe er aus.
Miranda betrachtete ihren Chef während des Essens von der Seite und fragte sich, warum er so geistesabwesend vor sich hingrübelte. Die Aufklärung erfolgte prompt. Barre schlug sich die Hand vor die Stirn und murmelte: „Ich wusste doch, dass ich etwas vergessen hatte,“ wandte sich zu Makoulian am Nebentisch um und rief hinüber: „Was ist denn nun mit dem Artikel von Cellier?“
Der Lokalredakteur teilte mit, der Reporter habe bis etwa halb elf im Büro gesessen und sei dann ins Archiv gegangen, seitdem habe er ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Lisette bestätigte das: Cellier habe, bis sie um Viertel vor zwölf ihren Arbeitsplatz verlassen habe, in der hintersten Ecke gesessen und alte Zeitungen durchstöbert.
„Was hat er denn gesucht?“ fragte Brice.
„Ich weiß nicht. Ich bot ihm meine Hilfe an, aber er meinte, er käme allein zurecht.“
Makoulian wunderte sich, warum Barre der Lokalreporter so intrigierte. Und Miranda, die den Chefredakteur beobachtete, fand ihn auch seltsam erregt. Um ihn zu beruhigen, sagte sie: „Chef, es sind doch noch drei Stunden bis Redaktionsschluß. Cellier wird das schon schaffen.“
Miranda Farnèse begriff gut, dass Barre neugierig war. Es war sein Beruf, neugierig zu sein, und seine Leidenschaft bestand darin, früher als alle anderen zu wissen, was am Kochen war. Sie glaubte, dass diese Neugier eine Art überzüchteter Sicherheitsinstinkt war, der ihn wie ein Eichelhäher im Walde Alarm geben ließ, sobald auch nur die geringste Gefahr zu wittern war. Als seine Schülerin hatte sie diese Eigenschaft geerbt und war ihr zum Instinkt geworden.
„Ich kann doch hinüberlaufen und ihn fragen“, regte sie an und stand auf.
Barre drückte sie auf ihren Stuhl nieder: „Lass’ mal, Mira! Ist doch nicht so wichtig. Wenn es schon jemand macht, dann kann das auch ein Mann tun.“ Er schaute sich um, aber keiner der Herren in der Runde schien gewillt, sein Essen kalt werden zu lassen.
„Alles echte Gentlemen hier“, seufzte der alte Mann verbittert.
Ehe er noch weiteren Protest anmelden konnte, ließ die Reporterin ihr Essen stehen, nahm den Archivschlüssel aus ihrer an der Stuhllehne hängenden Handtasche, und während Barre aufstand und ihr hilflos nachschaute, eilte sie über den belebten Platz auf das Portal zu, nickte dem Pförtner zu, durchquerte den breiten, für Autos befahrbaren Zugang zum Hof, betrat das rechte Treppenhaus und fuhr mit dem Aufzug zum dritten Stock hinauf.
Lisette Makoulian, die Leiterin des Zeitungsarchivs, hatte wie immer, wenn sie mit ihrer Hilfskraft essen ging, die Tür des Archivs abgesperrt, aber jedes Redaktionsmitglied besaß einen Schlüssel dafür, damit man auch bei ihrer Abwesenheit von ihren Schätzen Gebrauch machen konnte. Miranda schloss auf, betrat den Vorraum mit den Sicherheitsboxen, in denen Archivbenutzer ihre Habseligkeiten einschließen konnten, mit den Schreibtischen der Verwalter, auf denen Computer, Kopiergeräte und Drucker angeordnet waren. Unter dem Fenster zum Hof standen neben den Katalogkästen ein Katzenklo, ein Schälchen mit Futter und eins mit Milch. Lisette pflegte mit Erlaubnis der Redaktion ihren Kater Leopold tagsüber mitzubringen. Er war bei allen Journalisten beliebt, legte sich gern in seiner ganzen schwarzen Länge vor ihnen über ihre Papiere und schnurrte so hingebungsvoll, dass man nicht umhin konnte, ihm, während man las oder schrieb, die verlangten Streicheleinheiten zu verabfolgen.
Als Miranda sich der geschlossenen Tür zum eigentlichen Archivraum näherte, hörte sie dahinter Leopold mauzen.
„Ach, du Armer“, rief sie, öffnete die Tür und nahm den sich durch den Spalt drängenden Kater auf den Arm, „hat man dich ausgesperrt, du wirst wohl Hunger haben.“ Sie trug ihn zu den Näpfen und ließ ihn auf den Boden fallen, aber Leopold fraß nicht, sondern schmiegte sich mauzend an Mirandas Beine, schaute zur ihr auf und lief dann mit aufgestelltem Schwanz vor ihr her in den von goldenen Lichtspeeren durchschossenen Archivraum.
„Herr Cellier“, rief Miranda in die Stille hinein, „sind Sie hier?“ Die Katze miaute in der Ferne. Miranda folgte ihr zögernd, sah um jede Ecke nach den Arbeitsplätzen hinter den vorgeschobenen, mit Zeitungskonvoluten vollgestellten Regalen und erkannte Cellier am hintersten Tischchen. Er war wohl müde geworden und lag mit dem Kopf auf den Armen über den Tisch gelehnt. Leopold strich leise schnurrend um seine Beine herum.
„Herr Cellier“, sagte Miranda leise, um ihn nicht aufzuschrecken, trat an ihn heran und sah es: Erstarrtes Blut auf den Haaren am Hinterkopf. Aus einem kleinen Loch, wo ihn eine Kugel getroffen hatte, schien es noch leise zu sickern und die Lache auf dem Tisch zu vergrößern.
Die Reporterin hatte schon öfters Leichen gesehen, aber dies war die erste, auf die sie selbst gestoßen war. Das gab der Sache ein anderes Gesicht. Sie wusste von Berufs wegen, wie heikel es war, Leichen zu entdecken. Der Entdecker war aus unerfindlichen Gründen für die Polizei auch immer der erste Verdächtige. Sie ließ sich auf den danebenstehenden Stuhl sinken, um ihres Zitterns Herr zu werden. Die Gedanken rasten.
Der ungeheuerlichste Verdacht meldete sich als erster: Hatte Barre sie laufen lassen, damit sie den Toten fand? Das fuhr wie ein Irrsinnsblitz aus ihrem Unbewussten und sofort tadelte sie sich dafür. Er sollte ein Mörder sein und sie hineinziehen wollen? Niemals! Was für Gründe sollte er dafür haben, eine so unwichtige Person wie Cellier zu beseitigen? Und waren sie und Barre nicht immer ein Herz und eine Seele gewesen?
Ihr Herz schlug wie ein Preßlufthammer in ihrer Brust und ihre Schläfen klopften. Dann überlegte sie, was zu tun sei. Schließlich war sie Reporterin. Sie hatte ihre Handtasche, in der sie immer ihr Handy mit Fotoapparat mit sich führte, nicht bei sich. Sie hing noch über der Stuhllehne im Restaurant. Also prägte sie sich die Lage des Körpers genau ein, bevor sie vorsichtig, um nicht mit dem Blut in Berührung zu kommen, unter dem vornüber gebeugten Körper in Celliers Jackentaschen griff. Sie fand seine Brieftasche, zog sie hervor und durchsuchte sie, aber darin waren nur seine Ausweis- und Wagenpapiere. Nachdem sie ihre Fingerabdrücke abgewischt hatte, schob sie sie in die Innentasche zurück. Kaum hatte sie das getan, schlug sie sich vor die Stirn. Trotz ihrer Erfahrung mit Kriminalangelegenheiten hatte sie einen Riesenfehler gemacht. Sie hatte eventuelle Fingerabdrücke des Täters und/oder seiner Komplizen getilgt. Das war nun nicht mehr zu ändern, und sie beruhigte sich mit dem Gedanken, dass der Mörder wahrscheinlich auch keine hinterlassen hatte, wenn er kein Idiot war.
Nichts sonst war da, keine Schlüssel, keine Aufzeichnungen, auch kein Merkbuch. Sie wusste, dass der Reporter einen Notizkalender besessen hatte, wie alle Journalisten im Hause. Auch die Hosentaschen waren leer.
Seltsam war: auf dem Tisch lag keine Zeitung. Cellier hatte doch alte Nummern konsultieren wollen. War er, gerade als er den Band zurückgestellt hatte, umgebracht worden, oder hatte sein Mörder ihn zurückgestellt, damit nicht herauskam, wonach Cellier gesucht hatte?
War Cellier exekutiert worden, als er in dieser Haltung eingeschlummert war oder war er vornübergefallen, als man ihn von hinten erschossen hatte? Hatte er seinen Mörder gekannt, vielleicht mit ihm gesprochen? War es einer oder waren es mehrere gewesen?
Sie fuhr auf und sah auf ihre Armbanduhr: Sie war schon so lange fort, was sollte sie nur tun? Sofort die Polizei verständigen oder zuerst Barre benachrichtigen? Sie fand, dass es besser war, ihn auf seinem Mobiltelefon anzurufen und ihm das Weitere zu überlassen.
Sie lief zum Vorraum, nahm das Telefon ab und wählte seine Nummer.
„Chef“, sagte sie, „erschrecken Sie nicht und lassen Sie sich nichts anmerken.“
„Gut, ich erschrecke nicht, also, was gibt‘s?“
„Cellier ist tot.“
„Wie bitte?“
„Er ist erschossen worden an seinem Tisch im Archiv. Das Beste wäre, Sie kämen her, sähen sich das an und entschieden, was zu tun ist.“
„Auf keinen Fall. Das wäre nicht gut. Haben Sie ihn gefunden?“
„Ja.“
„Sind Sie allein?“
„Ja.“
„Dann müssen Sie die Polizei anrufen. Bleiben Sie da, bis sie eingetroffen ist. Und nichts anrühren! Wir kommen hinüber und treffen uns vor der Tür.“
„Was ist los?“ hörte die Reporterin den Herausgeber sprechen, Barre antwortete und ein wildes Stimmengewirr tönte im Hörer. Miranda drückte die Hand auf die Gabel, ließ sie wieder los und wählte die Nummer der Polizei. Nachdem sie von dem Beamten, der das Gespräch entgegennahm, ihre Anweisungen bekommen hatte, trat sie auf den Flur hinaus. Kurz darauf öffnete sich die Fahrstuhltür, ihre Kollegen stürzten heraus und drängten sich um sie.