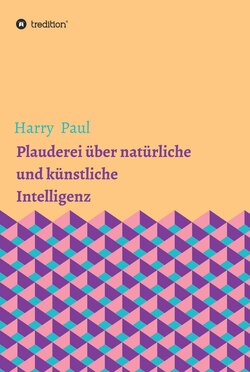Читать книгу Plauderei über natürliche und künstliche Intelligenz - Harry Paul - Страница 10
ОглавлениеSprache
Zu den großartigsten Intelligenzleistungen der Menschen gehört zweifellos die Sprache. Entscheidend ist, dass die einzelnen Wörter eine Bedeutung, einen Sinn haben. Das macht die Sprache zu einem einzigartigen Kommunikationsinstrument. Und wie groß ist das Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten! Es reicht von Grobheiten bis zu zartesten Andeutungen. Tatsächlich genügt oft schon ein einziges Wort, um, Neudeutsch gesprochen, “die Message ’rüberzubringen. “ Hierzu ein Beispiel aus der frühen Entwicklungsphase meiner beiden Enkel! (Es handelt sich übrigens um Zwillinge.) Vorausschicken muss ich, dass sie bereits schlimme Erfahrungen mit Ärzten gemacht hatten. Das waren doch Menschen, die ihnen Schmerzen zugefügt hatten, indem sie ihnen Spritzen in den Po gejagt hatten! Nun ereignete sich folgendes. Die beiden wurden von ihren Eltern in ein ihnen vollkommen unbekanntes Krankenhaus gebracht. Dort sollte nur eine harmlose Untersuchung statthnden, was die beiden aber nicht wussten. Als sie die Tür des Krankenhauses erreicht hatten, erkannte der eine sofort, um was für eine Institution es sich handelte, und er rief nur das eine Wort “Doktor! “ Anschließend fingen beide an, so laut zu schreien, dass die Schwestern angerannt kamen und alles taten, um die beiden schnellstens loszuwerden.
Auf dem erwähnten primitiven Niveau “äußern“ sich übrigens schon Tiere. Denken wir nur an Hunde! Die verfügen ja über eine ganze Skala von Ausdrucksmöglichkeiten, die bekanntlich von drohendem Gebell bis zu leisem Winseln reicht. Da stehen natürlich unsere tierischen Verwandten nicht zurück. Oft sind es spezifische Warnungen, die sie den Mitgliedern ihrer Gruppe übermitteln wollen. Beispielsweise unterscheiden grüne Meerkatzen bei ihren Warnrufen zwischen verschiedenartigen Angreifern, nämlich Bodentieren (Leoparden), Raubvögeln (Adlern) und Kriechtieren (Schlangen).
Offensichtlich haben kleine Kinder keinerlei Schwierigkeiten damit, in den Worten einen Sinn zu erkennen. Manches werden sie einfach erraten, aber vieles kann man ihnen durch bloßes “Aufzeigen“ beibringen. So zeigt der Papa beispielsweise mit dem Finger auf ein Auto und sagt “Auto“. Ich finde es faszinierend, dass es gar kein reales Auto zu sein braucht, eine Darstellung in einem Bilderbuch reicht völlig aus! Unser optisches Wahrnehmungssystem ist offenbar in wunderbarer Weise darauf vorbereitet, Muster zu erkennen.
Umso erstaunlicher ist es, dass es tatsächlich gelang, einem infolge einer Krankheit im Alter von neunzehn Monaten blind und taubstumm gewordenen Mädchen die englische Sprache beizubringen. Dabei war die Erkenntnis, dass die Wörter eine Bedeutung haben, ein überwältigendes Glückserlebnis für das Kind. Ich spreche von Helen Keller, die das große Glück hatte, in ihrer Erzieherin Anne Sullivan eine äußerst begabte und zugleich liebevolle Lehrerin zu finden. Diese vollbrachte ein wahres Wunder: Sie ermöglichte Helen nicht nur die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, sondern erschloss ihr auch den Zugang zur geistigen Welt. (Helen promovierte im Jahre 1904 am Radcliffe-College.) Annes Erfolgsgeheimnis war die Benutzung des Fingeralphabets. Sie konnte so mit ihrem Schützling in normaler Sprache kommunizieren, indem sie ihm zuerst einzelne Wörter und später ganze Sätze auf die Handfläche buchstabierte. Anne Sullivan berichtet von dem Tage, als Helen schlagartig begriff, dass mit dem Wort “water“ allein das Wasser gemeint war und nicht gleichzeitig die damit zusammenhängende Tätigkeit des Waschens. Bis dahin hatte sie nämlich generell keine Trennung von Objekt und zugehöriger Tätigkeit vorgenommen; so bedeutete beispielsweise “doll “ für sie nicht nur ihre Puppe sondern auch das Spielen mit ihr. Anne Sullivan schreibt in einem Brief (wiedergegeben in dem Buch: Helen Keller, Geschichte meines Lebens, Alfred Scherz Verlag Bern):
“Wir gingen zur Pumpe, wo ich Helen ihren Becher unter die Öffnung halten ließ, während ich pumpte. Als das kalte Wasser hervorschoss und den Becher füllte, buchstabierte ich ihr w-a-t-e-r in die freie Hand. Das Wort, das so unmittelbar auf die Empfindung des kalten, über ihre Hand strömenden Wassers folgte, schien sie stutzig zu machen. Sie ließ den Becher fallen und stand wie angewurzelt da. Ein ganz neuer Lichtschein verklärte ihre Züge. Sie buchstabierte das Wort water verschiedene Male. Dann kauerte sie nieder, berührte die Erde und fragte nach deren Namen, ebenso deutete sie auf die Pumpe und auf das Gitter…. Auf dem ganzen Rückweg war sie im höchsten Grad aufgeregt und erkundigte sich nach dem Namen jedes Gegenstandes, den sie berührte, so daß sie im Laufe weniger Stunden dreißig neue Wörter ihrem Wortschatz einverleibt hatte.“ Und vom folgenden Tag berichtet die Erzieherin: “Helen stand heute früh wie eine strahlende Fee auf, sie flog von einem Gegenstand zum anderen, fragte nach der Bezeichnung jedes Dinges und küßte mich vor lauter Freude. Als ich gestern abend zu Bett ging, warf sich Helen aus eigenem Antrieb in meine Arme und küßte mich zum erstenmal, und ich glaubte, mein Herz müsse springen, so voll war es von Freude. “
Welch große Bedeutung die Menschen früher schon der Benennung von Objekten beimaßen, kann man aus der biblischen Schöpfungsgeschichte ersehen. In diesem Punkte lässt Gott dem Menschen freie Hand, wie im Ersten Buch Mose berichtet wird: “Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Getier auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen.“
So schön das alles klingt, hat die Sache doch einen Haken, nämlich die Mehrdeutigkeit von Wörtern. Beispielsweise hat das Wort “Schloss“ drei verschiedene Bedeutungen: a) herrschaftliches Schloss, b) Türschloss und c) Flintenschloss. Das ist es, was dem menschlichen Übersetzer das Leben nicht gerade leicht macht, und den mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Übersetzer häufig scheitern lässt. Er müsste ja verstehen, wovon er spricht, aber er hat keine Ahnung.
Mich beeindruckt auch ungemein, wie souverän die Sprache mit der Zeit umgeht. Dabei wissen nicht einmal die Physiker, was die Zeit eigentlich ist. (Sie begnügen sich damit, sie mit immer größerer Präzision zu messen.) Aber wir haben ja, übrigens wie die Tiere und Pflanzen, ein Zeitgefühl, und darauf kommt es uns in erster Linie an. Die Sprache teilt einfach den zeitlichen Verlauf von Vorgängen in säuberlich getrennte Abschnitte ein. So gibt es, wie man uns in der Schule beigebracht hat, gleich drei verschiedene Vergangenheitsformen (Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt), nur eine Gegenwartsform (Präsens), was logisch erscheint (den Engländern genügt das aber nicht, sie haben zwei), aber gleich wieder zwei Zukunftsformen (Futur und Futur exakt). Ich finde es allerdings erstaunlich, wie genau man über künftige Ereignisse sprechen kann, von denen man überhaupt nicht wissen kann, ob sie jemals eintreten (vom Tod einmal abgesehen). Verblüffend finde ich auch, wie anscheinend mühelos schon kleine Kinder sprachlich zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden. So sagte einer der bereits erwähnten Zwillinge einmal “Opa kleckert hat.“
Die Sprache wird jedoch im ständigen Gebrauch immer mehr abgeschliffen, im besonderen wird das Futur immer seltener benutzt. So sagt man beispielsweise nicht mehr “gleich morgen werde ich mit einer Diät beginnen“ sondern im Tone der Zuversicht “gleich morgen beginne ich mit einer Diät“, obwohl es sich doch nur um eine Absichtserklärung handelt. Und das Futur exakt (Beispiel: Morgen um diese Zeit wird mir der mich tyrannisierende Zahn schon gezogen worden sein) ist immer mehr aus der Mode gekommen, was angesichts seiner umständlichen Konstruktion nicht verwunderlich ist. Es sind solche Auswüchse der deutschen Sprache, die dem lernwilligen Ausländer das Leben schwer machen, wovon im besonderen Mark Twain (in seiner Ausführung über die “schreckliche deutsche Sprache“) ein Lied zu singen weiß. – Übrigens haben clevere Zeitgenossen herausgefunden, dass bereits naive Bildchen ausreichen, um ihre Gefühle auszudrücken, und die Emojis erfunden.
Tatsächlich hat, wie wir alle wissen, die Sprache vielfältige Funktionen. Die ursprüngliche dürfte die Feststellung von Tatsachen sein. (Beispiel: Gestern wurde mir ein Sohn geboren. Ich gab ihm den Namen Timotheus.) Doch dann war das Bedürfnis, unterhalten zu werden, offenbar so groß, dass begabte “Autoren“ ihre Phantasie spielen ließen und spannende Geschichten erfanden. Großer Beliebtheit erfreuten sich von jeher auch Legenden, von denen niemand wusste, wer sie eigentlich in die Welt gesetzt hatte. Mit anderen Worten, die Unterhaltungsliteratur war geboren. Und natürlich lebt eine jede Religion von Legenden.
Es gab aber auch ausgesprochen praktische Bedürfnisse. So wurden Gesetze und Vorschriften (die zwölf Gebote nicht zu vergessen!) formuliert, wobei das berechtigte Interesse der Juristen an Klarheit und Eindeutigkeit der Aussagen die (von ihnen verwendete) Sprache ihrer Lebendigkeit beraubte. Aber gerade diese Nüchternheit und Sachlichkeit ist das, was die Wissenschaft braucht. Man findet sie heute in jeder wissenschaftlichen Abhandlung. (Lediglich gute Dozenten und Redner wissen, welche Bedeutung klug eingestreute Witze für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer haben.) Schließlich sollten wir die Poesie nicht vergessen, in der häufig die bezaubernde Schönheit der Sprache (verstärkt noch durch den Reim) aufscheint. Mir fällt dazu gerade ein schönes Beispiel ein, der Anfang des Goetheschen Gedichtes ‘An den Mond‘: “Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz … “
Bei all ihrer Schönheit und der Präzision des Ausdrucks, die sie erlaubt, scheint mir die Sprache doch manchmal über das Ziel hinauszuschießen. Ich denke dabei im Deutschen an das grammatikalische Geschlecht der Hauptwörter, das oft im Gegensatz zum natürlichen Geschlecht steht. Kein Mensch vermag, so glaube ich, einzusehen, weshalb es beispielsweise der Himmel, die Hölle und das Weib heißt. Es genügt einfach nicht, die Bedeutung des Wortes ‘Himmel‘ zu kennen, man muss auch wissen, dass es männlich dekliniert wird. (So lernt man es von Muttern oder spätestens in der Schule; gefragt wird nicht.) Das bringt naturgemäß alle zur Verzweiflung, die Deutsch als Fremdsprache lernen wollen. Ein Ungar kam sogar zu folgender Feststellung: Deutsche Sprack - schwere Sprack; hot sich ein Wort gleich drei Artikel: Das - die - der Teifel hol!
Übrigens staune ich darüber, in welch frühem Alter kleine Kinder schon allgemeinere Zusammenhänge nicht nur erkennen, sondern auch ausdrücken können. So überraschten mich meine Enkel, als sie bei konkreten Anlässen erklärten: “Das dürfen nur ’wachsne.“ Sehr beeindruckend finde ich übrigens, wie schnell die Kleinen den Gebrauch des Wortes ‘meins‘ lernen. Und dann sagen sie eines Tages ganz unvermittelt ‘ich‘. Damit eröffnet sich ihnen auch die Möglichkeit, ihren Willen unmissverständlich und leidenschaftlich kundzutun, indem sie schreien: “Ich will das nicht!!! “ (Außerdem haben sie schnell herausgefunden, dass sich die Wirkung des gesprochenen Wortes noch dadurch steigern lässt, dass man sich auf den Boden wirft.)
Noch eine letzte Bemerkung! Wenn wir die Sprache als eine geniale menschliche Schöpfung würdigen, müssen wir in gleichem Atemzug die Erfindung der Schrift preisen. Erst mit ihrer Hilfe gelingt es ja, unsere Erfahrungen und das angesammelte Wissen zu verbreiten und überdies über lange Zeiten zu konservieren.