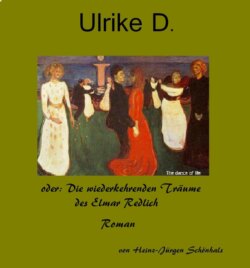Читать книгу Ulrike D. - Heinz-Jürgen Schönhals - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Runenweiher
Оглавление„Steinfirstsee“ – der Name ließ sich nicht so gut aussprechen; besser schon geht einem das Wort ‚Runenweiher’ über die Lippen; so heißt der See nämlich im Volksmund. Richtiger müsste er ‚Rundhofweiher’ heißen, denn angeblich stand vor undenklich langer Zeit an seiner Stelle - so berichtet es eine alte Sage - eine kleine Stadt mit Namen Rundhof. Auch ‚Rundhofweiher’ war nicht gut auszusprechen, und so hatte man daraus bald einen ‚Runenweiher’ gemacht; vielleicht auch deshalb, weil so viele Sagen über den Steinfirstsee und die geheimnisvolle Stadt „geraunt“ wurden, uralte Sagen voller dunkler Begebenheiten. Viele Male - erinnerte sich Elmar - wurden sie ihnen als Kinder dargeboten, sei es von seiner Großmutter oder von ihrem Dorfschullehrer, die beide spannend erzählen konnten, und ihre Kinderherzen gerieten dann immer in furchtbare Aufregung.
Eine dieser Sagen, die Elmar niemals vergessen wird, weil sie ihm damals einen gewaltigen Schrecken eingejagt, handelte von den reichen Leuten von Rundhof, ihrem frevelhaften Ehrgeiz, ihrem Hochmut, ihrem lasterhaften Leben. Selbstsucht, Hartherzigkeit und protzende Angeberei hätten sie mit zügellosem, die niedrigsten Sinne aufreizenden Genussleben verbunden. Keine Ausschweifung, keine Verdorbenheit sei ihnen fremd gewesen, sprach Elmars Großmutter einst mit schauerlich verfremdeter Stimme; keine Schlechtigkeit bis hin zum Verbrechen, zum Mord blieb bei ihnen ausgespart, und als das Maß ihrer Sünden endlich voll war, als selbst der Himmel, an viele Schandtaten der Menschheit durch die Jahrtausende hindurch gewöhnt, nicht mehr gleichmütig zuschauen konnte, schickte er seine Strafengel herab, die ein furchtbares Strafgericht über die Rundhofer abhielten, in Gestalt eines gewaltigen Erdbebens, durch das die Stadt Rundhof samt ihren Einwohnern auf immer ausgetilgt wurde. Alle ihre Häuser stürzten in einen gigantischen Krater, der sich während des Bebens öffnete, und verschwanden in seiner unermesslichen Tiefe, ohne eine Spur zu hinterlassen. Mit Schaudern dachte Elmar noch daran, wie seine Großmutter das Aufbrechen des Kraters mit einem fürchterlichen Gähnen verglich, zu welchem die Erde angesetzt; ungeheuer weit habe sie ihren Schlund aufsperrt und ihn anschließend nicht mehr zubekommen, weil ein Krampf in der Muskulatur des Schlundes zu einer Art ewiger Maulsperre führte, und aus dem Abgrund des Riesenloches sei allmählich, durch Sickerwasser und Zuflüsse kleiner Bäche Jahrhunderte lang gespeist, der klare Spiegel eines Sees emporgestiegen und hätte das Kraterbecken bald vollständig ausgefüllt. So also sei der Runenweiher entstanden. Staunend hatte Elmar als kleiner Junge damals dieser unheimlichen Schilderung gelauscht, und immer, wenn er als Kind an den einsamen Ufern des Sees entlangging und sich vorstellte, unter seiner regungslosen, grauen Fläche, tief unten auf zerklüftetem Grunde, lägen die Trümmer der untergegangenen Stadt samt den Überresten ihrer bösen Bewohner, so liefen ihm kalte Schauer über den Rücken, zumal wenn er an Großmutters erhobenen Zeigefinger dachte, mit dem sie ihre Warnung unterstrich, die bösen Geister der Toten stiegen zuweilen aus der Tiefe herauf, trieben dann über dem Wasser ihr Unwesen und kämen auch hin und wieder durch die Lüfte herangesaust, um das eine oder andere Menschenkind, weil es sich zu sehr dem Bösen geöffnet, zu quälen und zu piesacken. Ja, wenn es gar zu verstockt sei, wenn es kein Bitten um Verzeihen oder sonst ein liebes Wort mehr über die Lippen bringe, packten sie es und - hui!! - schleppten es mit sich durch die Lüfte und tauchten - platsch! - mitsamt dem verstockten, unverbesserlichen Kind hinab in das Reich der bösen Geister, wo es dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet!
Es war schon ’starker Tobak’, was seine Großmutter ihnen da hin und wieder an den Kopf warf, an schrecklichen Warnungen und beängstigenden Drohungen! Und war eine solche Erzählstunde erst einmal richtig in Gang gekommen, so konnte die alte Frau, angespornt durch weit aufgerissene Kinderaugen, die nach immer neuen, noch unglaublicheren Geschichten verlangten, ihren Erzähldrang und ihre Phantasie nicht mehr zügeln; dabei scheute sie auch nicht davor zurück, verschiedene Sagenkreise, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, zu vermischen. So reicherte sie eines Tages die finsteren mittelalterlichen Gestalten der Rundhofsage mit den bekannten Helden aus der Antike an, ließ Julius Caesar bis zur Steinfirstgegend vorpreschen und den angeblich auch im antiken Rom hochberühmten Rundhofweiher nicht nur besichtigen, sondern auch schwimmend durchqueren. Die Varusschlacht verlagerte Großmutter in den Steinfirstwald, unweit vom Runenweiher, und sie behauptete in entschiedenem Ton, Varus habe sich in seiner Verzweiflung nicht ins Schwert, sondern mitsamt seinen Präfekten und Tribunen in den See gestürzt, die Konsequenzen aus seiner Niederlage ziehend, die ihm nicht nur Arminius, sondern auch die Rachegötter des Himmels ob seines Hochmuts und seiner Bosheit bereitet hätten. Schließlich ließ die Großmutter noch einen dritten antiken Helden sich auf die Wanderschaft zum Runenweiher begeben: Orpheus, den begnadeten Sänger, der um Eurydike trauerte und nach der Verblichenen lechzte. Ihm sei angeblich zu Ohren gekommen, nicht der Berg Tainaros, sondern der Runenweiher sei einer der wenigen Eingangspforten zur Unterwelt, einer der wichtigsten und bequemsten. Also machte sich Orpheus von Thrakien aus auf den Weg und begab sich, von Sehnsucht nach seiner im Schattenreich weilenden Eurydike getrieben, auf eine lange Wanderschaft, bis er schließlich hierher, zum Runeweiher, kam, begleitet von Hermes, dem Götterboten, und er sei in den See hinabgetaucht und dadurch zur Geisterwelt vorgedrungen.
Diesmal allerdings, bei Orpheus, hatte sich Elmars Großmutter mit ihren phantastisch kombinierten Sagengeschichten verrechnet, das heißt, sie hatte nicht damit gerechnet, dass die Knaben, welche eine Erzählrunde um sie bildeten, in der Schule schon im ersten Schuljahr von Orpheus und der Nymphe Eurydike gehört hatten, und zwar aus den Erzählungen ihrer Lehrerin, die gleichfalls fesselnd Geschichten zum besten geben konnte und eine ebenso reiche, aber doch mehr an den Tatsachen orientierte Phantasie besaß.
„Großmutter“, rief Elmar als Knabe aufgeregt und schaute sie mit ernsten, skeptischen Blicken an; „das ist gar nicht möglich, dass Orpheus hier war. Der Runenweiher ist doch erst im Mittelalter entstanden! Orpheus aber lebte viel früher, er war im Mittelalter schon lange tot.“
Die Großmutter stutzte und schaute einige Sekunden verblüfft drein. Ihr Gesicht, ohnehin schon vom Erzählen der schrecklichen Rundhofgeschichte ernst und grimmig verzogen, wurde noch um einige Grade grimmiger, was wohl von der steilen Senkrechtfalte herrührte, die wie hingezaubert auf ihrer Stirn lag und diese in zwei Abschnitte unterteilte. Der Knabe Elmar wusste, das war immer ein Zeichen, dass sie angestrengt nachdachte. Einige Sekunden saß sie so da und schien nachzugrübeln. Dann plötzlich verschwand die steile Falte, die Stirn wurde wieder einheitlich und das bitter ernste Gesicht heiterte sich auf.
„Du hast recht, Elmar“, sagte sie mit fester, keine Spur von Unsicherheit verratender Stimme, „der Runenweiher kann ja gar nicht im Mittelalter entstanden sein, wenn Orpheus hier war. Aber, habe ich euch das nicht erzählt? Der See stammt doch aus der Atlantiszeit. Rundhof war eine Siedlung der Atlanter, die viele Jahrhunderte vor den Griechen bis hierhin zur Steinfirst vorgedrungen waren!“
Ja, das schien plausibel und logisch, zumindest war der ärgerliche Widerspruch beseitigt, dass der wandernde antike Sänger einen im Mittelalter entstandenen See als Einlasspforte zur Unterwelt benutzt hätte.
„Der Runenweiher also war ein in Griechenland bekannter Einstieg in die Schattenwelt“, behauptete die Großmutter weiter, ohne dass ein unsicheres Tremolo ihre Stimme verfremdete; „Orpheus musste erst mit einem Boot den Unterweltfluss Styx entlang fahren; der mündete direkt im Runenweiher. Dann also - riet ihm Charon, der Fährmann des Styx, der ihn ruderte - müsse er sich an einer bestimmten Stelle, die er ihm zeigen werde, die Nase zuhalten und rückwärts in den See fallen lassen. Keine drei, vier Meter unter der Oberfläche sehe er dann das Eingangstor zur Unterwelt. Das könne er gar nicht verfehlen, denn es schimmere ihm mit vielen flackernden, rötlichen Lichtern entgegen. Er brauche dann nur noch das Tor zu öffnen, schon sei er im Trockenen, könnte dann auch wieder atmen.“ - Dass wegen des Wasserdruckes das Tor gar nicht geöffnet werden konnte, verschwieg die Großmutter, und Klein-Elmar und seine Mitschüler waren in ihren physikalischen Kenntnissen halt noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie auch hier sofort Protest hätten einlegen können. Und immer weiter sollte Orpheus dann - fuhr die Oma mit ihrer Erzählung fort - einen Gang hinuntergehen, so habe man ihm gesagt, bis er im Reich der unseligen und der seligen Geister angekommen sei. Und das habe Orpheus auch getan. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, habe er sich vom Boot des Charon ins Wasser plumpsen lassen, vier Meter unter der Wasseroberfläche dann das rot leuchtende Tor zu Unterwelt geöffnet und sei von dort hinabgestiegen.
Da Elmar damals den Rest der Orpheusgeschichte schon kannte, stellte er keine weiteren Fragen mehr. Die dreiste Lügengeschichte der Großmutter durchschaute er als Knabe zunächst noch nicht; seine Gedanken waren allein auf diese unerhörte Verlagerung der Orpheussage in die Gegend um den Runenweiher gerichtet, und allein das hatte ihn in helle Aufregung versetzt. -
Einsam war es zumeist an den Ufern des Steinfirstsees; man konnte früher dort stundenlang verweilen, ohne eine Menschenseele zu Gesicht zu bekommen. Das hing nicht zuletzt mit der Aura des Mystischen zusammen, welche den See, vor allem ein angrenzendes, hügelartig ansteigendes Waldstück, genannt der Topenbühl, umgab. Dieser hieß im Volksmund auch ’Totenbühl’, weil es dort nachts angeblich spuken soll. So war es nicht verwunderlich, dass diese Orte als unheimlich und dämonisch verschrieen waren und von Wanderern und Ausflüglern gerne gemieden wurden.
Elmar dagegen hatte als Heranwachsender jedem Aberglauben abgeschworen, auch eingedenk der phantastischen Erzählungen seiner Großmutter, die er schließlich als Knabe doch bald durchschaute. Fortan kümmerten ihn die zahlreichen Schauergeschichten nicht weiter, welche um den Runeweiher und den „Totenbühl“ gesponnen wurden. Er hielt sie allesamt für Hirngespinste. Der See verlor für ihn nicht nur die Aura des Schreckens, er avancierte sogar zu einem bevorzugten Ziel seiner Wanderungen und Radausflüge, ja es gab schließlich keinen Ort, den er zusammen mit seinen Freunden lieber aufgesucht hätte, um entweder mit ihnen auf die silbrige Wasserfläche hinauszuschwimmen oder - alleine in einem Ruderboot treibend - mitten im einsam ruhenden und wie verzaubert daliegenden See vor sich hinzuträumen.
Auch sein Vater hielt nichts von dem abergläubischen Geraune, welches man immer wieder in den Dörfern diesseits und jenseits des Steinfirstsees vernehmen konnte. Alle diese Schauermärchen hielten ihn nicht davon ab, ein kleines, direkt am Seeufer gelegenes Grundstück vom Gemeindefiskus zu pachten in der Absicht, dort, in der Stille des Runenwaldes, ein Blockhaus mit kleinem Garten zu errichten. Es sollte seiner Familie als Wochenendhaus dienen, damit sie an langen, heißer Sommerwochenenden sich erholen und einen kurzer Badeurlaub bequemer genießen könnte. Dieses Häuschen wurde denn auch innerhalb kurzer Zeit errichtet, und zwar im Selbstbauverfahren - nur das Fundament mit einem Kriechkeller für Gartengeräte ließ Elmars Vater von einem professionellen Maurer aus Backsteinen anlegen.
Im übrigen übernahm er selbst die Aufgaben des planenden Architekten, während die übrige Familie, allen voran Elmar und sein Freund Joachim Schaller, bei der Ausführung fleißig mit Hand anlegten, ja beide Jungen waren oft die einzigen, die sich auf der Baustelle abrackerten, derweil Elmars Vater, von seinem Beruf stark in Anspruch genommen, oft wochenlang nicht zum See hinausfahren konnte und bei Elmars Mutter und seiner Schwester der Anfangselan sich rasch legte; kein Wunder: das Hämmern und Schrauben, Sägen und Hobeln, Messen und Werkeln, alles oft in der prallen Sommersonne ausgeführt, war für sie, zumal für zarte Frauen -und Mädchenhände, doch nicht so das Angemessene -
Je länger Elmar nun von der Bushaltestelle aus zur hochragenden Steinfirst aufblickte, hinter deren Waldspitzen der Runenweiher in seiner mystischen Einsamkeit ruhte, umso fester schlossen sich alle seine Gedanken zu der einen Frage zusammen: Gibt es ihr Blockhaus eigentlich noch, welches sie einst unter so großen Mühen erbaut hatten? Stand es noch am Ufer des Sees, einsam und einladend zugleich, oder war es nach über zwei Jahrzehnten den Zeitläuten zum Opfer gefallen? Nun - dachte er - das wird sich gleich herausstellen; also lenkte er seine Schritte zum Ortsende, von wo man auf einem bequemen Waldweg den Steinfirstsee erreichen konnte.
Nach einer knappen Stunde Fußmarsch durch den Hochwald der Steinfirst sowie durch einen angrenzenden Höhenzug, dessen Name ihm entfallen war, lockerten die bislang dichtstehender Buchen und Eichen ganz plötzlich vor ihm auf, und zwischen ihren Stämmen konnte er zunächst ein Stück Himmel und bald darauf in einem weitläufigen Tal das altvertraute Bild des in der Mittagssonne freundlich schimmernden Sees erkennen. Der bis dahin gerade verlaufende Waldweg fiel in einer scharfen Biegung nach links ab, verwandelte sich in einen Hohlweg und entschwand bald darauf Elmars Blicken. In einigen Windungen führte er direkt zum See hinunter, vorbei an zahlreichen, hangartig abfallenden Wiesenstücken, die man ob ihres saftig-grünen Grases sehr gut als Viehweiden benutzen konnte, aber, soweit er sich erinnerte, niemals als solche gebrauchte, vielleicht weil die in Frage kommenden Bauernhöfe etwas zu weit entfernt lagen.
Die Sonne verkroch sich eben für kurze Zeit hinter einem dicken Wolkenballen, und sofort änderte der See, auf dem Elmars Auge wie gebannt fixiert war, sein Aussehen: seine ziemlich runde, bisher lichtübergossene Fläche verwandelte sich in ein dunkles, tief grünes Maar, und da überall an seinen Rändern, wo kurzstämmige Nadelwälder grenzten, nachtschwarze Fichten ihre Wipfel wie spitze Zacken in den Himmel reckten, kam es ihm vor, als läge dort unten im Talkessel ein riesiges, bewimpertes Insektenauge und starrte boshaft zu ihm herauf. Rasch löste sich sein Blick von der eingebildeten unheimlichen Erscheinung und eilte in Sekundenschnelle die Ufer des Runenweihers entlang, bis zu dem Punkt, wo nach seiner Erinnerung das Wochenendhaus seiner Eltern stehen müsste - vergeblich: der kleine Holzbungalow, der ob seiner leuchtend weißen Farbe einem von der Höhe blickenden Wanderer immer sofort ins Auge sprang - er konnte ihn trotz angestrengten Suchens nicht entdecken, und nach einigen Minuten wurde es ihm zur Gewissheit: das Häuschen war verschwunden, war regelrecht vom Erdboden ausgetilgt, als hätten unbekannte Kräfte es irgendwann einmal emporgehoben und anschließend in den See gestoßen.
Keine Viertelstunde brauchte er, um zum See hinunterzukommen und die Stelle zu erreichen - die leere Stelle -, wo einst ihr Wochenendhaus gestanden hatte.
‚Ja, genau hier muss es gewesen sein’, dachte er und schaute auf ein von Brenneseln und Quecken überzogenes Stück Land. War irgendein Stein oder irgendein Holzbrett erhalten geblieben? Nein! Auch ein Balken war nirgendwo zu erblicken! Nur Leere starrte ihm entgegen - Leere, gefüllt mit wucherndem Unkraut!
Sein Blick glitt über den See, erfasste seine mit dichten, schwarzgrünen Fichtenwäldern umsäumten Ufer. Alles sah aus wie vor über 20 Jahren - nur ihr Blockhaus fehlte, als wäre es aus dieser Landschaft herausgenommen und der ursprüngliche, ewig unveränderliche Zustand der Natur wiederhergestellt worden - kam es ihm vor.
Genau gegenüber stiegen immer noch die bewaldeten Hänge des Topenbühls auf, jenes bereits genannten Waldhügels. Deutlich war er an dem Wildwuchs des Unterholzes und zahlreicher bizarr geformter Krüppelkiefer zu erkennen. Zur Kuppe des Hügels ragten hochstämmige, teilweise von unten nach oben aufgekahlte Fichten empor, nur hier und da von den breiten Kronen einzelner Altbuchen unterbrochen, die ob ihrer Herbstfärbung wie gelbrote Brandmale aus dem dunkelgrünen Einerlei hervorstachen.
Dieser ’Totenbühl’, wie er ja auch genannt wurde, verdankt seine volkstümliche Bezeichnung einigen schrecklichen Vorfällen, die sich in seinem einsamen, wilddurchwachsenen Gelände ereignet haben sollen. Einmal hätte sich dort ein junges Mädchen aus Liebeskummer an einer der vielen knorrigen Kiefern erhängt, und man munkelte, ihr Geist würde zuweilen noch in dem Waldstück umgehen, vorwiegend in der Abenddämmerung. Auch könnte man den Geist eines ehemaligen Raubritters antreffen, dessen Burg im fernen Mittelalter auf dem Gipfel des Totenbühls gestanden haben soll. Von einem zusammengetrommelten Heer, bestehend aus Bürgern der nahe liegenden Dörfer und Städte, wäre sie irgendwann in der Zeit des Faustrechts „geknackt“ und dem Erdboden gleichgemacht worden. Den Ritter hätten die wutentbrannten Bauern- und Stadtkrieger dabei enthauptet. Man sprach auch von den Abstürzen zweier Flugzeuge am Ende des Zweiten Weltkrieges: Ein amerikanischer Lancasterbomber sei hier nach einem Luftkampf aufgeprallt; desgleichen - einige Zeit später - ein deutsches Heinkel-Jagdflugzeug, und von den Besatzungen sei niemand lebend geborgen worden, auch die Leichen habe man trotz intensiven Suchens nie gefunden. Diese merkwürdige Häufung von Todesfällen, verbunden mit dem Unheimlichen, Rätselhaften dieser Vorkommnisse - hier also lag wohl die Ursache der Namensgebung. Sie drückten dem harmlosen, an der Südostecke des Runenweihers gelegenen Waldstück auf immer den Stempel des Unheilvollen, Schicksalhaften auf, was Elmars kühl und nüchtern veranlagter Familie allerdings nicht hinderte, direkt gegenüber dem angeblichen düsteren Ort der Heimsuchung jenes hübsche Ferienblockhaus zu errichten, unabergläubisch, wie Familie Redlich nun einmal eingestellt war.
Elmar betrachtete nun etwas genauer das kleine Stück Land, auf dem einst ihr Häuschen gestanden hatte, vor allem den Teil, der einmal ihr Garten war, und sofort trat es ihm lebhaft vor Augen, wie sie ihn damals mit viel Mühe angelegt, allen voran wieder sein Freund Joachim und er, denn sein Vater hatte ihnen eine fulminante Belohnung versprochen, falls sie sich wieder so mächtig ins Zeug legten wie bei der Errichtung des Häuschens, ihm also einen Garten bauten, wie er ihn sich vorstellte: mit wohl anzuschauenden Zierbäumen, edlen Sträuchern, einem kleinen Rasenstück und viel Blumenschmuck auf den Beeten und mit einem kleinen Steingarten.
Eine wahre Herkulesarbeit war nötig gewesen, um seinen Wünschen nachzukommen, um der unerbittlichen, mit starken Wurzeln im Boden verankerten Waldnatur dieses kleine, künstliche Gartengebilde abzuringen: Zunächst mussten kleine Waldbäume gefällt, zahlreiche tiefe Gräben ausgeschachtet und das im Erdreich wirr verzweigte Wurzelwerk mit Spitzhacke und Beil ausgemerzt werden; später dann, nachdem die kleine Gartenoase vollendet war, mussten die beiden Jungen immer aufpassen, dass der gnadenlose Wildwuchs des Waldes, mit seiner wurzelhaft wühlender Kraft, nicht von außen herandrängte und den empfindlichen Gartenpflanzen die Lebenskraft raubte, womit all das ziemlich schnell zerstört sein würde, was sie mit viel Phantasie und viel Eifer aufgebaut hatten.
Doch bis es soweit war, dass sie sich der Pflege ihres Werkes zuwenden konnten, bis die Samen ausgesät, die Jungpflanzen auf den Beeten und Rabatten ihre gleichmäßig grünen Inseln bildeten, bis Sträucher und Büsche in verschiedener Dichte und Größe dem Auge das wohlbekannte, abgestufte Profil eines hübschen Ziergartens anzeigten, musste noch hart gearbeitet werden, mussten sie etliche Wochen lang tagaus, tagein zwischen Heimatdorf und Runenweiher hin- und herpendeln, zumeist mit einem Leiterwagen, und auf ihm die Gartenbäume und Sträucher zum See befördern, was eine verdammt anstrengende, vor allem eine zeitraubende, nervtötende Arbeit war: Birken und Ahornbäume, solche von der buntblättrigen Sorte, transportierten sie zum See, außerdem Liguster- und Hartriegelsträucher und natürlich die unvermeidliche, elegante Alpenrose, alle von Elmars Vater in einer Baumschule gekauft. Aber auch der Wald selbst öffnete ihnen seine Schatzkammern, bot ihnen, während sie tief in seine gewaltigen Gemächer eindrangen, einige herrlich gewachsene Waldginsterbüsche an, die sie sogleich ausgruben und ebenfalls auf dem Leiterwagen herankarrten, meist über holpriges Gelände, bestenfalls auf groben, überwurzelten Pfaden, die oft mitten im Wald endeten, und sie pflanzten sie dann in ihren neu angelegten Ziergarten ein, wie die anderen auch, nachdem sie den Boden noch einmal kräftig umgegraben und mit Torf verbessert hatten. Joachims Eltern, die gute Beziehungen zu einem Gärtner hatten, verschafften ihnen immer einen günstigen Rabatt, ja, manchmal machten sie es sogar möglich, dass sie die eine oder andere Staude, die bald auf ihren Beeten zu einem bunten Blütenleben erwachten, von dem Gärtner geschenkt bekamen. Doch der Mühen war noch kein Ende: Sie sollten ja noch einen das Auge freundlich zum Ausruhen einladenden Steingarten anlegen, und zwar seitlich an der Terrasse. Also mussten erst einmal Steine herangeschleppt, guter Mutterboden aus Walderde, Sand und Torf gemischt, außerdem Polsterstauden in reicher Zahl eingekauft werden, und nachdem dies geschehen, nachdem alle diese Pflanzenjuwele, zunächst noch unansehnlich grün ausschauend, eingegraben waren, dauerte es nicht mehr lange, bis die stolzen Kohorten der Frühjahrs- und Sommerblüher nacheinander ihre Farbteppiche direkt vor der Terrasse prachtvoll und bunt entrollten: zuerst das gelbe Steinkraut und das dunkelviolette Blaukissen, dann der karminrote Riesensteinbrech und die Küchenschelle mit ihren zartvioletten Blütenblättern und gelben Kelchen. Ihr folgten bald das weißleuchtende Hornkraut mit seinen silbrigen Blättern und Stängeln sowie die duftendblauen Glocken der Campanula; schließlich - als krönenden Abschluss - entfalteten die rotvioletten und die rosa-weißen Blüten der Flammenblume ihren ganzen feurigen Charme. Auf den Randbeeten, wo ein Drahtzaun die kleine Kulturlandschaft von dem Wald trennte, prangten wie selbstverständlich in allen denkbaren Farbtönungen die Polianda- und Floribundarosen, und in den beiden Winkeln des hinteren Zaunes streckte ab August, jeweils aus dichten Horsten, der Sonnenhut seine goldgelb strahlenden Köpfe empor. -
Doch wo war all diese Herrlichkeit geblieben? Vergeblich suchte Elmar einige seiner Gartenlieblinge wiederzufinden. Es war buchstäblich nichts mehr vorhanden; nur von den Birken und Ahornen stand noch je ein Exemplar, aber kläglich dahinkümmernd, weil fast vollständig zugedeckt von urwüchsig wuchernden Schlehen und Heckenkirschen. Und die Gartenbeete? Der Zaun war selbstverständlich nicht mehr da. Innerhalb des Bereiches, den er einst schützend umhegte, war alles von Brennnesseln und Queckenhorsten überwachsen; dazwischen schossen einige Jungfichten in verschiedener Größe platzgreifend empor; im übrigen war der von ihnen einst unter großen Mühen urbar gemachte Boden von bizarr durcheinanderlaufenden Baumwurzeln zerschnitten und zerschunden. Keine Spur mehr von den prachtvollen Rhododendrenbüschen! Der grüngoldene Liguster, die buntblättrigen Hartriegelsträucher - wie vom Erdboden verschluckt! Und der Waldginster, jener stolze Strauch mit seinen im Frühsommer goldfunkelnden Blütentrauben? Auch er verschwunden in dem Gewirr von Brennnesseln und buschigem Wollgras!
Elmar bückte sich. Zwischen zwei buckligen Grasbüschen hatte er etwas entdeckt, einen Backstein. Also doch ein Überrest! Aber von Moos überzogen. Er gehörte offenbar zu den Grundmauern ihres Hauses. Er hob ihn auf, betrachtete kurz das zerbröckelte, rissige Gebilde und warf es dann in hohem Bogen in den See, dorthin, wo nach seiner Vorstellung auch die übrigen Teile des Hauses versunken waren. Vielleicht hatte ein Sturm das morsch gewordene Holzhaus irgendwann zum Einsturz gebracht, zahlreiche Balken mochten ins Wasser gefallen und abgetrieben sein; andere waren vielleicht eines Tages von irgendeinem Bauern samt den Ziegelsteine, die er vielleicht gut gebrauchen konnte, abtransportiert worden. Das Holz hatte er vermutlich verfeuert, die Ziegelsteine anderweitig verwendet, vielleicht als Grundmauern für einen neuen Stall.
In Gedanken verloren, setzte sich Elmar auf einen Baumstumpf, sein Blick wanderte den Weg entlang, den er gerade gekommen war, hielt bei einer vereinzelt stehenden Pyramidenpappel an, durch welche der Wind wie rasend hindurchging. Er erinnerte sich, den Baum schon in frühester Jugend so beobachtet zu haben, in gleicher Größe und Gestalt; ja das Bild seiner unbändig im Wind hin und her schwankenden Krone schien ihm plötzlich so vertraut, als stände dort ein alter Bekannter und grüßte mit heftiger Gebärde zu ihm herüber, um seiner wilden Freude über ihr Wiedersehen Ausdruck zu verleihen. Da dieser Baum für ihn gleichsam das Verbindungsglied zu den früheren Zeiten darstellte, reizte es ihn, die alte Zeit wieder in Erinnerung zurückzurufen. Dagegen musste erst einmal ein anderer, warnender Gedanke niedergerungen werden, der ihm riet, die alten Geschichten, statt sie zu seinem Missvergnügen zu neuem Leben zu erwecken, lieber in den verschlossenen Schubfächern seines Gedächtnisses ruhen zu lassen.
Doch das Verlangen, gerade dies zu tun, das heißt die Schubfächer aufzuschließen und in Augenschein zu nehmen, regte sich bei ihm, es regte sich umso mehr, je stärker er den Wunsch verspürte, von seinen künftigen Alpträumen befreit zu werden, die vielleicht noch belastender, noch qualvoller sein könnten, als die Erinnerung an irgendwelche unguten Ereignisse seiner Vergangenheit. Instinktiv ahnte er, es hätte Vorfälle um Ulrike Düsterwald und um Julia gegeben, an denen er beteiligt gewesen war und die bei ihm ein schlechtes Gewissen, ja ein Schuldgefühl ausgelöst hatten. Welche Vorfälle das waren, wusste er nicht mehr genau. Er hatte alle Erlebnisse, die mit Julia zusammenhingen, weitestgehend verdrängt. Sein Entschluss damals, sich niemals mehr des Kapitels, das Julia Lambertz hieß, zu erinnern, führte im Laufe der Zeit dazu, dass ihm der ganze Beziehungsknäuel entglitt, dass sich in seinem Gedächtnis, was die Erlebnisse mit Julia im Einzelnen betraf, eine große, weiße Fläche herausgebildet hatte. Doch diese Fläche - überlegte er - wenn er auf sie jetzt wieder die Bilder dieser bestimmten, anvisierten Phase seines Lebens projizierte - könnte sich das für ihn nicht doch positiv auswirken? Könnte er nicht, indem er den Sperrriegel seines Verdrängungsmechanismus löste und die genannten Schubfächer, wo seine Erlebnisse mit Julia Lambertz sozusagen ausgelagert waren, genauer inspizierte, durch ein solches gezieltes Erinnern den Gang jener Ereignisse in seiner Folgerichtigkeit erst richtig erkennen und verstehen und sie auch am Ende richtig verarbeiten? Klar - sagte er sich - das wäre doch immerhin möglich. Den ganzen verdrängten Erlebniskomplex, der sich in seiner Seele zu dem bekannten unseligen Störfaktor ausgewachsen hatte, zum Wohle seines künftigen Nachtschlafes unschädlich zu machen - etwas Besseres könnte ihm doch gar nicht passieren! Heilen durch Erinnern, diesen Spruch hatte er irgendwo einmal gelesen. Er bekam für ihn jetzt eine aktuelle Bedeutung. So sah er in seinem Vorhaben, in die Vergangenheit zurückzukehren, schließlich keine Alternative mehr. Jedenfalls die andere Möglichkeit, einfach diesen Ort der Erinnerung wieder zu verlassen und nach Waldstädten zurückzukehren, kam für ihn nicht mehr in Frage. Und also überwand er ziemlich schnell seinen Widerwillen gegen das Heraufbeschwören früherer Zeiten, er negierte auch die weiter in ihm hochtreibenden und heftig widersprechenden Warnungen vor solchen Rückblicken, sondern erteilte seinen Gedanken den Befehl, die gewaltige Distanz, die ihn von jenen Ereignissen trennte, im Nu zu überbrücken. Gleichzeitig heftete er seinen Blick unverwandt auf den sich im brausenden Wind weiter hin- und herbiegenden Baum, als ob er für ihn der Wegweiser zu den alten Zeiten wäre, als ob er ihn nur lange genug anstarren müsste, schon wären seine zurückeilenden Gedanken in der versunkenen Welt angekommen. Und in der Tat trat etwas Seltsames ein: die kleine Scholle, auf der er regungslos auf dem Baumstumpf saß, begann sich wieder dem Zustand von ehedem anzunähern, auch der See selbst und der Topenbühl samt den ausgedehnten Steinfirstwäldern veränderten etwas ihr Aussehen, aber eigentlich brauchten sie das nicht, sie sahen ohnehin wie früher aus. Die Zeit lief rückwärts und seine Gedanken liefen mit, sie durcheilten die Jahre und Jahrzehnte, tauchten tief hinab in die Vergangenheit, die wie ein Lichtjahre entfernter, winziger Sternennebel, allmählich größer und größer werdend, auf ihn zukam; immer näher schwebte er heran, der Nebel, und wurde schließlich zu einer Wolke, die sich ständig vergrößerte, und aus ihr schaute bald irgend etwas heraus, zunächst in Umrissen, dann, nachdem die Nebelschleier sich verzogen, trat dieses Etwas in kristallener Schärfe hervor: es war - ihr Blockhaus von einst! Auf solidem Backsteinfundament gebaut, stand es auf einmal vor ihm, mit gediegenen Holzwänden, von denen das Flachdach, an allen Seiten vorspringend und gegen Regenschauer und stechende Sonne Schutz bietend, getragen wurde. Der wildüberwachsene Waldboden vor der Terrasse verwandelte sich in einen zauberhaften Garten, freundlich leuchteten ihm die Frühlings- und Frühsommerblüher unter den Stauden entgegen, und die ersten Rosen hatten ihre wunderschönen Blüten bereits entfaltet. Verblüfft stellte Elmar fest: Die Zeit hatte sich verwandelt, er war wieder in der Jugend. Er stand mit einem Jungen vor dem Häuschen und betrachtete mit ihm ehrfurchtsvoll den Garten, welchen sie kurz zuvor vollendet hatten. Der Junge war Joachim Schaller, sein Jugendfreund.