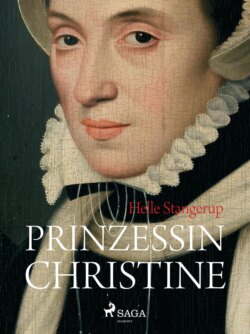Читать книгу Prinzessin Christine - Helle Stangerup - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. Kapitel
ОглавлениеChristine versuchte, sich auf einen Brief zu konzentrieren, den sie gerade schrieb, doch die Hitze war unerträglich, und dazu kam das ständige Gerede und das Spektakel der Dienerschaft und der Soldaten im Burghof. Ihre Damen saßen steif und unbeholfen auf den Schemeln. Sie waren die neue Mode nicht gewohnt, die vorschrieb, die Taille in ein Korsett zu schnüren. Sie stickten und redeten über die letzten Neuigkeiten vom Hof zu Mantua und über die bevorstehende Verheiratung Alexanders von Medici mit Margarete, der unehelichen Tochter des Kaisers.
Christine war nun über ein Jahr in Mailand, ertappte sich aber immer noch dabei, beim Aufwachen zu glauben, den Geruch feuchten Grases einzuatmen, dabei gab es nur Staub, Hitze und Lärm, und der Herzog war nach Vigevano gereist.
Zu Beginn des Sommers hatte sich sein Gesundheitszustand verschlimmert, und die Ärzte rieten zu einem Aufenthalt in gesünderem Klima, und obwohl er der Kranke war, schickte er stets liebevolle, aufmerksame Briefe an seine Frau. Es war lange her, daß Christine beim Anblick des alternden Mannes vor Schreck die Zitronen fallen gelassen hatte. Sie war nicht mehr das Mädchen, das vor knapp vierzehn Monaten allein zum Brautbett geführt worden war.
Deutlich erinnerte sich Christine an das erste längere Gespräch mit dem Herzog. Er hatte im kühlen Halbdunkel der Sala delle Asse gesessen und freundlich gelächelt, während er ihr erklärte, daß ihr gesamter Hofstaat in die Niederlande zurückgeschickt werden sollte. Sie war jetzt italienische Herzogin und mußte einen italienischen Hofstaat haben.
Der Herzog wollte wissen, was sie selbst davon hielt. Aber sie wußte, daß eine Ehefrau ihrem Gemahl in allen Dingen gehorsam, treu und ergeben sein soll, und hatte natürlich nichts dagegen einzuwenden.
Der Herzog lächelte erneut, nahm seinen Stock und deutete an Wand und Decke, wo gemalte Baumstämme und grüne Wipfel sich hinaufzogen ins Deckengewölbe und in dem Wappen der Sforzas endeten.
Das habe Meister Leonardo geschaffen, erklärte er. Er erinnere sich aus seiner Kindheit daran, wie dieser Künstler mit seinen Lehrlingen auf Gerüsten herumgekrochen sei.
Meister Leonardo habe auch la Saletta Negra verziert und ein wunderbares Reiterstandbild des ersten Sforza aus Lehm gestaltet. Aber das sei jetzt nicht mehr da, zerstört von den Franzosen, und die Bronze, in die es gegossen werden sollte, habe man für Kanonen benötigt.
Christine hörte ihm zu und traute ihren Ohren kaum, als der Herzog ihr all die Maschinen beschrieb, die der Meister entworfen hatte. Eine davon sollte sogar fliegen können. Christine fand ihn ein bißchen verrückt, obwohl seine Gemälde so schön und lebendig wirkten, als könne sie direkt darin eintauchen.
Als Christine von ihrem Gefolge Abschied nahm, war sie erst kurze Zeit in Mailand und noch längst nicht vertraut mit der großen Zitadelle. Sie lief durch einen riesigen Saal, um daneben in den nächsten und dann in noch einen zu kommen. Man fand sich schwer zurecht, und draußen waren überall Kanonen aufgestellt. Es gab Innenhöfe, große und kleine, und vom obersten Stockwerk blickte sie über die größte Stadt, die sie jemals gesehen hatte. Einige hunderttausend Menschen lebten da unten, und sie betete innig zur Heiligen Jungfrau, doch bald schwanger zu werden, denn das wünschten sich alle in ihrem neuen Land.
Es war eine Ewigkeit her, daß Christine darum gefleht hatte, und ihre Gedanken kehrten zurück zu dem Brief.
Der Herzog hatte gesagt, sie müsse sich nicht die Mühe machen, selbst zu schreiben, könne einem ihrer Sekretäre diktieren. Christine erwiderte, daß sie ihm in diesem Punkt nicht zu gehorchen gedenke.
Die Damen sprachen unablässig darüber, was ihre Kusine in der Ehe mit dem lasterhaften Alexander zu erwarten habe, dem es kürzlich eingefallen war, in Frauenkleidern durch die Straßen von Florenz zu reiten und allen antiken Statuen den Kopf abzuschlagen. Christine überlegte einen Augenblick, ob sie ihnen den Mund verbieten sollte, hielt es aber für zwecklos. Fünf Minuten später würden sie von vorne anfangen, denn es widersprach ihrer Natur, zu schweigen.
Christine hatte noch nie Menschen erlebt, die so viel Schönes mit ihren Händen zu schaffen vermochten, aber auch nie jemanden getroffen, der so viel redete wie die Italiener.
Sie redeten vom Aufwachen bis zum Schlafengehen. Die Kammerzofen erzählten, wenn sie ihre Kleider in Ordnung brachten, die Hofdamen, wenn sie nähten. Sogar während der Messe hörte sie die wispernden Stimmen. Und sie redeten über alles.
Christine hatte schnell Italienisch gelernt, schneller als ihre Umgebung damit gerechnet hatte, und deshalb erfuhr sie nach und nach, daß ihre Ehe keine Ehe war, solange der Herzog nur ihre Hand küßte. Sie hatte zugehört, zuerst verständnislos, dann verwirrt, erschrocken, aber auch neugierig, und bis Neujahr kannte sie Worte auf italienisch, die sie nicht einmal in ihrer Muttersprache gehört hatte. Sie verstand, warum ihre Tante den Herzog einen rechtschaffenen Mann nannte und daß es eine flämische Dienstmagd war, mit der der Kaiser seinen »Unfall« hatte, welcher nun den gräßlichen Alexander heiraten sollte. Die Damen behaupteten freimütig, daß er der Sohn von Kardinal Guilio und einer maurischen Sklavin sei und deshalb so auffällig einem Neger gleiche.
Sie hatte das schadenfrohe Gelächter vernommen, als der König von England mit dieser Hure Anna Boleyn eine Tochter bekam und keinen Sohn. Sie wußte Bescheid, daß man Tage zählen mußte, um ein Kind zu kriegen, aber auch, um es zu vermeiden, und sich zur Sicherheit mit Alaun spülen sollte.
Ein Page teilte mit, daß der Kurier bereit sei. Christine beendete hastig ihren Gruß, unterschrieb mit »Eure euch stets gehorsame Frau«, faltete den Brief und verschloß ihn mit ihrem Lacksiegel. So wenig hatte sie zum Ausdruck gebracht, und er litt so sehr.
Nie hätte sich Christine vorstellen können, daß der Herzog für sie der vertrauteste Mensch in dem neuen Land werden würde, oder daß sie sich einmal danach sehnen würde, seine gebeugte Silhouette wiederzusehen und das Aufprallen der Krücke auf dem Marmorboden zu hören.
Christine konnte Anordnungen erteilen. Jedem Wunsch wurde entsprochen, doch was sie fühlte und dachte, durfte niemals gezeigt werden.
Äußerte sie eine Meinung über etwas anderes als die täglichen Geschäfte, wurde das zitiert, interpretiert und schließlich verdreht. Sie hatte gelernt, sich in ihren Äußerungen zu beherrschen, begriff aber nun, daß hier jedes Nicken, jedes Lächeln oder ein abwesender Blick zum falschen Zeitpunkt gedeutet wurde als Begeisterung oder Mißfallen oder gar feindliche Haltung gegenüber dem König von Frankreich oder dem Herzog von Mantua oder dem Papst in Rom. Christine war eine politische Person, und eine von einer Kammerzofe aufgeschnappte Bemerkung konnte leicht in den Rapport eines ausländischen Gesandten einfließen.
Nur ein Mensch durfte ihre Gedanken erfahren. Das war der Herzog selbst. Und im Laufe der Zeit verbrachte sie immer mehr Stunden in seiner Gesellschaft. Er berührte nie etwas anderes als ihre rechte Hand, die er an seine Lippen führte. Er erzählte von der Geschichte Mailands, über das tragische Ende seines Vaters als Landesflüchtling und von seiner hochbegabten Mutter, die starb, als er noch klein war. Er lenkte ihre ersten Schritte in die Welt der Kunst, berichtete von der Domkirche, die man vor hundertfünfzig Jahren gebaut hatte. Er versicherte ihr immer wieder, daß sie Freude in sein Leben bringe, und allmählich fühlte sie, daß er das ehrlich meinte.
Christine entdeckte, daß sie einen Willen hatte.
Die Regentin hatte für reichlich Säume in ihren Kleidern gesorgt, aber als der Winter kam, war Christine so sehr gewachsen, daß sie neue Garderobe brauchte. Pelzwerk, Spitzen und Goldstickerei wurden natürlich abgetrennt, um wieder benutzt zu werden, aber was die Weitergabe der schönen Stoffe betraf, so hielt sie sich nicht an die Regeln, sondern bedachte diejenigen ihrer Damen, die ihn am dringendsten benötigten, statt die vornehmsten zu berücksichtigen. Das führte zu Mißstimmungen, und manch böser Blick traf sie. Doch dann lenkten wieder andere Ereignisse die Aufmerksamkeit der Damen auf sich. Der Klatsch am Hof blühte. Catharina von Medici und ihre Ehe mit dem Sohn des Königs von Frankreich standen nun im Mittelpunkt des Interesses.
Christine seufzte. Vom Fenster aus sah sie eine Staubwolke über der Stadt liegen, Pferde und Karren wirbelten sie hoch.
Alles war so anders als bei ihrem Einzug vor einem Jahr. Nachdem die Banner und Ehrenpforten verschwunden waren, sah sie verfallene Hütten, und als die Leute ihre Festtagsgewänder ausgezogen hatten, blieben oft nur Lumpen übrig. Aber die Lebensmittelpreise fielen in diesem Winter und linderten die Not, und falls der Frieden anhielt, würde der Wohlstand wiederkommen.
Wenn Christine mit ihren Damen durch die Straßen ging, wenn sie den Marktplatz überquerte oder die Werkstätten der Glaser, Gobelinweber, Steinschleifer und Buchbinder besuchte, richteten sich die Blicke der Leute auf ihren Leib in der Hoffnung, daß sie ein Kind austrage, das das Geschlecht der Sforzas weiterführen und die Garantie eines Friedens einlösen konnte. Aber erst nach der Abreise des Herzogs nach Vigevano, als Christine in ihr vierzehntes Lebensjahr kam, zogen ihre Zofen ihr Laken ab und entführten es wie eine Siegestrophäe. Es war in der Hitze des Sommers, und sie nahmen schwatzend und kichernd Maß, damit der Schneider über der Brust Säume anbringen konnte. Sie versicherten ihr begeistert, daß sie, sobald der Herzog gesund zurückkehrte, bereits im nächsten Frühling, wenn die Mimosen blühten, einen kleinen Prinz gebären würde.
Doch der Herzog blieb in Vigevano, und Christine schaute über die staubigen Hausdächer. Der Page meldete, daß der päpstliche Gesandte warte, später mußte sie eine Deputation der Uhrmacherzunft empfangen, und danach war eine Unterweisung in italienischer Literatur vorgesehen. Aber was auch immer geschah, mit welchen Pflichten oder Vergnügungen sie befaßt war, die Damen wichen nicht von ihrer Seite. Christine war nie allein.
Vielleicht hatte sie sich deshalb so schnell an ihren viel älteren und kranken Gemahl gewöhnt. So wenig sie sich ein eheliches Zusammensein mit dem Herzog vorzustellen vermochte, hatte er ihr doch das Gefühl menschlicher Gemeinsamkeit gegeben, und der dumpfe Laut der Krücke auf dem Boden klang wie das Zusammentreffen mit einem lieben Verwandten aus fernen Landen. Manchmal hatte er Neuigkeiten, wie die Entwicklung des Bürgerkrieges in Dänemark, ein anderes Mal brachte er ihr eine seltene Blume oder Frucht mit, damit sie deren Schönheit bewundern oder den Geschmack genießen sollte.
An einem Herbsttag, als sie von der Messe zurückkamen, wandte er sich an sie und nahm dabei wie gewöhnlich ihre Hand zwischen seine:
»Was bedeutet das Wort ›far‹«?
Es war ein kühler Morgen, Christine war mit ihren Gedanken weit weg, die frische Luft hatte Erinnerungen an Mechelen geweckt, und sie schaute ihn verständnislos an.
»›Far‹, wiederholte er und hielt sie mit seinem Blick fest, und langsam dämmerte es ihr. Das war das Wort, das sie bei ihrer ersten Begegnung in Cussago gerufen hatte, das einzige Wort, das sie noch auf Dänisch wußte.
»Padre«, flüsterte sie. Sie begriff, daß er lange darüber nachgedacht haben mußte, und fürchtete, er würde zornig werden wegen ihres Widerwillens in jenem Augenblick. Doch der Herzog blieb nur stehen, schaute sie an und sagte schließlich:
»Traurig, daß auch Kinder schon Sorgen haben müssen.«
Der Sommer hielt an, die Hitze hielt an. Die größte Neuigkeit des Jahres war die Niederlage der Türken in Tunis und wurde mit einem Te Deum in der Kathedrale gefeiert.
Für Christine war das größte Ereignis, daß Dorothea nun mit Pfalzgraf Friedrich verheiratet war. Sie kannte ihn nicht, hatte ihn vielleicht als Gast am Hof ihrer Tante gesehen, und der Herzog hatte erfreut der Ehe seiner Schwägerin mit dem fünfzigjährigen deutschen Fürsten Beifall gezollt. Aber trotz der begeisterten Briefe, die von Dorothea kamen und berichteten, wie vollkommen glücklich sie in ihrem neuen Leben sei, fühlte sich Christine um einige ihrer Träume betrogen. Wenn sie in ihrer Phantasie nach Brabant und Flandern zurückkehrte, wenn sie an den Palast von Brüssel oder das Palais von Mechelen dachte, hörte sie die Stimme ihrer Tante, Schritte, Laute im Haus, aber Dorotheas Kichern fehlte. Sie wirbelte nicht mehr um den Bettpfosten, biß sich nicht mehr mit ihren spitzen Zähnen in die Lippe, um einen Lachanfall zu unterdrücken. Nicht einmal in der Welt der Phantasie fand Christine den einzigen Menschen, dem sie sich stets voll und ganz anvertrauen konnte.
Als der Herzog endlich zurückkehrte, hatte sich sein Zustand verschlimmert. Die Lähmungen hatten sich ausgebreitet, und am Hof herrschte eine bedrückte Stille. Der Herbst brachte keine Besserung. Er lag in seinem Bett, eingefallen und bleich, er wurde vom Fieber ergriffen, Christine wachte bei ihm, und ab und zu nahm er ihre Hand und flüsterte: »Mein schönes Kind«, dieselben Worte, die ihre alte Tante bei ihrem Abschied geflüstert hatte.
Am Allerseelentag 1535 frühmorgens starb Francesco Sforza, Christines Gemahl und letzter Herzog Mailands.
Es würde einige Zeit dauern, bis die vielen Gäste zum Begräbnis eintrafen, und man mußte es deshalb verschieben.
Drei Wochen lang, von frühmorgens bis spätabends, saß Christine mit ihren Hofdamen in der Trauerhalle. Kein Tageslicht drang herein, die Wände waren schwarz verkleidet. Sie hörte nichts außer den Tönen und Stimmen des Requiems in der Kapelle, nichts bewegte sich außer den Flammen der Fackeln. Erst in diesen Novembertagen merkte sie, wie einsam sie geworden war. Sie dachte an den Herzog, an seine Laute, den Schlag der Krücke und die Stimme unter dem grünen Blätterdach der Sala delle Asse. Der schwächliche Körper, das schmerzverzerrte Gesicht waren verschwunden.
Die Damen schwiegen jetzt, und in der Stille wuchs Christines Sehnsucht, nach Hause zurückzukehren, lebende Gesichter wiederzusehen.
Am 19. November fand das Begräbnis statt, und drei Tage später empfing Christine als vierzehnjährige, schwarz gekleidete Witwe die Gesandten des Landes, die Senatoren der Stadt und die Delegationen der lombardischen Städte, die ihr Beileid aussprachen.
Am selben Tag wurden die herzogliche Flagge über dem Kastell eingeholt und das kaiserliche Banner gehißt. Christine hatte dem Land keinen Erben geboren. Der gekrönte Doppeladler wehte im Herbstwind. Mailand wurde ein Teil des habsburgischen Reiches.
Es wurde Winter.
Christine war in Mailand. Sie bekam keinen Bescheid, wohin ihr Weg führen sollte. Der Kaiser schwieg, und sie saß da, schwarz gekleidet und ohne Funktion, ein Symbol der Trauer, aber auch ein Sproß der Hoffnung für die Bevölkerung.
Als der Reif die Hausdächer weiß überzog, tauchten Pläne auf, Christine rasch wieder zu verheiraten. Sie hörte eine Reihe von Namen möglicher Ehekandidaten, viele davon noch Knaben und ihr ebenso unbekannt wie einst der Herzog.
Als endlich der Frühling kam, als der Po wieder über seine Ufer trat und sich an den Weinstöcken die ersten Schößlinge zeigten, marschierten die Franzosen südwärts, um das Herzogtum zu erobern.
Der Frieden war verloren, Mailands Hoffnung begraben, und Christine blieb nichts anderes übrig, als den Kaiser in ihren Briefen um seine Befehle zu bitten. Doch häufig waren die Briefe lange unterwegs oder kamen nie an, weil der Kurier ausgeplündert oder von Wegelagerern ermordet wurde. Sie empfing Verwandte, die vor den Schrecken des Krieges flohen, der Kaiser rückte vor in die Provence, während das Land hinter ihm verwüstet wurde, und in der Stadt Mailand herrschten nur die Angst und der Lärm spanischer Offiziere und deutscher Landsknechte, die sich auf eine Belagerung vorbereiteten.
Mitten in die Stille wurde Christine von der Vergangenheit eingeholt. Sie hatte von dem Krieg um Dänemark gehört, von Bürgern und Bauern, die aufstanden und forderten, daß man ihren gefangenen Vater wieder auf den Thron setzte. Dorothea war jetzt verheiratet, sie hatte einen Mann, der den Erbanspruch seiner Frau einforderte. Der Pfalzgraf griff aktiv in den Krieg in Dänemark ein.
Christine wurde schwindlig vor den Augen. Sie sah sich in Kopenhagen ankommen, um ihre Schwester Dorothea, die Königin von Dänemark, zu besuchen. Ein Traum kehrte zurück, der Traum von dem Land weit oben im Norden. Vor dreizehn Jahren hatte sie es verlassen, sie besaß keine Erinnerung, nur den Geruch nach geteertem Holz auf einem großen Schiff empfand sie ab und zu. Der verräterische Onkel ihres Vaters war tot, sein Sohn nannte sich Christian III., König von Dänemark, aber Kopenhagen hatte vor ihm die Tore geschlossen, und die Lübecker unterstützten ihn. Der Kaiser versprach Hilfe, ihre Tante rüstete eine Flotte aus, und all das sollte Dorothea und ihren Mann auf den Thron des Nordens setzen. Doch auch Schilderungen von den Leiden der Menschen in der belagerten Stadt erreichten Christine. Sie fühlte Mitleid mit dem Volk ihres Vaters, und Christines Meinung über den Vater änderte sich. Unbewußt übernahm sie seine Auffassung von den Bürgern und Bauern als den treuen und loyalen Stützen des Fürsten und dem Adel als dem betrügerischen, machtgierigen Erbfeind.
Als sie im Spätsommer die Nachricht von der Kapitulation Kopenhagens erhielt, war sie zugleich enttäuscht und erleichtert. Sie mußten nicht alle sterben, die guten Menschen dort oben.
Christines Zeit in Mailand neigte sich dem Ende zu, und sie war keine Italienerin mehr. Sie sollte zurück auf den habsburgischen Hof in den Niederlanden, fand aber auf einmal kein klares Verhältnis mehr zum Hause Habsburg. Es kam ihr vor wie ein mit falschem Maß genähtes Kleid. In den wenigen Monaten ihres letzten Sommers auf der Zitadelle wurde ihr klar, daß ihre früheste Kindheit aus mehr bestand als geteerten Schiffsplanken. Sie spürte ihre Wurzeln, ihren Ursprung, etwas, worauf sie stehen konnte. Christine wurde fünfzehn Jahre.
Im November endete der Krieg zwischen dem Kaiser und Frankreich. Die beiden Monarchen unterschrieben einen weiteren Waffenstillstand, und Christine erhielt Bescheid, die Stadt zu verlassen und für den Winter nach Pavia zu gehen. Als letzte Handlung in ihrer Eigenschaft als Mailands Herzogin hielt sie eine Gedenkfeier ab für ihren verstorbenen Mann. Dann kam die Abreise, das Verabschieden von Menschen, die ihr vertraut geworden waren, und von diesem Volk, das so viel Schönheit hervorzubringen vermochte. Da standen sie und warteten furchtsam auf die Zukunft unter einer fremden Herrschaft.
Mit einer kleinen Schar von italienischen Sekretären und Hofdamen zog sie nach Pavia, um auf neue kaiserliche Befehle zu warten.
Aber noch ein norditalienischer Winter verging, noch ein Frühling und noch ein heißer Sommer, ehe die Anordnung zur Fortsetzung der Reise erfolgte.
Es regnete in Strömen, als Christine am 15. Oktober Pavia verließ, und der Tag brachte einen letzten Abschied. Graf Stampa mußte zurückkehren nach Mailand, er befand sich unter spanischem Kommando, und für Christine war es ein seltsames Gefühl, endgültig von dem Mann Abschied zu nehmen, der vor dem Altar in Lille an ihrer Seite gestanden hatte. Er war der engste Vertraute ihres Mannes und der, der sie in ihren zwei Jahren als Witwe informiert hatte. Sie wußte, welche Hoffnungen er mit ihrem Kommen verknüpft hatte. Sie hatten sich nicht erfüllt. Seine Landsleute hatten ihre Selbständigkeit verloren, und ehe er sich ein letztes Mal verbeugte, meinte sie Wehmut in seinem Blick zu erkennen, das erste und einzige Anzeichen von Gefühl hinter der steifen Fassade.
Mit einer unzureichenden Eskorte erreichte sie den Brenner, wo es zu schneien begann. Der junge Kapitän, der die Verantwortung für ihre Sicherheit trug, war nervös, es fehlte an Sold für die Soldaten, und man mußte mit Räuberbanden rechnen. Pferde und Maultiere wurden angetrieben, und erleichtert hörte sie endlich die Kanonen, die für die Herzogin Salut schossen. Sie hatten österreichisches Gebiet erreicht, wo man Geld für die Weiterreise beschaffen konnte.
Kurz vorher hatten sie zwei Kaufleute aus Genua getroffen. Sie waren von Norden, aus Deutschland gekommen und hatten auf ihrem Weg den Pfalzgrafen und seine Frau, die Prinzessin, mit großem Gefolge unterwegs in Richtung Heidelberg gesehen. Als erste Handlung in Innsbruck schrieb Christine an den Kaiser und ersuchte um Erlaubnis, den Reiseweg so zu legen, daß ein Besuch Dorotheas möglich wurde.
Die Schwestern fielen sich um den Hals. Kichernd erzählte Dorothea von ihrem neuen Leben, von Reisen, von Bergbesteigungen und von weiten Röcken, der neuen Mode. Und Pfalzgraf Friedrich fand gar kein Ende für die Gunstbezeigungen, die er seiner Schwägerin erwies, und die Begeisterung für seine junge Frau, die er vom Kaiser als Lohn für treue Dienste bekommen hatte.
Christine sah, daß ihr Schwager einmal ein schöner Mann gewesen war, doch seine Haut war schlaff, und der goldene Brokat betonte den Umfang seines Bauches. Er verwöhnte seine junge Frau maßlos, steckte die Hand in ihren Ausschnitt und pries mit lautem Getöse die köstlichen Freuden des Ehebettes. Immer wieder erzählte er von der Neujahrsnacht, als sein Bote aus Spanien mit der Nachricht zurückgekommen war und aus vollem Halse gerufen hatte: »Ich bringe meinem Herrn eine königliche Braut von Kaisers Gnaden und mit großzügiger Mitgift.«
So vergingen die Tage in diesem November in Heidelberg, und Christine begriff allmählich, so zufrieden Friedrich auch mit seiner Dorothea war, so bestand die Gnade des Kaisers nur aus leeren Versprechungen, und die Mitgift, den dänischen Thron, durfte er sich selbst holen.
Es sollte gefeiert werden. Christine würde über Weihnachten bleiben, nichts war gut genug, schön genug, teuer genug – Geld war etwas, das man sich leihen konnte. Die Reiche des Nordens gab es nach wie vor, dieser Herzog Christian, der sich König nannte, saß nur locker im Sattel. Es war nur eine Frage der Zeit, dann würden Friedrich und Dorothea König und Königin von Dänemark sein, und ein weiteres üppiges Bankett würde zu Ehren von Christine abgehalten werden.
Aber sie mußte weiter. Sie wurde zum Aufbruch gemahnt, ihre Tante erwartete sie in Brüssel.
Am letzten Tag war Christine endlich allein mit ihrer Schwester. Dorothea erzählte, wie unglaublich glücklich sie in ihrer Ehe sei, und sie lachte und lachte, biß sich aber nicht mehr mit den spitzen Zähnen auf die Lippe, um sich zu beherrschen. Die tiefe Vertrautheit, die einmal zwischen den Schwestern geherrscht hatte, war verschwunden. Es gab Dinge, die nicht ausgesprochen wurden.
Als der Abschied kam, vergoß Dorothea keine Tränen wie seinerzeit in Brüssel. Sie stand nur still neben ihrem ältlichen Ehemann, dessen Bauch wie eine blanke, gelbe Sonne vorstand, und ihr Gesicht war merkwürdig blaß unter ihrem hellen, gekräuselten Haar. Fackeln erleuchteten an diesem frühen Morgen den Schnee um das kurfürstliche Schloß und ließen Dorothea trotz ihrer weiten Röcke noch zerbrechlicher erscheinen.
Von Heidelberg ging die Reise zuerst den Rhein abwärts bis Köln. Von dort nahm man den Landweg über Aachen, Kleve und Maastricht.
Am 18. Dezember 1537 stand die Regentin, umgeben von ihrem Hofstaat und sämtlichen ausländischen Gesandten, in winterlicher Kälte bereit, die Herzogin von Mailand zu empfangen, die mit ihrem Gefolge in den Palast zu Brüssel einzog.
Christine war zurückgekehrt.