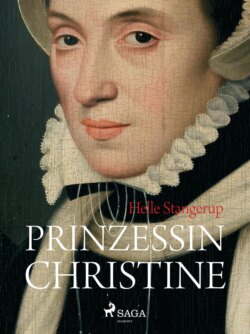Читать книгу Prinzessin Christine - Helle Stangerup - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel
ОглавлениеDie Sonne schien, aber es war erst Anfang März, die Luft noch kühl und feucht, und Christine war unglücklich, als sie am Palast von Mechelen ankamen. Niemand wußte, wann ihr Vater aus Sachsen zurückkehrte, wann er seine Länder zurückeroberte und den bösen Onkel vertrieb. Sie hatte ihren Vater lieben gelernt, und plötzlich war auch er weg. Die Tante sprach bei der Reise kaum ein Wort, neigte bloß den Kopf ein wenig, wenn Menschen am Straßenrand die Mützen vom Kopf rissen.
Im Innenhof gab es einen langen Gang mit weißen, dünnen Säulen, und in der Ecke bei der großen Treppe standen Diener, Zofen und Stallknechte. Christine wurde rasch abgesetzt.
»Kommt, kommt«, sagte die Tante und faltete ihre Hände, während sie die Kinder antrieb. »Jetzt zeige ich euch das Haus. Zuerst die Bibliothek, denn dort gibt es etwas, das euch gefallen wird.«
Während Diener in Samt und Seide Türen öffneten und schlossen, wurden Christine und ihre Geschwister in einen halbdunklen Raum mit Büchern, Handschriften und Gemälden gebracht. Mit einer weitausholenden Handbewegung deutete ihre Tante auf ein Bild und fragte: »Nun, Christine, wer ist das?«
»Das ist Mama«, antwortete sie mit tränenerstickter Stimme und schaute hinauf.
Ihre Mutter war die schönste Frau, die sie jemals gesehen hatte. Sie trug ein weißes Gewand, mit Perlen am Bund, einer Brosche und geschnürten Ärmeln. Locken fielen um das Gesicht.
»Ja«, sagte ihre Tante. »Und wer ist das, Dorothea?« fragte sie und wandte sich dem anderen Bild zu.
»Papa.« Mehr brachte Dorothea nicht heraus.
»Gut.« Sie legte Hans den Arm um die Schultern. »Eure Mutter ist im Himmel beim lieben Gott und euer Vater auf Reisen. Trotzdem sind sie hier, ihr könnt jederzeit hineingehen und sie anschauen. Und eure Mutter im Himmel und euer Vater auf seinen Reisen freuen sich, wenn sie wissen, daß ihr gehorsame, gottesfürchtige Kinder seid, die ihnen Ehre machen.«
»Ja, Madame«, sagten die Kinder mit winzigen Stimmen.
»Gut.« Die Tante ging schwerfällig durchs Zimmer und blieb stehen.
»Kommt, kommt. Es gibt noch viel mehr zu sehen.«
Sie wurden durch die anderen Räume geführt. Es gab Gobelins mit Motiven von David und Goliath und Jagdszenen und griechischen Sagen, die Kinder sahen Gemälde, große silberne Spiegel, riesige Kronleuchter und schließlich die Tiere.
Zuerst ein italienischer Windhund, und Christine sah ihre Tante lächeln, als sie sich bückte und ihn streichelte. Danach begrüßten sie die Vögel. Es waren Singvögel in großen Käfigen und Kakadus, die aus der Neuen Welt stammten, und schließlich der grüne Papagei. Die Tante erzählte von ihrem ersten Papagei, der gestorben war.
Er hatte drei Sprachen sprechen und auf alles antworten können. Er war sehr alt gewesen, denn er hatte schon bei der Mutter der Tante am burgundischen Hof gelebt. Dieser hier sei freundlich und genauso grün, aber leider nicht ganz so klug.
In Christines Zimmer hatte das Bett einen goldenen Vorhang, es gab Decken anstelle der Plumeaus, die sie gewohnt war, und am Abend kamen zwei Kammerzofen, um zu wachen.
Eine von ihnen schlafe immer ein, erklärte die Tante mit einem kleinen Lächeln.
Als Christine in ihrem Bett lag, war sie nicht mehr so traurig wie bei der Ankunft. Ihre Eltern waren tatsächlich da drinnen auf den Bildern, und sie war davon überzeugt, daß die Tante sie und ihre Geschwister liebte. Trotzdem grübelte sie darüber nach, warum der liebe Gott einen grünen Papagei so lange auf der Erde leben ließ und ihre Mutter so jung sterben mußte. Das konnte Christine nicht begreifen, aber weil sie nach der langen Reise sehr müde war, schlief sie bald ein.
Der Alltag am Mechelner Hof begann. Sobald die Kinder von der Messe kamen, fingen sie mit dem Lateinischen an, dann folgte Französisch, Bibelkunde, Geschichte, Geographie und Mathematik. Sie mußten gutes Benehmen lernen, tanzen und reiten. Ohne Rücksicht auf das Wetter waren sie jeden Tag draußen. »Frische Luft härtet ab«, erklärte ihre Tante und gewährte keine Ausnahme, wenn der Schnee auf ihren Wangen brannte und die Kanäle zufroren.
Für Christine und ihre Geschwister war jede Stunde des Tages fest verplant. Von morgens an hatten sie Aufgaben zu erledigen, bis sie erschöpft und mit roten Wangen abends einschliefen.
»Freie Stunden führen nur zu Mißmut«, meinte ihre Tante, aber eine Stunde Spielen war auch festgelegt.
Sie saß dann auf ihrem Stuhl und beobachtete die Kinder mit schweren Augen unter dem weißen Schleier. Sie schaute ihnen zu, wenn sie mit den Tieren scherzten, auf dem Boden unter den Gobelins tobten, mit Pfeilen auf eine große Scheibe warfen oder die kleinen Heiligenfiguren aus Holz mit Blumen schmückten. Dick und breit, die Hände im Schoß gefaltet, lächelte sie nur, egal was sie anstellten und wie sehr ihre Kleider in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es war die Stunde, in der »alles erlaubt war«, und nur wichtige Ratsversammlungen und Reisen hielten sie davon ab, den Kindern zuzuschauen. Ihr Spiel, ihr Herumtollen und ihre kleinen Unfälle waren offenbar ebenso wichtig wie der Lateinunterricht in den eiskalten Morgenstunden.
Während dieser Zeit in Mechelen wurde Christine von vielen Menschen geprägt. Wenn sie nicht von der Tante beaufsichtigt wurde, kümmerte sich die Dienerschaft um sie. In jedem Raum hielten sich Zofen auf, und aus den Fenstern des Unterstocks hörte man das Schwatzen und Lachen von denen, die Essen zubereiteten, die einmachten, pökelten und Fische ausnahmen. Sie hörte die Dienstmägde, die mit der Wäsche beschäftigt waren, Mägde, die aus großen Gefäßen Kerzen zogen, und Stallburschen, die die Pferde striegelten. Die Hofdamen waren schweigsam und würdevoll, während sich die jungen Fräuleins, die sich am Hof aufhielten, um ihre Erziehung zu vervollkommnen, stets plaudernd durch Stuben und Säle bewegten.
Pagen verneigten sich vor Christine, Gouvernanten überwachten ihre Manieren, Lehrer ihre Ausbildung, Hofdamen ihre Kleidung, den Tanz und den Gesang. Aber enger als mit allen anderen Menschen war Christine mit ihrer Schwester verbunden.
Zwischen den beiden bestand nur ein Jahr Altersunterschied. Und weil Dorothea kleiner war, fühlten sie sich wie Zwillinge. Ihr Bruder Hans erhielt gesonderten Unterricht, weil er der Sohn war, der Erbe und außerdem älter. Dorothea zeigte nach außen hin ein heiteres Gemüt, obwohl sie im Grunde sensibel war. Der geringste Anlaß konnte einen Lachanfall bei ihr auslösen. Nachdem die Milchzähne ausgefallen waren und die neuen kamen, die bedauerlicherweise die Form von kleinen Zacken hatten, versuchten sowohl die Tante wie alle Hofdamen, ihr diese hemmungslose Heiterkeit auszutreiben. Sie sollte lernen, sich vorteilhaft zu benehmen, ihrer Umgebung gefällig zu sein, und die Zähne waren nicht das Hübscheste an ihr. Sie versuchte, sich zu beherrschen, und biß sich mit ihren spitzen Zähnen in die Lippe, während der ganze Kopf unter den hellen Locken bebte.
Durch Dorothea wurde Christine die Komik im Leben bewußt, Christine hingegen half ihrer Schwester in Latein, Theologie und Mathematik. Christine hatte eine sehr gute Auffassungsgabe, und sie half ihrer langsameren Schwester mit Verben und Formeln.
Beide Mädchen begeisterten sich gleichermaßen für die Äsopischen Fabeln, aber sie hatten nicht dieselbe Lieblingsheilige. Dorothea schätzte am meisten ihre Namenspatronin, die heilige Dorothea, die so sanft war, und das Rosenwunder, das geschah, als sie für Jesus, ihren Bräutigam, den Märtyrertod starb.
Christine bevorzugte die heilige Birgitta. Zum einen war sie nordisch und sowohl edel wie gerecht, eine Frau vornehmsten Geschlechts, zum anderen wußte sie, was in der großen Welt vorging. Gott zu veranlassen, einen Korb mit duftenden Äpfeln und Rosen im Februar auf die Erde zu schicken, war natürlich hübsch, aber so klug zu sein wie Birgitta, daß man von Herrschern und sogar vom Papst um Rat gefragt wurde, erschien ihr doch begehrenswerter.
Christine und ihre Schwester teilten Freuden und Sünden miteinander. Sie flüsterten sich ihre Geheimnisse zu, wie Dorothea in Abwesenheit der Tante in die Wasserschale des Papageis Rheinwein gegossen hatte, wie Christine mit ihrem Pfeil eine der Heiligenfiguren getroffen oder wie sie während der Messe über einen Mönch gelacht hatten, der so komisch aussah, weil seine Nase voller Warzen war. Sie beichteten es Pater Antonius. Vor ihm fürchteten sie sich nicht besonders. Er sagte nur, wieviele Kerzen sie anzünden sollten, schalt aber nie.
Es gab Menschen im Leben der beiden Schwestern, die sich nur verneigten und ihren Wünschen gerecht zu werden versuchten. Andere aber erfüllten die Mädchen mit Ehrfurcht und Respekt.
An oberster Stelle in ihrem Dasein stand natürlich Gott, zu dem sie morgens und abends beteten. Aber gleich unter ihm, nur ein kleines Stück darunter, war der Kaiser, von dem sie täglich hörten, ihn aber nie gesehen hatten.
Christines Geographiestunden waren besonders interessant, wenn sie auf dem großen Globus all die Länder zeigen durfte, über die der Bruder ihrer Mutter herrschte.
Er war Kaiser des deutsch-römischen Reiches, König von Spanien und Neapel und Herrscher der Niederlande, wo die Tante für ihn regierte. Und außerdem gehörten ihm die neuen Länder jenseits des Meeres, für die man den Globus drehen mußte.
Der Kaiser war gut, fast wie Gott, jedenfalls besser als alle anderen Menschen auf der Welt. Daß seine Macht so groß war und sich bis auf die andere Seite der Erde erstreckte, hing mit den Eltern seiner Mutter zusammen, mit König Ferdinand und Königin Isabella, die Kolumbus losgeschickt hatten, um den Seeweg nach Indien zu finden.
Der Gedanke, daß man früher geglaubt hatte, die Erde sei eine Scheibe, brachte Dorothea zum Lachen.
»Und wo sollte sie dann aufhören? Mit einem Gartenzaun?« Wie die Vorstellung von einer flachen Erde gab es in den vergangenen Tagen viel Komisches. Man wohnte damals wie in dem Palast gegenüber, mit Festungsmauern und ohne fließendes Wasser. Kaum jemand konnte lesen und schreiben, man konnte keine Bücher drucken, sondern schrieb sie mit der Hand, und die Wissenschaftler waren so unwissend, daß die beiden Mädchen über ihre Dummheit kichern mußten.
Ihr Bruder Hans war für Christine etwas ganz Besonderes. Manchmal nahm der Junge seine Schwestern liebevoll in den Arm, scherzte mit ihnen, lachte über das, was sie sagten, er war der ritterliche Beschützer. Er half, wenn es mit dem Lateinischen haperte, und verschwieg ihre kleinen Unfälle und auch das mit dem Papagei, der so besoffen war, daß er nicht richtig sprechen konnte, sondern wie verrückt im Käfig herumflatterte und mit seinen grünen Flügeln gegen die Stangen schlug, ohne daß die Hofdamen wußten warum.
Hans war ihr Freund, ihr Bruder. Sie vertrauten ihm und bewunderten ihn grenzenlos.
In den Geographiestunden hörte Christine auch von den nordischen Ländern. Sie wußte, wo sie lagen, konnte auf dem Globus daraufzeigen, hörte aber nichts von ihrem Vater.
Christine hatte ihn nicht vergessen. Wenn sie im Halbdunkel in der Bibliothek stand und zu seinem Gesicht hinaufschaute, war er für sie so lebendig und leibhaftig wie damals, als sie auf seinem Schoß gesessen, seinen Bart gespürt und den phantastischen Geschichten gelauscht hatte. Es gab Bären in Norwegen und Elche in Schweden, erinnerte sie sich dann, um es an dem Tag zu wissen, an dem er kam und sie heimholte. Ihr schien, als redete sie mit ihm, wenn sie sich in der Bibliothek aufhielt, sie vermeinte seine Stimme zu vernehmen, sein Lachen, seinen Schritt. Und hinterher, wenn sie den Raum verließ, fühlte sie sich gestärkt. Auch wenn er weit weg war – er beschützte sie vor Gefahren. Er war wie ein gewaltiger Felsen, und sie konnte mit den Händen Halt suchen und seine Kraft spüren.
Dorothea liebte den grünen Papagei. Er mußte aus Deutschland stammen, denn er sagte immer »Jawohl, gnädige Frau«, und Französisch war ihm einfach nicht beizubringen.
Ein wenig erfuhren die Schwestern auch über das Leben außerhalb des Palastes. Das meiste erzählte ihnen Johanne, obwohl Johanne ihrer Stellung gemäß nicht mit den königlichen Fräuleins verkehren durfte.
Es begann an dem Tag, an dem Dorothea über den Arkaden Spatzen fütterte. Sie lehnte sich immer weiter hinaus, unvorsichtig wie sie war, und Christine stieß einen Schrei aus, als sie ihre Schwester aus dem offenen Fenster verschwinden sah.
Doch unten auf dem Hof mußte eine von den Weibsleuten vorausgesehen haben, was geschehen würde, denn sie ließ den Korb mit der Bettwäsche fallen, breitete ihre dicken Arme aus, fing Dorothea und setzte sie zwischen zwei Säulen ab, indem sie ausrief: »Die Dummen haben das Glück.«
Die Regentin ritt gerade mit ihrem Gefolge auf den Hof, ohne jedoch etwas von Dorotheas Vergehen zu bemerken, denn ebenso schnell, wie die Frau zugriff, glättete sie Dorotheas Schnürleibchen und schob die Haube zurecht.
Diese Frau war Johanne, und die Mädchen vergaßen ihr nie, wie sie geholfen hatte. Johanne war für die Wäsche verantwortlich, gehörte aber, obwohl sie einige Mägde unter sich hatte, zu den Weibsleuten und nicht zu den Damen, und daran ließ sich nichts ändern.
Beim ersten Mal kamen sie heimlich zu ihr und gaben ihr zwei Apfelsinen, doch später wurden sie mutiger und redeten mit ihr, und im Gegensatz zu all den anderen antwortete Johanne auf ihre Fragen. Sie erhielten die Erlaubnis, daß Johanne sich um ihre Zimmer und die Kleidung kümmerte, und auf diese Weise zog Johanne aus dem Unterstock herauf zu den Fräuleins, und in der Gesindestube bekam sie einen feineren Platz und aß mit der Beschließerin an einem Tisch, auch wenn sie natürlich am untersten Ende saß.
Johanne kümmerte sich nicht nur um die Kleidung, sie konnte auch erzählen, und durch sie eignete sich Christine ein Wissen an, das sie nicht in der Schulstube erwarb. Johanne erzählte von »damals«, und das waren die Jahre, als sie auf einem kleinen Bauernhof im nordwestlichen Brabant gelebt hatte. Sie hatte fünf Kinder zur Welt gebracht, zuerst drei Knaben, und dann hatte Gott sie mit den Mädchen gesegnet, alles gesunde und wohlgestaltete Bälger. »Damals« handelte von Kirchweihfesten und Hochzeiten, bei denen auf dem Dudelsack gespielt wurde, handelte davon, wie man eine Kuh molk, wie eine Mühle von innen aussah und wie man auf dem Viehmarkt feilschte, »damals« war aber auch, »daß Gott gab. Und Gott nahm.«
Im Jahre des Herrn 1520 kam die Pest. Das erste Mädchen erkrankte am St. Valentinstag. Binnen einer Woche war sie tot, und ehe der Monat vorbei war, hatte die Pest auch den Vater und die vier anderen Kinder genommen. Der Totengräber starb und auch die Leute auf den anderen Höfen. Doch die Mutter schaffte es, ihre Familie in geweihter Erde zu begraben. Sie zog sie mit einem kleinen Schlitten dorthin, erst die eine kleine Leiche, dann die übrigen.
Christine und Dorothea waren entsetzt, und Johanne tröstete sie, denn wenn die Pest nach Mechelen kommen sollte, würde der Hof sofort an einen Ort verlegt, wo keine Seuche war. Der Kaiser hatte andere Schlösser, doch die Leute hatten keine anderen Häuser, wohin sie gehen konnten.
Johanne trieb sie nun zur Eile an, »Madame Dorothée« und »Madame Chrétienne«, wie sie immer sagte, obwohl sie kein Wort Französisch konnte. Es war keine Zeit mehr zum Erzählen, denn sie mußten sich für das Abendessen zurechtmachen.
Wenn die Tante mit ihnen speiste, passierte immer etwas Spannendes. Eine Truppe mit zahmen Bären oder Chorsänger und Musikanten aus England traten auf. Johanne wußte zu berichten, daß sie zuerst gewaschen wurden, denn sie stanken, und die Regentin wollte sie nicht in der Nähe ihres Tisches haben. Johanne meinte außerdem, daß die Regentin die Sonette des Königs von England mehr schätzte als den König selbst, aber das dürften sie niemandem sagen. Sie sahen Marionettentheater und Jongleure, und manchmal wünschte sich Christine, ihrem Vater einen Brief schreiben zu können. Wenn er zurückkommen und bei ihnen wohnen würde, wäre die Welt wunderbar und sie würde das glücklichste Kind der Welt sein, was sie schon beinahe war. Dann könnten sie auch wieder Dänisch reden, wie er es wollte, und er hätte teil an ihrem Leben in Mechelen.
Zwischen den Vorstellungen der Artisten und Musikanten gab es stets etwas Interessantes für sie. Florentinische Kaufleute kamen oft mit ihren erlesenen Seidenstoffen. Dann wurde eingekauft, und ihre Tante wußte genau, was kleidsam war, wie viele Alen man benötigte und wie viel man zugeben mußte, wenn sie wuchsen. Das war wichtig, und sie wurden ihrem königlichen Rang entsprechend ausgestattet, aber es gab auch keinen Grund, zu verschwenden.
Alle waren freundlich zu den Geschwistern. Die Adeligen redeten mit ihnen, das Gesinde und die Soldaten lächelten nur, zeigten aber, daß sie Christine und ihre Schwester Dorothea und ihren Bruder Hans mochten. Alle außer einer.
Das war Kiki.
Kiki war eine Zwergin. Aber Kiki war auch ein Wechselbalg. Jedenfalls bestand unter den Dienern und dem Gesinde am Hof Einigkeit, daß Kiki sicher einige Zoll größer geworden wäre, wenn sie nicht so viele Prügel bekommen hätte, die ihr den Rücken zertrümmerten.
Die Prügel waren entschuldbar, denn sie sollten die Unholde dazu veranlassen, Balg und Menschenkind noch einmal auszuwechseln. Aber das Gör mit seinen abstehenden roten Haaren war so häßlich anzusehen, daß die erlittenen Prügel kein Mitleid bei den Unholden erregten und die beiden Kinder blieben, wo sie waren. So wuchs Kiki bei den Menschen auf, obwohl sie in den Untergrund gehörte, während das richtige Kind ein kümmerliches Schicksal unter Unholden und anderem Pack fristen mußte und niemals wiedergesehen wurde.
Wo immer sie auch hergekommen sein mag, sie war früh von zu Hause fortgelaufen. Sie streunte einige Jahre herum und kam nach Antwerpen, als die Regierung anfing, sich um elternlose Kinder in den Straßen zu kümmern. Sie sollten in Asyle geschickt werden, wo sie die Möglichkeit hatten, lesen und schreiben zu lernen und anständige Bürger zu werden – bis zu dem Tag, an dem sie ihr Ende unter dem Beil des Henkers fanden.
Im Schutz der Dunkelheit wurde Kiki mitgeschleppt, als man sie aber näher betrachtete und merkte, daß sie weitaus älter als sechs, sieben Jahre war, meinte ein kluger Kopf, sie könnte der Regentin nützlich sein. Kiki wurde also an den Hof geschickt, als Geschenk der Stadt Antwerpen.
Das war Kikis Glück. Zum ersten Mal in ihrem Leben traf sie einen Menschen, der sie brauchen konnte, und das war die Regentin persönlich.
Kiki wurde zu der kleinen Fürstin gerufen, die sie bat, von ihrem Leben zu erzählen. Und obwohl Kiki vor Angst zitterte, erzählte sie alles, was sie gehört und gesehen hatte, wenn sie sich hinter Heuhaufen und Scheunentoren oder in Mühlen und Ställen versteckt hatte. In ihrem ganzen Leben hatte Kiki nur das eine gelernt: sich vor Prügel zu verstecken. Sie hatte sich angewöhnt, sich lauschend und beobachtend die Zeit zu vertreiben.
Die Regentin lachte, der schwere Kopf bebte unter dem Schleier, und je mutiger Kiki bei ihrem Erzählen wurde, um so mehr lachte die mächtige Herrin. Aber dann hielt die Regentin inne, sie faltete die Hände im Schoß und fragte diskret: »Was meinen die Bauern zu den Steuern?«
Sie hob den Blick, schaute prüfend in Kikis kleines, faltiges Gesicht, und Kiki lächelte glücklich. Endlich brauchte jemand ihre besonderen Fähigkeiten.
Von da an verließ Kiki den Mechelner Palast täglich bei Sonnenaufgang und kehrte erst zurück, wenn die Dunkelheit über die Stadt hereinbrach, und oft wurde wie hereingerufen, um der Regentin Bericht zu erstatten. Manchmal war es nur wenig, aber wenn Schauspieltruppen die Leute auf den Markt lockten und das Bier in Strömen floß, daß sich die Zungen lösten, konnte sie eine ganze Stunde oder länger über Hurereien, Diebstähle, Erbitterung wegen der Steuern und Getratsche englischer Kaufleute von Ereignissen am Hof in London berichten.
Die Regentin lauschte im Halbdunkel mit gefalteten Händen und geneigtem Kopf. Sie sagte nie etwas anderes als »Guten Abend, Kiki« und »Gute Nacht, Kiki«, verstand aber auf ihre Weise, Kikis Dienste zu belohnen, und Kiki hatte so manche Goldmünze im Futter eingenäht. Kiki war keineswegs der einzige Informant der Regentin, aber sie war die einzige, die im Palast wohnte und ihr direkt berichtete.
Kikis Fähigkeit zu hören, ohne gesehen zu werden, war unübertrefflich. Sie wußte, was außerhalb der Mauern vorging, wußte aber auch von allen Ereignissen in der engeren Umgebung des Hofes.
Kiki wußte, wer aus dem Krug mit den Oliven stibitzte und wer nach den Ölen der Regentin duftete, wenn die Herrin verreist war. Sie wußte sogar, was damals geschehen war, als der König von Dänemark von zu Hause geflohen war, um zur Wiedererringung seiner Reiche Verbündete zu werben.
An dem Tag hatte sich Kiki in einer der großen Truhen versteckt, und da lag sie, als die Regentin hereinkam und die Nachricht erhielt. Durch einen Ritz im Holz sah sie ihre Herrin so wütend werden, daß ihr Gesicht ganz rot anlief.
»Wozu hat er denn ein Heer?« fauchte die Regentin. »Was will er hier?«
Aber sie beherrschte sich und gab Befehl, daß ihre Nichte, die Königin von Dänemark, sowie die Kinder mit den ihrem Rang entsprechenden Ehren empfangen werden sollten. Es wurde festgelegt, wieviel der Aufenthalt der Landflüchtigen kosten durfte, und Kiki freute sich in ihrer Truhe, daß das für königliche Personen gar nicht viel war. Zweitausend Gulden jährlich für die Königin und fünfhundert im Monat für den gesamten Haushalt. Da würde Schmalhans Küchenmeister sein.
Um so mehr ärgerte sich Kiki, als die Regentin knapp drei Jahre später mit den Kindern in den Hof des Mechelner Palastes ritt. Was wollten die hier? Sie fühlte ihre Stellung bedroht, sie sah ihre Zusammenkünfte mit der Regentin gefährdet, und ihre bangen Ahnungen sollten sich bald erfüllen. Zwar bestand nach wie vor Bedarf an ihrem Wissen, aber die Goldstücke wurden weniger, die gnädige Frau widmete nun alle freien Stunden den drei Kindern eines landesflüchtigen Königs und einer toten Königin, als sei sie, Kiki, nicht von viel größerem Nutzen.
Die Regentin war nicht die einzige, die Kiki mochte. Auch der grüne Papagei hatte sie ins Herz geschlossen.
Wenn Kiki den Käfig öffnete, legte der Vogel den Kopf schräg, schaute sie mit einem Auge an, flog dann heraus und setzte sich direkt in ihr Haar.
Das einzige, was bei Kiki nie zu wachsen aufhörte, waren die Haare. Es wucherte um ihren Kopf herum wie eine gewaltige flammenrote Mähne, fiel über den verkrüppelten Rücken und hinunter auf den Boden wie eine Schleppe. Es war ein grotesker Anblick, wenn Kiki durch die Säle und Stuben und die Arkaden im Hof ging, das Haar wie ein lohender Umhang und der grüne Papagei wie eine Phosphorfackel obendrauf und unaufhörlich schreiend: »Jawohl, gnädige Frau. Jawohl, gnädige Frau ...«
Eines Tages hörte Kiki, wie zwei Diener höhnisch über sie lachten, und sie beschloß, ihnen einen Schreck einzujagen. Sie sprang zwischen Bierkrügen und Holztellern auf einen der Tische in der Gesindestube. Sie war jetzt mit ihnen in Augenhöhe und erklärte, daß sie kein Wechselbalg sei und auch nicht so klein, weil man sie geprügelt habe.
»Ich bin immer so klein gewesen«, sagte sie, »seit meiner Geburt.«
Sie blickte sich um, sah mit Genugtuung Diener und Mägde und anderes Gesinde an und sagte schlau: »Ich weiß nämlich noch, wie ich getauft wurde. Ich war erst eine Woche alt und so klein, daß ich in die ledergefütterten Handschuhe meiner Patin gesteckt wurde, als sie mit mir zur Kirche ritt. Ich erinnere mich bis heute an das Gefühl des warmen und weichen Lammfells.«
Als sie das gesagt hatte, stand das Entsetzen in den Augen der anderen, und sie genoß es. Sie starrten die Zwergin mit offenen Mündern an. Wenn ein Neugeborenes wußte, was geschah, konnte das nicht mit natürlichen Dingen zugehen. Ein Wechselbalg oder Kobold zu sein war eine Sache, aber eine Hexe zu sein war etwas ganz anderes. Kiki war sich der Gefährlichkeit ihrer Aussage bewußt, sicherte sich aber ab, indem sie der Regentin erzählte, wie gründlich sie alle zum Narren gehalten hatte.
Die Regentin lachte ihr schweres Lachen und wollte noch mehr über die Handschuhe hören und wieviel Fell in ihnen war. Und Kiki fühlte sich sicher, denn die Herrin fürchtete keine Hexen. Die Regentin fürchtete etwas anderes: Ketzer.
Kiki erkannte ihre eigene Bedeutung im Kampf des Kaisers und der Regentin gegen Lutheraner und Wiedertäufer. Auch wenn die Regentin wegen deren Hang, Stunden in Gesellschaft wertloser Kinder zu verbringen, keine Zeit mehr für sie hatte, so gab ihr ein deutscher Mönch mit seinen aufrührerischen Schriften genug zu tun.
Wenn Kiki aus dem Tor trat und sich unter die Leute mischte, spürte sie ihren eigenen Wert und fühlte sich sicherer als je in ihrem Leben. Und wer weiß? Wenn sie lange genug wartete, würde sie vielleicht ihren Platz bei der Regentin zurückerobern.
Kiki verstand sich auf Menschen. Sie sah ein, daß die Regentin nach zwei Ehen und einem toten Kind eine einsame Frau war.
Kiki bemühte sich, ihren Haß auf Christine, Dorothea und Hans zu verbergen. Sie wollte warten, um eines Tages so viel Macht zu bekommen, wie es sich niemand vorstellen konnte. Ihr ganzes Leben hatte Kiki nur Schlechtigkeit kennengelernt, nur Ungerechtigkeit, Prügel, Hunger und Kälte. Sie trug jetzt Seide, aber die kleinen Beine waren blau von den Erfrierungen, die sie erlitten hatte, als sie in den Rinnsteinen Antwerpens schlief, und der Körper war ein Klumpen. Sie hatte eine gestärkte Haube, aber unter der Haube war das Gesicht verschrumpelt wie altes Obst. Kiki wollte Macht haben, sie haßte alle Menschen, all die mit der glatten Haut und den großen, gesunden Körpern. Sie haßte die Kinder und am meisten Fräulein Christine, denn obwohl sie die Jüngste war, schoß sie in die Höhe.
Das ist schlimm, wie sie wächst, dachte Kiki an einem Oktobermorgen, während sie zwischen den Säulen stand und die Klauen des Papageis an der Kopfhaut spürte.
»Es hat aber auch noch niemand ihrer feinen Wange Gewalt angetan.«
Sie starrte auf das Mädchen, das auf ein Pferd gehoben wurde. Kiki sah die perlenbestickte Haube und die mit Wieselfell besetzten Ärmel, sie sah die bereits langen Beine des Fräuleins in die Steigbügel schlüpfen und wünschte sich innig, wirklich eine Hexe zu sein. Denn dann könnte sie Fräulein Christine in einen Zwerg verwandeln, nein, in ein Kriechtier, so haarig und scheußlich, daß jeder schreiend die Flucht ergreifen würde.
Aber Kiki war keine Hexe. Fräulein Christine ritt aufrecht hinaus aus dem Innenhof, und Kiki blieb hinter den Säulen zurück, während der Papagei über ihr sein »Jawohl, gnädige Frau. Jawohl, gnädige Frau ...« krächzte.