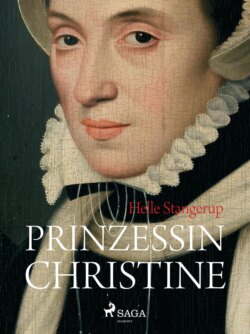Читать книгу Prinzessin Christine - Helle Stangerup - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Kapitel
ОглавлениеGerade als Christine auf ihr Pferd stieg, sah sie Kiki zwischen den Säulen stehen und starren. Sie beschloß, so zu tun, als merke sie es nicht. Christine verabscheute die Zwergin.
Nicht, daß ihr der Anblick von Kiki zuwider war. Christine erinnerte sich schwach daran, daß ihre Mutter einmal eine Zwergin gehabt hatte. Sie hieß Karine und konnte gut Purzelbäume schlagen. Und Hans hatte bereits seinen eigenen Zwerg, den sie alle mochten, weil er lustig war und kleine Dienste übernahm.
Doch jedesmal, wenn Christine Kikis rotes Haar über die Steinfliesen wischen sah, lief ihr ein Schauer über den Rücken. Kiki war das einzige Lebewesen, das Christine nicht ausstehen konnte.
Kikis starrende Augen waren für Christine so unerträglich wie die stummen, drohenden Blicke, die ihr bei dem Begräbnis der Mutter gefolgt waren. Kalt lief es ihr über den Rücken bei Kikis Blick und dieser aufdringlichen Neugier. Wenn Christine den roten Schopf hinter einer Tür hervorlugen sah, das verstohlene Tappen der kleinen Schritte in den Gängen verklingen hörte oder eine Truhe öffnete, aus der ihr das zahnlose Grinsen eines runzligen Gesichtes entgegenstarrte, fühlte sie sich wie von einer kalten, schleimigen Schlange umfangen.
Als Christine durch das Tor ritt, vergaß sie Kiki. Es war ein klarer, schöner Herbsttag, und sie spürte den muskulösen Rükken des Pferdes unter sich. Daß sie dieses starke Tier beherrschte, Richtung und Tempo bestimmte, erfüllte das Mädchen mit Stolz. Sie war beinahe neun Jahre alt, und jeden Tag erschloß sie sich die Welt um sich herum ein bißchen mehr. Sie wurde größer und schöner, und an diesem klaren Morgen, wo sich das erste Laub auf das Wasser der Kanäle legte, breitete sie die Arme aus, als wollte sie die ganze Welt umarmen.
Nach dem Ausritt mußten Kleider anprobiert werden. Schon bald sollte sie an einem Bankett teilnehmen, und während Johanne und die Hofdamen zuschauten, wieselten die Schneider um Christine herum. Als sie schließlich an sich hinuntersah, lächelte sie entzückt beim Anblick des goldenen Übergewandes. Die Ärmel fielen lang und weit, und der Samt bauschte sich bis zu dem schmalen geklöppelten Bündchen am Handgelenk. Ihr Haar war vorne in der Mitte gescheitelt, zurückgekämmt und von einem feinen, perlenbestickten Netz umhüllt. Schade nur, daß sie nicht nach der neuesten Mode die Taille betonen durfte. Die Damen erklärten, daß die Regentin das ausdrücklich untersagt hatte, weil sie es für ungesund hielt, besonders für ein so junges Fräulein.
Christine vergaß rasch ihren Ärger und wandte sich Dorothea zu, die ihr grün-silbernes Gewand anprobierte.
Die Regentin saß unter einem mit Goldstickereien versehenen Baldachin, der eben als Geschenk des Dogen eingetroffen war, und sie trug wie immer ihre schwarze Witwentracht. Zu ihrer Rechten saß Prinz Hans und zu ihrer linken Seite der Kardinal, während sich Christine und Dorothea noch mit einem Platz am Tisch der Hofdamen begnügen mußten.
Draußen fegten die ersten Herbststürme über das Land, und obwohl der Palast neu und stabil gebaut war, zog es gräßlich im Saal. Zwar brannten das Feuer im großen Kamin in der Mitte und entlang der Wände Fackeln, doch die Flammen flackerten unruhig, sie gaben nicht genug Wärme, vermochten die Kälte vom Boden her nicht zu verdrängen.
Obwohl das Pelzfutter bis zum Hals und über die Arme reichte, fror Christine. Sie hörte, wie die Fenster bei jedem Windstoß knackten. Aber in die Gläser wurde Rheinwein geschenkt, und der wärmte. Die fetten Karpfen waren aufgegessen, ebenso das Nußsorbet, und vor ihren Augen zeigte der Vorschneider seine Kunst.
Der junge Mann hielt die Wildschweinkeule auf einer Tranchiergabel in die Luft, während er umständlich mit dem Messer das Fleisch zerlegte.
»Weiter oben«, rief die Regentin streng, »und mehr Schwung mit dem Messer.«
Die Regentin wandte sich an den Kardinal: »In Toledo habe ich mal einen Vorschneider erlebt. Es war ein Vergnügen, ihm zuzusehen.«
Der Kardinal beugte sich vor, lächelte liebenswürdig und sagte: »Man hat mir erzählt, daß nicht einmal der König von Frankreich einen finden kann, mit dem er zufrieden ist.«
»Und der König von England?« fragte sie.
»Ich glaube ...«
Der Kardinal zögerte, ehe er fortfuhr: »Ich glaube, der König von England hat andere Sorgen als seinen Vorschneider.«
Dann lutschte er seine Finger sauber, beugte sich zur Regentin und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Und während Christine spürte, wie die Kälte die Beine heraufkroch und der Sturm immer stärker wurde, hörte sie ihre Tante antworten: »Ach so.«
Für einen Augenblick war es still, der Mundschenk füllte die Gläser, und dann sagte die Regentin: »Ich habe allerdings gehört, daß der König der Hure überdrüssig geworden sein soll.«
Der Kardinal schüttelte bekümmert den Kopf, alle anderen schwiegen und lauschten, und Christine bewegte die Füße in den Samtstrümpfen, während ihre Tante fortfuhr: »Ihre Schwester war einmal in meiner Obhut, das ist viele Jahre her, aber schon nach kurzer Zeit wurde sie zur Erziehung an den Französischen Hof geholt.«
»Und diese ...«
Sie holte tief Luft. »Und diese Anna Boleyn ist auch dort aufgewachsen, und das lernt man also an diesem Ort.«
Der Kardinal saß mit offenem Mund da, während die Regentin gebieterisch eine Hand hob. »Ich weiß, wir haben jetzt Frieden mit den Franzosen, aber ich bin eine alte Frau, und mir steht eine Meinung zu, und diese Boleyn-Mädchen sind ein Pack.«
Sie drehte ihr Gesicht dem Kardinal zu: »Der König hat ja die ältere inzwischen satt, wann wird er wohl genug davon haben, mit der Jüngeren zu huren?«
Christine hörte auf, mit den Zehen zu wackeln, denn da war wieder das Wort, das sie nicht richtig verstand.
Der Kardinal sah bedrückt aus und antwortete so leise, daß Christine es nicht hören konnte. Außerdem kam Bewegung in die Diener, der Braten war gegessen, die Teller wurden hinausgetragen und für das Geflügel andere hereingebracht. Die Wacholderzweige, die in die Flammen geworfen wurden, verbreiteten einen würzigen Duft. Die Fackeln flackerten immer noch und warfen Muster aus Licht und Schatten auf die Gobelins und die rot verputzten Wände, als die Stimme des Kardinals erklang: »Man befürchtet, daß der König sie heiratet, falls sie schwanger wird. Das ist kein Traum mehr, das ist Besessenheit. Der König von England will einen Sohn haben.«
Die Stimme der Regentin klang weich: »Aber er hat doch eine fromme und tugendhafte Tochter, die überdies volljährig ist.«
»Nur ein Prinz ...« Der Kardinal nahm ein Stück Ente. »Nur ein Prinz kann Englands Zukunft sichern.«
Er stopfte das Fleisch in den Mund, erkannte die Stille und sagte, so deutlich er es mit vollem Mund vermochte: »Meint jedenfalls der König von England.«
Während Christine damit kämpfte, die Finger in die Soße zu tauchen und so zum Mund zu bringen, daß ihr nichts davon in den Ärmel lief, sagte die Regentin scharf: »Kastilien hat eine Frau als Erbe übernommen, und meine selige Mutter erbte Burgund, und im übrigen ...«
Die Regentin lächelte und legte ihre Hand auf den roten Ärmel des Kardinals: »König Heinrich VIII. verdankt schließlich die Krone seiner Mutter, Elisabeth von York. Wer ist schon dieser Richmond?«
Beim letzten Satz erstarrten alle am Damentisch, der englische Gesandte saß nur fünf Plätze von der Regentin entfernt und hatte jedes Wort gehört.
Es wurden nun riesige Schüsseln hereingetragen, gefüllt mit glasierten Früchten, Apfelsinen und Pfirsichen, aus Spanien gekommen, Bananen, Datteln und Feigen aus Nordafrika. Doch alle Blicke waren auf den kleinen Engländer gerichtet, der einfach weiteraß und keine Reaktion auf die Beleidigung zeigte.
»Der Kaiser würde Prinzessin Mary von dem Tag ihrer Thronbesteigung an seine volle Unterstützung gewähren«, bemerkte die Regentin.
»Darüber hegt mein Herr König nicht den geringsten Zweifel«, antwortete der Engländer und ließ den letzten Entenknochen in die Soße plumpsen. Er wischte sich den Mund ab und griff nach den Früchten.
»Und der König von England freut sich natürlich über diese Unterstützung«, erkundigte sich die Regentin. Der Engländer lächelte vor sich hin.
»Euer Gnaden können versichert sein, daß mein Herr alle Freuden, die ihm das Leben beschert, zu schätzen weiß.«
Es herrschte völlige Stille. Der Engländer genoß eine Dattel, leckte seine Zähne und ersuchte darum, einen Toast auf den Kaiser ausbringen zu dürfen. Die Regentin lächelte plötzlich, gestand dem Engländer diese Ehre zu, und man plauderte entspannt.
Die Mahlzeit neigte sich dem Ende zu, und Christine ließ sich all die neuen Eindrücke durch den Kopf gehen. Vieles von dem, was gesagt worden war, verstand sie nicht, spürte die scharfen, fast unfreundlichen Untertöne, fand das aber aufregend. Sie fühlte sich jetzt erhitzt vom Wein und auch ein bißchen müde vom langen Sitzen bei Tisch. Aber für den nächsten Morgen, wenn sie frisch und ausgeruht war, nahm sie sich vor, über jedes Wort nachzudenken, das sie an diesem Abend gehört hatte.
Am nächsten Morgen hatte sich der Sturm gelegt. Am Vormittag trat die Regentin in die Scherben eines zerbrochenen Kristallbechers und mußte sofort zu Bett gebracht werden, um ernsthafte Blutungen zu vermeiden. Der Hofarzt sah nach ihr. Seiner Meinung nach bestand keine unmittelbare Gefahr, trotzdem wurden alle Geräusche in dem großen Haus gedämpft, und nicht einmal Dorothea fand etwas, worüber sie lachen konnte.
Am folgenden Tag kam eine Blutvergiftung dazu. Die Regentin wurde zur Ader gelassen, was aber ihren Zustand nicht verbesserte, ebensowenig wie die Kräuter, die vom Französischen Hof geschickt wurden. Fünf Tage kämpfte sie mit dem Tod, aber ihr Leben war nicht zu retten. Pater Antonius war bei der Kranken, die sich von allen verabschieden wollte, die ihr gedient hatten und die ihr nahestanden. Die Kinder wurden am Nachmittag hereingebracht, zuerst Hans, dann Dorothea und schließlich Christine.
Ihre Tante war so schwach, daß sie unfähig war, den Kopf vom Kissen zu heben. Sie hatte eine Nachtmütze auf dem stahlgrauen Haar und hob langsam eine Hand, legte sie Christine auf den Kopf und sagte: »Mein schönes Kind ...«
Ihre Stimme versagte, aber sie fuhr fort und rang um jedes Wort: »... der Kaiser wird sich um euch kümmern. Ihm sollt ihr stets gehorchen, und ...« Sie bewegte immer noch ihre dicke Unterlippe, aber es erklang nur noch ein schwaches Murmeln. Christine beugte sich zu ihr, Tränen liefen aus ihren Augen, und sie küßte die Hand der alten Dame, während sie flüsterte: »Ja, Madame.«
Am selben Abend, dem 30. November 1530, starb Margarethe von Österreich, Regentin der Niederlande und Christines zweite Mutter.
Im ersten Augenblick dachte Christine nur daran, wie Gott bloß Platz fand für all die Menschen, die er zu sich nahm. Dann läuteten die Kirchenglocken.
Die Nachricht vom Tod der Regentin verbreitete sich in der ganzen Stadt und zur nächsten und nächsten, Kuriere wurden in alle Welt geschickt. Es ging von Mund zu Mund, von Kirchturm zu Kirchturm, und Christine begriff auf einmal, was geschehen war. Ihre Tante war so klein, wie sie da in dem riesigen Bett lag, umgeben von weinenden Damen und Ärzten und Pater Antonius, der darauf wartete, ihr die letzte Ölung zu geben. Sie war noch am Leben gewesen, als Christine ihre Hand geküßt hatte. Wie sehr hatte Christine aus nächster Nähe den Tod und die Vergänglichkeit erlebt.
Christine wollte für sich sein, wollte sich verstecken hinter dem Vorhang ihres Bettes, um allein weinen zu können, aber die Damen warteten. Sie und die Schwester und der Bruder mußten zur Messe und folgten damit dem Wunsch der Verstorbenen, daß die Kinder keine freien Stunden haben sollten, die ohnehin nur zu Mißmut führten.
Am nächsten Tag ging Christine in die Bibliothek. Es war jetzt Dezember und noch dunkler als vor beinahe fünf Jahren, als sie zum ersten Mal diesen Raum betreten hatte.
Christine stand mitten im Raum und fühlte sich gleichsam zurückversetzt. Sie hörte die Stimme der Tante, ihr »kommt, kommt« und wieder »kommt, kommt«, kurz und gebieterisch, aber auch voller Liebe, die ihre Tante nicht anders auszudrücken vermochte. Es war fast wie ein Signal, das man verstehen konnte, wenn man wollte. Die Tante hatte einmal vor vielen Jahren ein Kind gehabt, und das war gestorben. »Kommt, kommt«, flüsterte die Stimme aus der geschnitzten Holzvertäfelung, aus bleigefaßten Scheiben, aus den aufgereihten Buchrücken in den Regalen. »Kommt, kommt«, allumfassend, aber zugleich in seiner Zärtlichkeit einengend.
Die Stimme erklang von überall, nur ein Wort, das fast fünf Jahre grenzenloser Liebe enthielt. Christine war das vorher nicht bewußt gewesen. Immer hatte ihre Tante nur auf ihrem Stuhl gesessen und ihnen beim Spielen zugeschaut. Christine fühlte ein schmerzhaftes Stechen bei dem Gedanken, daß sie sich nie auf ihren Schoß gesetzt und die Arme um ihren Hals gelegt hatten, um ihr zu sagen, wie sehr sie sie liebten. Doch der Tante schien es genug zu sein, wenn sie ihr die Hand küßten, sie schien zufrieden, wenn sie nur dasaß, ihnen zuschaute und sich an die Laute des kleinen Kindes erinnerte, das einmal ihr eigenes war.
Christine dachte an die erste Begegnung mit dem Windhund und den Vögeln, eine Hundeschnauze in ihrer Hand, das Gekrächze eines Papageis, Laute von Tieren, die vielleicht nur angeschafft worden waren, um ihrer Herrscherin eine Stimme zu verleihen, die ihr selbst nicht zur Verfügung stand.
Aber das war vorbei, zu spät, weg für immer. Christine ahnte mit ihren neun Jahren, daß sie mehr verloren hatte als ihre Tante, daß die zärtlichen Augenblicke nie mehr wiederkommen würden.
Warum haben wir nie unsere Liebe zu ihr gezeigt? dachte sie in dem dunklen Raum.
Christine blickte nach oben. Sie starrte auf das Portrait ihrer Mutter. Das weiße Kleid erschien so lebendig in dem schwachen Licht, daß man meinte, es berühren zu können. Aber der Mensch war weg. Christine erinnerte sich nicht mehr an ihre Stimme, ihre Bewegungen, ihre Haut. Sie hing da oben an der Wand über dem Regal und war so tot, als habe sie nie gelebt.
In dem Dämmerlicht verwandelte sich Christines Mutter in eine Schutzheilige oder ein Fabelwesen oder in einen weißen Engel – gut, rein und erhaben über das irdische Leben.
Aber Christines Vater war wirklich. Sie erinnerte sich an die Falten in seinem Gesicht, sie erinnerte sich an den Bart und das Lachen und seine Stimme und seinen Schritt. Er war für sie da gewesen in der kurzen Zeit, die zwischen ihrer ersten und ihrer zweiten Mutter verging, und kein zweiter Vater folgte nach.
Wie er an jenem Nachmittag in der Bibliothek auf sie hinunterschaute, hatte sie den Eindruck, daß die melancholischen Augen zu einem Kopf gehörten, der von Vorahnungen erfüllt war. Sie wußte nichts von seinem Leben und was ihn so schwermütig machte. Er war da, lebte auf dem Bild wie in der Wirklichkeit, wo immer er auch sein mochte.
Die Glocken läuteten weiter, Hufschlag auf dem Kopfsteinpflaster, doch Christine spürte nur die Stille. Und das Gewissen regte sich in ihr, sie hatte Vaters Wunsch, die dänische Sprache nicht zu vergessen, nicht erfüllt. Sie und ihre Geschwister hatten sie vergessen, alles war weg, verloren wie die Erinnerung an ihre Wiege, ihre Rassel, ihren ersten Frühling. Christine versuchte ihn zu rufen, er solle kommen, heraustreten aus seinem Rahmen da oben, sie auf sein Pferd heben und mitnehmen heim nach Dänemark, wo das Volk jubeln würde, weil der richtige König zurückkehrte und seine drei Kinder mitbrachte.
Christine war in Gedanken weit weg, viele hundert Meilen nördlich, als sie ein Geräusch hörte.
Sie war im Nu hellwach, es klang wie ein Huschen. Sie schaute schnell nach beiden Seiten, aber da war nichts, und sie drehte sich ganz um.
An der Tür stand Kiki. Das letzte Tageslicht schien auf ihr kleines, runzliges Gesicht. Die Augen waren auf Christine gerichtet, wartend und abschätzig, bis ihre Hände in die Seide des Rockes griffen, ihn zur Seite hielten und sie sich langsam bis zum Boden verneigte. Sie war nur ein Bündel aus Seide mit einem Kopf obendrauf. Schließlich richtete sie sich auf und vollführte eine kleine Körperdrehung, als sei sie auf einer Bühne.
»Der König von Dänemark war hier in Mechelen, um Geld zu betteln.«
Ihre Stimme klang leise und heiser, und Christine starrte auf das mißgestaltete Wesen. Sie verstand nichts, war aber aus ihren Gedanken gerissen, als die Zwergin erneut den Mund öffnete: »Vierundzwanzigtausend Florin wollte er haben.«
Sie stand da, wartete auf eine Wirkung, fuhr dann nach einer Pause fort: »Er ist vor dem Kaiser im Staub gekrochen.«
Sie senkte die Stimme noch mehr, daß fast nur noch ein heiseres Zischen voller Genugtuung hörbar war. »Und hat sich vor dem Kardinal erniedrigt.«
Kiki leckte sich den Mund mit einer riesigen, roten Zunge und redete plötzlich sehr schnell, als müsse sie sich beeilen, etwas loszuwerden:
»Aber Euer Gnaden wußten, daß er auch Briefe an Freunde des Ketzers Luther schickte, und er wollte seine Kinder nicht sehen.«
Gespannt hielt sie den Atem an, stand mit offenem Mund da. Christine sah die rote Zunge in dem dunklen Schlund. Sie wußte, daß sie gehen sollte, in der Stille hörte man nur die Glocken. Aber war ihr Vater wirklich im Sommer hier gewesen, ohne sie zu sehen? Kikis Worte hallten in ihren Ohren wie dumpfe Stöße. Plötzlich wurde sie wütend: »Ich bin die Tochter des Königs, er würde nie herkommen, ohne mich zu sehen.«
Mehr konnte sie nicht sagen, die wenigen Worte hatten sie erschöpft, aber die Zwergin lachte. Es war ein klirrendes Lachen, wie eine Reihe Eiszapfen, die abbrechen und am Boden zerschellen. »Es war im Juni. Warum sollte er auch seine Kinder sehen? Er hatte sie ja an die Regentin verkauft. Um seine Rechnungen bezahlen zu können. Er hatte sowohl vom Begräbnis der Königin wie beim Kaufmann von Lier Schulden für ...« Die Zwergin verschluckte sich fast vor Lechen. »... für Rheinwein und Schweinebraten.«
Die Zwergin drehte sich vor Freude um sich selbst, stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Christine stand wie vor einer Mauer, in der sich lange Risse zwischen den Mauersteinen bildeten, die bald keinen Halt mehr hatten und über ihr zusammenstürzten. Die Mauer hätte beschützen sollen, jetzt taumelte Christine unter dem Zusammenbruch. Die Zwergin hielt in ihrer Umdrehung inne, stampfte noch einmal mit dem Fuß auf den Boden und sagte:
»Der König von Dänemark bevorzugte eine simple Dirne namens Dyveke für sich als Königin.« Und die Zwergin rief, sich bis zum Boden verneigend: »Wären es Dyvekes Kinder gewesen, er hätte sie nie verkauft.«
Christine griff nach einem Zinnleuchter auf dem Kaminsims, warf ihn nach der Zwergin, und als er Kikis Kopf traf, klang es wie Metall auf Stein. Aber Kiki lachte nur, dieses ausgestoßene Lachen, und blieb in ihrer verbeugenden Haltung am Boden.
»Den Schweden hat er die Köpfe abgeschlagen, und die Dänen wußten, daß sein Wort nichts wert ist.« Kiki richtete sich auf, reckte ihre kurzen Arme in die Luft und rief schrill: »Für Wein und Schweinebraten.«
Christine wollte sie fangen, aber Kiki war blitzschnell, als hätte sie ihre Flucht längst geplant. Sie sauste aus der Bibliothek, stieß einen letzten heiseren Schrei aus, ehe die Tür zuknallte.
Christine blieb einige Schritte vor der geschlossenen Tür stehen. Mit einem Ruck drehte sie sich um und ging so lautlos zurück, daß sie ihr Atmen hörte. Sie hob den Leuchter auf, trat näher, blieb stehen.
Sie hatte den Leuchter in der Hand, und der Vater blickte herunter zu ihr. Sie sah ihn vor sich in der Gaststube zu Lier, tafelnd mit Wein in großen Bechern und in den Schüsseln der Braten.
Sie stieß einen wilden Schrei aus, als sie den Leuchter mit aller Kraft auf sein Gesicht schleuderte.
Er fiel schwer zu Boden und kullerte ein Stück, das Portrait blieb unversehrt.
Christine lief hin, hob den Leuchter auf, wollte noch einmal werfen, als sie einen Laut vernahm. Ein Laut in ihrer Erinnerung, Metall und Porzellan, das in einem anderen Haus vor langer Zeit auf einem Steinboden zerschellt war.
Sie senkte langsam den Arm und blieb stehen. Schließlich stellte sie den Leuchter an seinen Platz.
Dann preßte sie ihre Hände an die Schläfen, als wolle sie all die Angst und die bösen Worte aus ihrem Bewußtsein massieren. Sie schwankte, wurde von Gefühlen erschüttert, die sie vorher nie gekannt hatte, und auf einmal war auch das vorbei.
Christine hörte wieder die Glocken und fernen Lärm von der Straße. Sie war erschöpft und müde. Noch einmal schaute sie hinauf auf ihre weiße Mutter und den dunklen Vater. Es war vorbei. Sie waren beide tot.
Im März 1531 ritt Kaiser Karl V. mit seinem riesigen Gefolge hinein nach Mechelen. Er wurde von unzähligen Menschen begrüßt, die an den Straßen standen und aus den Fenstern schauten, er wurde vor dem Rathaus empfangen vom Magistrat und dem Stadtrat und einem zwölfjährigen Knaben mit braunem, gelocktem Haar und aufgeweckten Augen.
Der Junge war Prinz Hans von Dänemark. Vor seinen zwei kleineren Schwestern stehend drückte er in einfachen Sätzen und formvollendetem Latein aus, welche Trauer ihn und seine Geschwister erfüllte, und bat um Erlaubnis, am niederländischen Hof bleiben zu dürfen, bis sein Vater seine Reiche wiedergewonnen habe.
Der Kaiser war tief gerührt. Er umarmte seinen Neffen und die Nichten, und wenn er ihnen auf der Stelle versprach, weiterhin in den Niederlanden bleiben zu können, traf er damit keinen schnellen Entschluß. Das hatte er nie in seinem Leben getan. Der Kaiser hatte längst die Person ausgewählt, die sich um die dänischen Kinder und die niederländischen Probleme kümmern sollte.
Das Land war geprägt von einer mangelnden Bereitschaft, Steuern zu zahlen, und einem zunehmenden Einfluß der Ketzerei. Außerdem mußte er sich den lästigen, ungebetenen Gast vom Halse schaffen, den König von Dänemark, der die nördlichen Provinzen mit Freibeuterei und Seeräuberei unsicher machte.
Wenn er in seinem gewaltigen Reich wieder auf die Reise ging, würde die Person, die besser als jede andere geeignet war, die Aufgabe zu lösen, bereit sein. Es war seine jüngere Schwester Marie, und sie befand sich bei der Ankunft in Mechelen in seinem Gefolge. Der Kaiser hatte Marie schon in früher Jugend bewundert, und im Laufe der Zeit wurde sie der einzige Mensch, dem er denselben Respekt entgegenbrachte wie der nun verstorbenen Tante. Die Lektionen, die für ihn so schwer zu verstehen gewesen waren, wurden von Marie mit Leichtigkeit einverleibt.
Marie war die Witwe des Königs von Ungarn, und sie sollte nun die Niederlande regieren, während er sich mit den Türken, den Franzosen, dem päpstlichen Stuhl und den deutschen Ketzern herumschlug. Karl V. stellte dem Stadtrat von Mechelen seine Schwester als die künftige Regentin vor.
Aber Marie hatte ihre eigenen Vorstellungen und Bedingungen. Sie drang darauf, daß ihr kein neuer Mann aufgenötigt werde, denn sie sei in ihrer ersten Ehe völlig glücklich gewesen und wolle keine neue eingehen.
Was auch immer sie damit meinte, der Kaiser beugte sich ihrem Wunsch.
Das nächste Problem waren die sogenannten »evangelischen Neigungen« von Marie, die der Kaiser nicht ernstnehmen konnte. Seine Schwester hatte stets gern Bücher gelesen und ließ sich leicht von neuen Ideen einnehmen. Doch sie hatte auch Erasmus und andere Humanisten studiert, und insofern war sie durchaus für die Aufgabe einer Regentin geeignet.
Sie stand zwischen zwei Gobelins im großen Saal des Rathauses, eine kleine, lebhafte, kinderlose Frau in schwarzer Witwentracht mit weißem Schleier, und der Kaiser war stolz auf seine Schwester. Aber dann kreisten seine Gedanken um das Problem mit dem König von Dänemark.
König Christian war eine Bürde. Er war eine Plage mit seinen Forderungen nach Geld und der Mitgift einer Frau, die längst gestorben war. Marie meinte, es wäre das beste, zu zahlen und ihn damit ein für allemal loszuwerden. Der Kaiser hätte gewünscht, daß Christian tot wäre. Und für ihn war er gestorben. Aber gleichzeitig mußte er sich dagegen verwahren, daß der Adel unehrenhaft dem Eid abschwor und einen König hinauswarf, um einen anderen zu krönen. Diese Art von Verrat konnte für die Fürsten ernste Folgen haben und durfte nicht zugelassen werden.
Je mehr der Kaiser überlegte, um so naheliegender schien ihm der zwölfjährige Prinz Hans als Lösung des nordischen Problems. Hatte der dänische Adel nicht einmal dem Wunsch Ausdruck verliehen, daß der Junge und seine Mutter in Dänemark blieben? Inzwischen war Elisabeth tot, aber der Prinz, der Erbe und rechtmäßige künftige Herrscher über die Reiche des Nordens, lebte. Er war in rechtem Glauben erzogen, vielleicht wollten ihn die Dänen immer noch. Und außerdem war der Prinz sein, des Kaisers, Neffe.
Der Kaiser betrachtete den ranken Knaben und strich ihm mit der Hand um das Kinn. Als Mensch empfand er beim Anblick des Jungen und seiner Schwestern Dorothea und Christine Wärme und Mitgefühl, doch als Kaiser ahnte er, daß ein Prinz, der die Fähigkeit besaß, sich im Alter von erst zwölf Jahren in fließendem Latein vorzustellen, auch größere Aufgaben würde meistern können.
Der Kaiser faßte ihm wieder ans Kinn und begann mit der schwierigen Kunst des Denkens.
Christine hatte ihre geliebte Tante verloren. Aber sie bekam eine neue. Die verstorbene Tante war die Schwester ihres Großvaters mütterlicherseits gewesen, die neue war die Schwester ihrer Mutter, aber schon am ersten Tag erkannten Christine und ihre Geschwister, daß eine völlig andere Tante vor ihnen stand.
Sie war schlank und jung, die andere alt und einnehmend. Sie zeigte ihnen keine Portraits, sondern fragte: »Wollt ihr mit auf die Jagd?«
Und dann stürmte sie los, um so rasch wie möglich hinunter zu den Pferden und den unten wartenden Höflingen zu kommen.
Wenn die neue Regentin der Niederlande ausritt, um Rotwild, Wildschweine oder Wölfe zu jagen, nahm es niemand mit ihr auf. Sie hielt es einen ganzen Tag im Sattel aus, ohne das geringste Zeichen von Müdigkeit zu zeigen, und amüsierte sich, wenn die Herren und Damen im Waldesdickicht und in den Dörfern nach ihr suchten. Langsam gewöhnten sie sich an den entfernten Anblick der schwarzen Kleider Ihrer Gnaden, die das Pferd umwehten, und wußten, daß sie stets als erste am Ziel und schneller als die anderen wieder zu Hause sein würde. Wenn die Begleiter ausgepumpt und erschöpft nach einem Tag im Sattel zurückkehrten, sagten sie zueinander, daß diese Reitlust der Herrin das Erbe der weiten ungarischen Flächen sei. Jedenfalls konnte es niemand mit Ihrer Gnaden auf dem Pferderücken aufnehmen. Die Kinder hatten eine so junge Tante bekommen, daß sie ebensogut ihre große Schwester sein konnnte. Sie setzte über Gräben, lenkte das Pferd in Kanäle und preschte in gestrecktem Galopp über aufgeweichte Äcker. Nichts konnte schnell genug gehen, nichts sie aufhalten. Für die Kinder war die Begegnung mit dem Kaiser ein besonderes Erlebnis, und sie empfanden es als ungeheure Ehre, als er den Arm um sie legte und seine Liebe ihnen gegenüber zum Ausdruck brachte. Natürlich hatte er Hans die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Christine und Dorothea waren stolz auf ihren Bruder, der eine Rede hielt, ohne steckenzubleiben. Sie würden auch gerne den Ratsherren, Adligen und Geistlichen frei und ehrlich Wünsche auf Lateinisch vortragen können.
Sie sahen den Kaiser in der Zeit, in der er im Lande war, nicht häufig, denn von ihrer neuen Tante wurden sie in ein turbulentes Leben hineingerissen. Wenn sich die Hofdamen darüber beschwerten, daß die Königin-Witwe gefährlich lebe, lachte sie unbeschwert, tippelte davon und sagte:
»Ich möchte mir nie vorwerfen lassen, auch nur eine Stunde auf dieser Erde nicht genossen zu haben.« Dann rief sie nach Monsigneur und Mesdames Dorotheé und Chrêtienne, ein Rudel Wildschweine sei im Wald beobachtet worden.
Das tägliche Leben ging weiter wie bisher. Dieselben Gesichter umgaben sie, nur Johanne jammerte jetzt über die zerrissenen Kleider der Mädchen nach den wilden Jagden.
Und Kiki war weg. Sie sahen sie nicht mehr. Am Abend nach dem Tod der alten Regentin verschwand sie spurlos, man hörte nichts mehr von ihr, und bald war sie von allen vergessen – nur von Christine nicht.
Christine hatte die Erinnerung an jene Szene in der Bibliothek verdrängen wollen. Aber die Worte der Zwergin ließen sich nicht aus ihrem Bewußtsein entfernen. Christine erzählte ihren Geschwistern nichts davon. Es war ihr Wissen und ihre Bürde, und daraus erwuchs für sie ein Gefühl, bestohlen worden zu sein, durch ein Unrecht der Wurzeln beraubt worden zu sein.