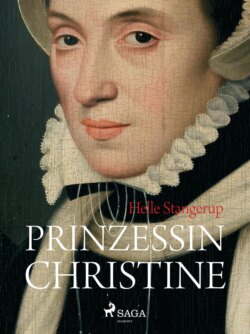Читать книгу Prinzessin Christine - Helle Stangerup - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Kapitel
ОглавлениеAn einem frostigen, klaren Januartag des Jahres 1532 wurde in Brüssel auf dem Platz vor dem Haus des portugiesischen Gesandten ein Turnier abgehalten. Die Königin von Portugal hatte einen Sohn geboren, und das sollte gefeiert werden.
Von einem mit weißem und grünem Samt verkleideten Balkon schauten der Kaiser und seine Familie den vielen Späßen zu. Christine lachte über die Ritter in ihren Rüstungen, die vom Pferd geworfen wurden, sie starrte mit großen Augen auf die Feuerschlucker und Schwerttänzer, und rund um sie klatschte das Volk vor Begeisterung. Der ganze Markt war voller Flaggen und Banner, und während die Trompeten gellend eine neue Attraktion ankündigten, beugte sich Hans zu ihr und flüsterte: »Ich habe eben erfahren ...« Er schielte zu seiner Tante und wandte sich wieder Christine zu: »Unser Vater ist vor einem Monat in Norwegen gelandet, die Norweger jubelten ihm zu. Sie haben ihren Eid auf ihn als ihren König erneuert.«
Bären kamen auf den Platz. Christine schaute starr vor sich hin, und Hans sagte: »Es ist wahr. Vater hat bereits eines seiner Reiche wiedererobert, und ich bin da oben erbberechtigt.«
Christine bewahrte ihren interessierten Gesichtsausdruck, sie war schon zu reif, um zu vergessen, wer sie war und daß sie die Pflicht hatte, die Fassung zu wahren. Sie war die Nichte des Kaisers und der Regentin, aber auch nicht mehr. Seit dem Tag in der Bibliothek vor mehr als einem Jahr versuchte sie zu vergessen, was sie über ihren Vater erfahren hatte. Der Mann, dessen Blut in ihren Adern pulsierte, hatte um des Geldes willen den Glauben gewechselt, er plünderte, bettelte, log und köpfte den schwedischen Adel, und er hatte eine gewöhnliche Dirne bevorzugt und seine eigenen Kinder verkauft. Innerhalb der habsburgischen Familie war sie geschützt wie unter einer warmen Decke, und sie versuchte, ihr »von Dänemark« zu vergessen.
Hans sollte die Länder zurückgewinnen, sollte sich die Krone des Nordens aufsetzen. Für Christine war Hans bereits der König von Dänemark. Sie lächelte ihm bewundernd zu, sagte aber nichts.
Am Abend fand ein Bankett im Schloß statt. In der Mitte der Tafel saß der Kaiser mit der Regentin auf der einen und Dorothea als der älteren Nichte auf der anderen Seite. Hans hatte seinen Platz zwischen der Regentin und Christine, neben der der portugiesische Gesandte saß, und vor ihr befanden sich die anderen Tische und der Kamin. Sie saß am vornehmsten Tisch, sogar Prinz René von Oranien, der gerade das Land seines Onkels geerbt hatte, mußte mit den Hofdamen speisen, obwohl er drei Jahre älter war.
Christine freute sich, daß sie den Portugiesen zum Lachen bringen konnte, und spürte eine Wärme, die nicht vom Wein kam oder vom Kamin, sondern von dem Gefühl, gemocht zu werden. Heimlich wünschte sie sich, daß ihr Vater sie hier sehen könnte. Dann würde er vielleicht erkennen, was er weggeworfen hatte. Aber sie durfte sich nicht vergessen, alle Blicke waren auf die gerichtet, die an so vornehmer Stelle saßen. Christine nippte am Rheinwein, bekam ein Lächeln von dem blonden René und setzte ihr Gespräch mit dem Portugiesen fort.
Um elf Uhr war das Bankett zu Ende. Es wurde eine italienische Komödie aufgeführt, und später kam das Buffet mit Wein aus Madeira und Valencia und süßen Kleinigkeiten, angerichtet in Schalen und Bechern aus Silber, Gold und Porzellan.
Das Fest anläßlich der Geburt des portugiesischen Prinzen dauerte eine ganze Woche. Tanz und Konzerte, Festessen und Vorführungen folgten hintereinander und erstickten die düsteren Gedanken in Christine.
Der Hof war jetzt umgezogen nach Brüssel, und eines Tages trafen Christine und Dorothea ein Mädchen in ihrem Alter namens Margarete.
Die Schwestern haten bereits erfahren, daß das ihre Kusine war, eine Tochter des Kaisers. Sie waren natürlich gespannt auf die Verwandte, wußten aber nicht recht, was sie von dem plumpen Mädchen halten sollten, das auf sie zu watschelte. Die großen Füße sahen unter den Röcken hervor.
»Ich bin Margarete, die Tochter des Kaisers«, war das erste, was sie sagte, aber dann sagte sie nicht mehr viel. Sie blieb vor ihnen stehen, als erwartete sie, daß irgend etwas passierte. Aber Dorothea fing nur auf ihre unartige Weise zu kichern an und fragte: »Warum hast du so viele Perlen um? Willst du dich malen lassen?«
»Ich bin gemalt«, antwortete das Mädchen ernst.
»Wirklich.« Dorothea biß sich mit ihren spitzen Vorderzähnen auf die Lippe, musterte dabei die Kusine von oben bis unten, als wollte sie die Edelsteine und Kostbarkeiten zählen.
Doch Christine beherrschte sich. Zum einen war sie von anderer Wesensart als ihre stets zum Lachen aufgelegte Schwester, zum anderen hatte sie großen Respekt vor dem Kaiser und vor allem, was mit ihm zusammenhing. Christine bemerkte durchaus die übertriebene Aufmachung der Kusine, im Brokatkleid an einem gewöhnlichen Vormittag, mit Perlen und Goldketten und Diamanten im Haar. Dahinter verbarg sich etwas, was Christine nicht verstand, und mit einem beginnenden Einfühlungsvermögen für ihre Mitmenschen beugte sie sich vor und fragte: »Hast du Lust, auszureiten?«
Endlich lächelte Margarete. Ihr Gesicht erhellte sich, und sie nickte erleichtert. Christine gab Anweisung, die Pferde zu satteln.
Als die Schwestern wieder allein waren, begann Dorothea sofort an allen Fingern zu rechnen: Der Kaiser hatte erst geheiratet, als ihre Mutter starb. Wieso konnte er dann eine Tochter haben, die genauso alt war wie sie? Zuerst heiratete man, dann bekam man Kinder, als ein Geschenk Gottes, falls Gott dazu bereit war und einen nicht leer ausgehen ließ, wie es ihrer Tante Marie passiert war.
»Wie konnte der Kaiser dann eine Tochter bekommen, wenn er damals mit niemandem verheiratet war?«
Christine zermartete sich das Gehirn nach einer Antwort. Sie legte sich quer übers Bett und starrte hinauf zu dessen Himmel. Plötzlich fiel ihr etwas ein:
»Und sie heißt nur Margarete. Nicht Margarete von irgend etwas.«
»Da ist etwas faul«, sagte Dorothea, »wir fragen Johanne.«
Johanne wollte nicht raus mit der Sprache. Sie drehte ihre Finger in der Schürze, wie sie es immer machte, wenn sie sich überrumpelt fühlte, aber Dorothea ließ nicht locker:
»Wie kann der Kaiser eine Tochter bekommen, wenn er nicht verheiratet war, als sie geboren wurde?« fragte sie störrisch.
»Das war ein Mißgeschick«, rutschte es Johanne ungewollt heraus, aber sofort schlug sie sich mit den Händen auf den Mund, so als hätte sie lästerlich geredet.
»Wir sagen es auch nicht weiter. Erzähl doch, bitte«, bettelte Christine.
Aber Johanne blieb mitten im Zimmer mit den Händen vor dem Gesicht stehen, schüttelte den Kopf und sagte kein Wort mehr.
»Margarete sieht auch aus wie ein Mißgeschick«, meinte Dorothea schelmisch, während sie die Arme um den Bettpfosten schlang.
»Fräulein Margarete«, sagte Johanne zurechtweisend.
»Margarete von was?« fragte Christine sanft und hatte das Gefühl, ihrer Schwester bei der Aufklärung dieser seltsamen Sache beistehen zu müssen.
Aber sie kamen nicht weiter mit Johanne. Dann fiel ihnen das mit dem Huren ein, auch wenn sie nicht wußten, was das Wort bedeutete, war es jedenfalls etwas Unrechtes und Verbotenes, was der König von England mit einer gewissen Anna Boleyn machte. Und besonders wichtig: Davon konnte man schwanger werden.
Die Schwestern zerbrachen sich den Kopf, aber weil Johanne nichts sagen wollte, wußten sie nicht, wen sie fragen sollten. Es blieb die seltsame Situation, daß der Kaiser eine Tochter hatte, die nicht die Tochter der Kaiserin war.
Vierzehn Tage später zog der Kaiser nach Regensburg, und er hatte Prinz Hans bei sich.
Es war kein Geheimnis, daß der mächtige Mann an der Gesellschaft seines Neffen Gefallen fand. Er nahm sich Zeit, mit dem Knaben zu reden, und die Neuigkeit, daß Prinz Hans an der Versammlung der Kurfürsten teilnahm, fiel zusammen mit einer anderen, eher gewöhnlichen Begebenheit.
Christine und Dorothea bekamen neue Strümpfe. Die Schwestern musterten sie zuerst verblüfft, denn sie waren nicht genäht, sondern gestrickt. Sie merkten rasch, wie angenehm das war ohne Nähte, besonders unter der Ferse, wo es immer scheuerte. Sie schmiegten sich um ihre Beine, ohne Falten und Knicke, und waren genauso warm wie die alten aus Seide, Samt oder Leder.
So saßen sie mit gespreizten Beinen da und bewunderten die neueste Erfindung, als ihre Tante das Zimmer betrat.
Schnell warfen sie die Röcke über die Beine, sprangen auf und verbeugten sich. Sie blieb einen Augenblick stehen, sah sie lächelnd an, schickte Johanne hinaus und erzählte von Hans.
Nach der langen Reise bis Regensburg war er sehr damit beschäftigt, die Kurfürsten zu empfangen, den Bischof von Mainz und andere Mächtige aus dem Deutschen Reich. Später setzte er sich vor der großen Versammlung beim kaiserlichen Rat für die dänische Sache ein. Er machte das so schön, daß alle ergriffen waren, und den Kurfürsten hätten Tränen in den Augen gestanden.
Die Mädchen waren tief beeindruckt und sprachen lange über Hans, der bereits den Schritt in die große Welt getan hatte.
An einem späten Abend Ende August hörte Christine einen Reiter auf den Hof des Palastes in Brüssel galoppieren.
Sie setzte sich auf, lauschte und sprang aus dem Bett. Die zwei Kammerjungfern fuhren von ihren Stühlen hoch, aber Christine beschwichtigte sie, öffnete das Fenster zum Hof. Sie sah das Pferd und den gekrönten Doppeladler auf der Satteltasche. Das war ein Kurier des Kaisers.
Als Christine wieder eingeschlafen war, wälzte sie sich unruhig mit wilden Träumen hin und her. Sie war mit ihrem Vater auf der Jagd, sie wollten in Schweden Elche erlegen, aber überall war es rot. Die Erde war aufgeweicht von Blut. Es wurde von den Wurzeln der Bäume aufgesaugt und färbte den Wald so rot wie die Erde, auf der sie standen. Ihr Vater hielt an, sprang vom Pferd und nahm von kleinen, grauen Männern ohne Köpfe Säcke mit Goldmünzen entgegen, wobei er Christine als Bezahlung nach vorne schob. Und sie starrte auf die roten Hälse, aus denen das Blut sprudelte, und vor ihr zogen sie bereits mit Hans davon. Sie sah, wie er auf eine Lichtung geführt wurde, wo mehrere kopflose Männer mit großen Beilen bereitstanden, und sie schrie und schrie und schrie ...
Christine schaute in Johannes rotbäckiges Gesicht, die Frauen standen furchtsam an der Tür. Sie bekam heiße Milch mit Kräutern, und später fiel sie in einen sanften Schlummer.
Am nächsten Vormittag wurden Christine und Dorothea zur Regentin gerufen. Die Kinder sahen ihre Tante an einem Fenster stehen. Sie kam ihnen entgegen, umarmte sie, und die Tränen liefen ihr übers Gesicht und in die schwarzen Falten des Kleides. Ihr Bruder Hans war bei dem schlimmsten Unwetter, dessen man sich in Regensburg entsinnen konnte, vom Fieber ergriffen worden. Nach einem mehrtägigen Kampf mit der Krankheit hatte sein junger Körper aufgegeben, und mit dem Namen Jesu auf den Lippen sei er verschieden.
Hans war tot.
Christine betete zu Gott. Sie kniete auf dem Steinboden und bat den himmlischen Vater, er möge sie begreifen lassen, warum er so viele und so vieles nahm.
Schließlich brachte man sie mit hohem Fieber zu Bett. Und sie war nur von dem einen Gedanken beseelt, dorthin zu kommen, wo ihre selige Mutter, ihr geliebter Bruder und die geliebte Tante waren.
Doch am vierten Tag erwachte sie und war fieberfrei. Eine kühle Herbstluft wehte ihr von den geöffneten Fenstern entgegen, es roch nach frischem Obst, und über die Gesichter um sie herum liefen Freudentränen.
Johanne schloß sie in die Arme und stammelte: »Gepriesen sei die Jungfrau für meine kleine Madame Chrêtienne.«
Ergriffen und völlig aufgelöst lief Johanne aus der Stube.
Christine lag in ihrem Bett und blickte sich zwischen Damastdecke und Vorhang um, während die frische Luft in Nase und Lungen drang und sie von dem unbändigen Willen erfüllt wurde, das Leben zu leben, solange Gott es wollte.
Erst lange nach Weihnachten, als das neue Jahr gekommen war und sie 1533 schrieben, erzählte die Regentin Christine und Dorothea in aller Ruhe von dem Schicksal ihres Vaters im vergangenen Sommer. Er hatte Norwegen verlassen und war im Vertrauen auf freies Geleit nach Kopenhagen gesegelt. Doch der Onkel brach das Versprechen. Ihr Vater erreichte nie die Hauptstadt, wurde statt dessen auf einer Insel namens Als ins Gefängnis gesteckt. Christine fühlte keine Trauer, aber sie wußte, da waren die Bürger und Bauern in Dänemark und die treuen Norweger, die ihren Vater liebten. Was war die Wahrheit? Was war die Wirklichkeit?
Mit dem Beginn des Sommers explodierte eine Neuigkeit wie eine Bombe am niederländischen Hof. Bei einer Zeremonie in Barcelona am 10. Juni hatte der Kaiser einen Ehevertrag zwischen seiner Nichte und Francesco Sforza, dem Herzog von Mailand, unterschrieben. Christine war elf Jahre alt und sollte heiraten.
Graf Massimiliano Stampa beugte sich vor, küßte Fräulein Christines Hand und begann ein Gespräch mit ihr und ihrer Schwester, Fräulein Dorothea, aber nach fünf Minuten erklärte die Regentin die Audienz für beendet.
Stampa war verärgert, schrieb aber am selben Abend einen Brief an den Herzog von Mailand über seinen ersten Eindruck von der künftigen Herzogin.
Wie die meisten am Mailänder Hof hatte es Stampa bedauert, daß es nicht gelungen war, die ältere Schwester mit Erbanspruch auf die nordischen Throne zu bekommen, jetzt, nachdem der Bruder tot war. Nach der kurzen Begegnung mit den königlichen Fräuleins konnte Stampa allerdings hocherfreut mitteilen, daß die Jüngere weitaus schöner sei. Sie habe außerdem auf ihn den Eindruck gemacht, sowohl lebhaft wie sanftmütig zu sein.
Stampa hatte die lange Reise von Norditalien bis nach Gent, wo sich der Hof aufhielt, unternommen. Die Reise hatte mehrere Wochen beansprucht, und er erreichte die Niederlande Mitte September.
Mit zunehmendem Erstaunen ritt er durch das flache Land. Alles war kultiviert und bestellt. Überall weidete schwarz geflecktes Vieh, und Häuser und Straßen machten einen gepflegten Eindruck. Nie hatte er eine so fruchtbare Erde gesehen, und am erstaunlichsten war, daß jede Frau und jeder Mann lesen und schreiben konnten. Stampa hatte sich Hunderte von Meilen keine Ruhe gegönnt, um so schnell wie möglich anzukommen, aber von dem Augenblick, an dem er die Grenze passierte, bewegte er sich nur im Trab und im Schritt vorwärts, um die unerwarteten Eindrücke aufzunehmen.
Die Ernte war vorbei, es wimmelte auf den Feldern von wohlgenährten Menschen, die mit frisch gestrichenen Gerätschaften pflügten und eggten. Vielerorts war man mit der Wintersaat beschäftigt, während Frauen, umgeben von einer Schar von Kindern, Bier in Krügen brachten.
Stampa wußte, daß die Niederlande von einer Frau regiert wurden. Vielleicht verirrten sich seine Gedanken, aber ihm schien, als ob hier alles von der Hand einer sparsamen, reinlichen und ordentlichen Hausmutter gelenkt würde.
Es könnte natürlich auch umgekehrt sein, philosophierte er, während sein Blick über Mühlen und ausgehobene Kanäle wanderte, daß nämlich das Volk so geartet war und sich dazu eignete, von einer Fürstin regiert zu werden.
In Wirtshäusern hörte er fortwährend Klagen über hohe Steuern und Kriege gegen die Franzosen, aber er sah gesunde, satte Bauernkinder und erinnerte sich nur zu genau an die zerlumpten, mageren Gestalten aus den norditalienischen Dörfern.
In den Niederlanden fand er Not und schwarzes Brot nur in den Armenvierteln der Städte, ansonsten herrschte Wohlstand, Gesundheit und Sauberkeit. Allerdings hatte Stampa noch nie so grobe und langweilige Frauen gesehen, und ihre Röcke schienen ihm oft unanständig kurz.
Es war jedoch nicht seine Aufgabe, einen Rapport über die niederländischen Provinzen zu schreiben. Er sollte eine Braut holen und sich deshalb zuerst darum bemühen, zur Regentin vorgelassen zu werden.
Wohlbehalten in Gent angekommen, erhielt er die Erlaubnis, zu warten, und schließlich wurden ihm diese fünf Minuten mit Fräulein Christine gestattet.
Es kursierten Gerüchte über einen Brief, den die Regentin an den Kaiser geschickt hatte, ein Protest über die Verheiratung eines so jungen Mädchens. Stampa mußte zugeben, daß ihm die Braut jünger vorkam als gleichaltrige Mädchen in Mailand. Die kräftige Sonne des Südens führte frühzeitig zur Reife, doch Fräulein Christine war ein Kind des Nordens und im diesigen Licht der Niederlande aufgewachsen. Obwohl das Zusammentreffen mit ihr kurz war, bemerkte Stampa sofort, daß die Brust über dem Mieder noch flach war und die leicht lispelnde Stimme einem Kind gehörte.
Der Anblick des königlichen Fräuleins gab ihm Grund zu ernster Sorge. Stampa war Mailänder, und er war Patriot. Sein Herr war der Enkel eines Mannes, der sich mit Waffengewalt selbst zum Herzog gemacht hatte. Das war noch eine goldene Zeit gewesen, als die italienischen Fürsten mit einem über tausend Leute zählenden Gefolge unterwegs waren. Aber mit der Jahrhundertwende kamen die Kriege, und der Herzog war im Exil aufgewachsen, bis er durch die Gnade des Kaisers in sein Land zurückkehren durfte.
Die Selbständigkeit seines Landes zu garantieren hatte sich Stampa zur Lebensaufgabe gemacht, doch dazu brauchte er einen Erben. Der Kaiser hatte eine Braut edelster Abstammung zur Verfügung gestellt, sich aber ausbedungen, daß ihm das Land zufalle, sollte der Herzog kinderlos sterben. Es war ein Wettlauf mit der Zeit.
In dem Kontrakt stand ausdrücklich, daß die Ehe unverzüglich zu vollziehen sei, und Stampa war sich darüber im klaren, daß der Passus nur darauf zielte, die Franzosen daran zu hindern, die Gültigkeit der Ehe anzufechten und damit die Abmachung als ganze. Nach den fünf Minuten mit Christine von Dänemark durchschaute Stampa die kaiserlichen Winkelzüge.
Stampa sollte als Stellvertreter des Herzogs die Prinzessin ehelichen und sie ihrem eigentlichen Gemahl zuführen. Aber die Regentin hatte immer neue Entschuldigungen, nicht mit ihm zu reden. Einmal war es eine leichte Verletzung bei einem Sturz vom Pferd, einmal Ratsversammlungen und unaufschiebbare Geschäfte, und dann reiste sie ohne weiteres in Begleitung ihrer beiden Nichten nach Lille. Stampa reiste hinterher. In Mailand erwartete der Fürst seine Braut und das Volk einen Erben, der die Selbständigkeit des Herzogtums bewahren und es vor fremder Herrschaft retten sollte. Trotz Stampas Zweifel bezüglich der Fähigkeiten des alternden, fast verkrüppelten Herzogs, das Geschlecht der Sforza weiterzuführen, gedachte er seine Aufgabe zu erfüllen.
Eines Tages erschien ein kaiserlicher Gesandter, de Praet. Der Kaiser hatte wahrscheinlich den mangelnden Willen der Schwester, den Ehekontrakt durchzuführen, geahnt, denn de Praet war aufgetragen worden, der Trauung beizuwohnen.
Jetzt wurde die Regentin sehr freundlich. Sie bedankte sich überschwenglich für das Pferd, das ihr der Herzog zum Geschenk gemacht hatte, sie arrangierte ein Souper für Stampa und gestattete ihm, den beiden Prinzessinnen beim Tanzen eines ballo all’italiano zuzuschauen.
Am Sonntag, dem 28. September 1533 nachmittags, fand die Hochzeit statt. Die Prozession betrat die Schloßkapelle von Lille. Die Braut wurde von der Regentin geleitet, während Stampa, der den Herzog vertrat, in goldenen Brokat gekleidet am Altar wartete. Violinen und Trompeten ertönten, der Bischof von Tournai vollzog die Trauung zwischen Christine von Dänemark und dem Herzog von Mailand in Gestalt eines anderen Mannes, und Stampa meinte eine große Freude auf dem Gesicht der Braut zu erblicken, als der Bischof ihr den mit einem schönen Rubin besetzten Ehering über den Finger streifte.
Nach den Festlichkeiten hatte Stampa ein herzliches Gespräch mit der Regentin. Sie war gnädig und scherzte, doch wie sehr er sich auch bemühte, ein Datum für die Abreise wurde nicht festgesetzt.
Die Regentin schaute ihn mit ihren schelmischen, braunen Augen an, machte eine bekümmerte Miene und bat ihn zu verstehen, daß sie unmöglich ihre geliebte Nichte in dieser Jahreszeit auf eine so gefährliche Reise schicken könne. Sie bot ihm statt dessen an, am nächsten Morgen an der Jagd teilzunehmen.
Graf Stampa lehnte ab, er müsse nach Hause und könne nur feststellen, daß Euer Gnaden die Schlacht gewonnen hätten. In Mailand würden die Kanonen donnern, die Kirchenglocken läuten und das Volk jubeln, sobald die Nachricht von der stattgefundenen Hochzeit einträfe. Aber die Braut kam nicht. Christine von Dänemark blieb bei ihrer Tante, die nicht wünschte, ihre Nichte vor Vollendung des zwölften Lebensjahres in einem Ehebett zu sehen.
Obwohl Christines Abreise verschoben worden war, gab es große Vorbereitungen. Seide, Damast und Brokat, Pelze, Perlen und Schmuck, alles mußte ausgesucht werden. Sie brauchte eine Ausstattung für ihre Tafel und für ihre Kapelle. Christine war das Kind eines Mannes, der einmal regiert hatte und jetzt in einem erbärmlichen Gefängnis saß, aber die Regentin stattete sie aus wie eine Tochter des Hauses Habsburg. Die Lakaien mußten eine Livree haben, und es mußte für eine Eskorte sowie für aufwartende Herren, Damen und Kammerjungfern gesorgt werden.
Christine und ihre noch unverheiratete Schwester amüsierten sich gemeinsam mit der Tante, und der Kaiser bezahlte.
Christine wurde zwölf Jahre, aber solange der Winter dauerte, war ein Aufbruch unmöglich. Statt dessen nahm Christine am Leben im Schloß teil, nun mit den Rechten einer verheirateten Frau, und sie konnte noch einmal über die Fastnachtsspäße lachen, wenn Katzen und Gänse auf dem Platz aus Fässern gezaubert wurden, und bewunderte die Fertigkeit ihrer Schwester als Bogenschützin bei den Zunftfesten.
Christine wußte, daß die Ehe der Höhepunkt im Leben einer Frau darstellte. Sie hatte einen Ehemann, ohne ihn je gesehen zu haben. Manchmal hatte sie das Gefühl, daß die Regentin mit ihr etwas besprechen wollte. Sie spürte ihren Blick auf sich ruhen, dachte aber nicht weiter darüber nach, außerdem mußte der Samt für das Auskleiden ihrer Sänfte und der ihrer Damen ausgemessen werden.
An einem Februartag ritt Christine mit ihrer Tante aus. Am großen Himmel von Brabant standen graue Winterwolken. Es war windstill. Die Windmühlenflügel bewegten sich nicht, und der Rauch stieg senkrecht aus Hütten und kleinen Bauernhöfen. An ungeschützten Stellen lagen noch Schneereste, und nur wenige Kühe waren auf den Weiden.
Die Regentin setzte über einen Zaun, Christine hinterher, und es begann zu regnen. Es goß, doch die Regentin ritt einfach weiter, bis sie plötzlich mitten auf einem Feld anhielt und lachte.
Das Wasser prasselte auf Kapuze und Umhang, die Bänder des Kopfputzes rollten sich zusammen, der Hengst glänzte vor Nässe, und sie sagte: »Andere würden Schutz suchen. Ich lebe.«
Und während das Unwetter zunahm und ihr der Regen ins Gesicht peitschte, blickte sie hinauf zum Himmel. »Ich habe gute Nachrichten aus Mailand. Du bist mit einem rechtschaffenen Mann verheiratet, er möchte nur dein Bestes. Aber ...«
Sie senkte einen Augenblick den Kopf, und Christine hatte das Gefühl, etwas zu erfahren, was sie ohnehin wußte. Ihre Tante schaute sie durch den Regen an, und Tropfen fielen von ihrer langen Nase. »Du darfst nicht unglücklich sein, weil du nicht gleich Kinder bekommst. Gott hat dich nicht vergessen, sie werden kommen.«
Sie klopfte das Pferd mit drei beruhigenden Schlägen. »Und du darfst nicht erschrecken, weil der Herzog von schwächlicher Gesundheit ist.« Sie lächelte und erklärte: »Er hat einige Lähmungen und kann nur schwer aus eigener Kraft gehen. Doch wenn du eine gute, liebevolle und gehorsame Gemahlin bist, was du sicher sein wirst, kommt er sicher wieder zu Kräften.«
Der Blick der Tante war prüfend, aber Christine empfand das Gehörte nicht als erschreckend. Sie liebte ihren Mann, und er liebte natürlich auch sie, seine Gemahlin.
Ihre Tante wendete das Pferd. »Eigentlich wollte ich dir etwas ganz anderes sagen. Doch nun bleibt es dabei.«
Dann fiel sie in Galopp, sprang über einen schmalen Graben, passierte zwei Kanäle und kam triefend naß nach Hause.
Christine fand nichts Merkwürdiges an dem Gespräch, obwohl ihr dessen Wichtigkeit klar war, denn sonst wären sie weitergeritten bis zur Dunkelheit. So gut kannte sie ihre Tante. Es bedurfte mehr als eines Regenschauers, damit sie umkehrte.
Als Christine später in dem großen Bottich saß und Johanne ihr liebevoll den Rücken schrubbte, überlegte sie, was ihr die Tante wohl hatte mitteilen wollen und warum sie so munter gewirkt hatte, als sie von den Lähmungen des Herzogs berichtete. Aber dann gähnte sie genüßlich im Wasserdampf und vergaß die Angelegenheit.
Am 11. März 1534 begann Christines Reise nach Mailand. Erst ein paar Tage davor begriff sie richtig, was da geschah. Sie mußte das Heim ihrer Kindheit verlassen. Die Welt, die sie erwartete, würde in vielem anders aussehen. Sie sei schöner, sagten manche, doch für Christine war das Schöne mit dem Vertrauten verbunden. Schönheit war in diesem Augenblick die riesige gewölbte Kuppel des Himmels über Brügge oder die Fastnachtsspäße in Brüssel oder Gent, und schön waren ihre glücklichen Jahre in Mechelen mit dem Windhund und dem Papagei und ihrer Schwester, dem toten Bruder und der toten Tante.
Christine rannte durch das Brüsseler Schloß. Sie umarmte Johanne, sie umarmte ihre Schwester und ihre Tante, nervös, fast hektisch, als wollte sie sie festhalten und mitziehen in ihr neues Leben.
Aber die Bande mußten zerrissen werden. Sie setzte sich in die Sänfte. Ihrem Beispiel folgten Madame de Souvastre, verantwortlich für ihren Haushalt, sechs Hofdamen, sechs aufwartende Kammerzofen, vier Pagen, zehn Herren, sechs Lakaien, zwanzig Maultiere und drei Wagen mit Gepäck. Schließlich noch die Eskorte von hundertdreißig Rittern. Die Tränen liefen über ihre Wangen, doch gleichzeitig glitt ihre Hand über den dicken Samtbezug der Sänfte. All das geschah ihr zu Ehren.
Einen kurzen Moment wanderten ihre Gedanken zum Vater. Wenn er sie jetzt sehen könnte. Aber sie schob die Gedanken an ihn weg. Sie war eine verheiratete Frau, war die Herzogin von Mailand.
Die Wagen setzten sich langsam in Bewegung. Dorothea weinte verzweifelt. Lange winkte Christine ihren Verwandten zu. Die Reise nach Mailand hatte begonnen.