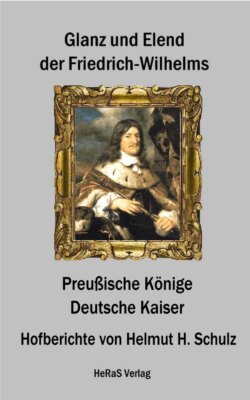Читать книгу Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms - Helmut H. Schulz - Страница 10
DAS TESTAMENT
ОглавлениеDer Große Kurfürst ist verhältnismäßig alt geworden, berücksichtigt man die anderen hier aufgeführten Todesfälle. Er starb an der Wassersucht, also wahrscheinlich ursächlich an einem chronischen Herzleiden, im Schloss zu Potsdam, und zwar am 9. Mai 1688. Er hinterließ verschiedene Testamente und einen zweifelhaften Thronerben. Sehen wir uns diese Testamente näher an: Der Thronfolger, welcher der Grablegung seines einst mächtigen Vaters in der Gruft des Berliner Doms beiwohnte, dürfte nichts weniger als Trauer über diesen gewaltigen Mann empfunden haben, dem er sich in keiner Weise gewachsen fühlte, und den er doch zu überlisten gedachte. Während des Trauergottesdienstes im Kreise bestürzter und um ihre Zukunft besorgter Familienangehöriger, vielmehr deren Reste, beschlichen den Erbprinzen einige Zweifel ob der zu erwartenden Verfügungen seines Vaters. Der künftige Kurfürst - dass er es werden würde, daran zweifelte Friedrich nicht, die Frage war nur, mit wie viel Macht er ausgestattet sein würde - ging im Geiste die Reihe seiner Gegenspieler durch. Ohne Zweifel mussten die Kinder der Kurfürstin. der zweiten Frau seines heimgegangenen Vaters, in ihren Ansprüchen befriedigt werden. Fritzchen, wie er einst liebevoll genannt worden war, kannte nur ein Testament seines Vaters, das aus dem Jahre 1659, welches ihm Halberstadt zuschrieb. Man erinnert sich, als Knabe hatte sich Friedrich gern mit Prinz von Halberstadt ansprechen lassen, wie wir sehen, mit einem gewissen Recht. Dieses Legat wurde in einer Testamentserweiterung 1664 bestätigt. Die übrigen Verfügungen des Großen Kurfürsten, wie sie während der Jahre den neuen Erfordernissen des Familienzuwachses angepasst worden waren, interessieren hier nur unter zwei Gesichtspunkten. Erstens hatte die zweite Frau des Großen Kurfürsten sehr energisch für ihre Kinder zu sorgen verstanden, obschon Friedrichs Stellung als Erbfolger nie wirklich in Frage gestellt worden war. Zweitens, nach dem Tode Karl Emils im Jahre 1674 behielt der Große Kurfürst alle neuen Verfügungen seines Testaments tunlichst für sich. Nur der Geheime Rat kannte den Inhalt, nicht aber der Thronfolger, der sich eben einige Krokodilstränen abpresste, weil er diesem gewaltigen Kerl ja immerhin doch einiges verdankte. Nicht mehr lange, und er wusste, welche Rolle ihm sein Vater zugedacht hatte, als ihm der Geheime Rat (Merkwürdig, Danckelmann stand all diesen Räten zumindest nahe; hatte er von den Klauseln des letzten Testaments gar nichts gewusst, und wenn er davon gewusst hat, redete er mit seinem Liebling, dem er einst nach Strich und Faden das Fell versohlen durfte, darüber?) den Inhalt des Testaments eröffnete. Das letzte Testament, um das es sich jetzt handelt, stammte vom 26. Januar 1686, zwei Jahre vor seinem Tode, als der Kurfürst, von Krankheit gezeichnet, sein Ende erwartend, eine höchst eigenartige Entscheidung traf. Die jüngeren Brüder des zu inthronisierenden Kurfürsten erhielten allesamt Länder aus dem Hohenzollernbereich zu Lehen, sollten dem kommenden Kurfürsten jedoch den Treueid schwören. Das bedeutete nichts anderes, als dass der Große Kurfürst entweder nie einen Einheitsstaat gewollt hat, oder aber den Gedanken daran wieder aufgab. Ferner kann es bedeuten, dass der Verstorbene seinem Sohn nicht zutraute, ein solches Erbe zusammenzuhalten, und schließlich ist der große Einfluss der Kurfürstin auf Friedrich Wilhelm unverkennbar; denn ihren Kindern fielen diese Legate zu. Die Historiker haben über das Für und Wider dieses Testaments heftig gestritten, und sie tun es wohl auch heute noch, da ja irgendeiner diesen Preußenstaat gewollt haben muss, und dafür steht am ehesten dieser gewaltige Kerl, der Große Kurfürst. Was Friedrich in diesem Nachlass erblickte, ist klar: eine Brüskierung, eine Schmälerung seiner Macht, eine Frechheit, der Gipfelpunkt aller Infamien, schlimmer als alles Arsen der agrippinischen Stiefmutter. Dieser Muttersohn, dieser schwächliche Mensch, dieser eitle Modegeck, dieses Gespött aller deutschen Potentaten, die gleichwohl keinen Deut besser waren, dieser Spielball in den Händen seiner Frauen, Schwiegermütter und Berater, schäumte hoch auf. Und er focht das Testament augenblicklich an. Dazu bot ihm die sogenannte Disposuio Aihillea eine prächtige juristische Handhabe. Es hatte nämlich der Kurfürst Albrecht Achilles 1474 in einem Familienvertrag festgelegt, dass die Hohenzollern das brandenburgische Erbe niemals teilen, dass Brandenburg immer an den jeweils ältesten Sohn fallen sollte, auch wenn dieser erhebliche moralische, geistige und physische Mängel aufweisen würde, wenn er einen Buckel hatte und alle naselang vermeinte, vergiftet worden zu sein. Bei dem Kinderreichturn des Achilles war diese Idee ganz einleuchtend, er hatte an Söhnen und Töchtern immerhin deren 19 (neunzehn!),]Johann Georg, noch ein Kurfürst, gar 23 (dreiundzwanzig!); dermaßen viele Länder besaß Brandenburg gar nicht. Eingehalten wurde dieses Hausgesetz aber niemals ohne Erbstreitigkeiten. Ferner war bestimmt, dass die jeweils leer ausgegangenen Söhne die Geistlichkeit bereichern sollten, zum Pfaffen langt es also allemal, wenn schon kein Fürst in einem steckt. Einige der Leerausgegangenen hätten Ansprüche auf Ansbach und Bayreuth geltend machen können. In einem Zusatz, dem von Gera, war die Dispositio Aihillea noch ausdrücklich bestätigt worden, nämlich 1603 in der sogenannten Primogenitur. Nein, dieses Testament des Großen Kurfürsten, der kein Zutrauen zu ihm hatte, dem Sohn mit kleinem, aber schlauem Kopf unter einer großen Perücke, konnte Friedrich in der Tat mit einigem Recht anfechten. Und wieder einmal half ihm das Schicksal ein wenig, was es gar nicht durfte, nach dem kalvinistischen Einfall, dass uns alles vorherbestimmt wird. Ihm starb endlich die tief und ohnmächtig gehasste Stiefmutter, sie folgte ein Jahr nach dem Tode des Großen Kurfürsten diesem in die Ewigkeit nach und befreite Friedrich von einer harten Gegenspielerin. Zunächst einmal gelang es ihm, seine Brüder mit Geld abzufinden, die Summen wurden auf Höhe der Einnahmen festgelegt, die sie aus den ihnen zugesprochenen Gebietsteilen bezogen hätten. Ferner musste Kaiser Leopold I. zu Wien gewonnen werden, der sich der geplanten Annullierung des Testaments widersetzte und auf den strickten Vollzug drängte. Zugute kam dem Thronfolger eine höchst verwickelte Gebietsfrage, die schon den Großen Kurfürsten beschäftigt hatte: die Frage Schwiebus, ein Zipfelchen Land in der Nordwestecke Schlesiens, auf das alle Ansprüche erhoben. Daran hing die weit größere Frage Schlesien, die später zu den Kriegen Friedrichs II. führte. In den letzten Lebensjahren des verstorbenen Kurfürsten hatte sein Sohn, wie jener schon geargwöhnt, hinter seinem Rücken mit dem österreichischen Gesandten, einem Herrn von Fridag, vereinbart, gegen die Zahlung von 10 Tsd. Dukaten das Zipfelchen Schwiebus an den Kaiser zurückzugeben, nach dem Ableben Friedrich Wilhelms, versteht sich. Warum Friedrich um ein paar Dukaten willen sich eines solchen Vorteils begab, ist in der Tat nicht ganz verständlich. Allein es erwies sich, dass Friedrich sozusagen eine Anlage in die Zukunft gemacht hatte, als er sich mit dem Kaiser gut stellte. Er soll selbst später zugegeben haben, dass er den Kern der ganzen Frage Schwiebus, Schlesien überhaupt nicht verstanden habe. Mit dem Tode Friedrich Wilhelms trat jedenfalls prompt der zuvor vereinbarte Rückgabefall ein, wie der Vertrag vorsah. Brandenburg sollte Schwiebus dem Kaiser wieder herausgeben, das, nebenbei gesagt, nie in Wirklichkeit an Brandenburg ausgereicht worden war, was den Fall noch grotesker macht, als er schon ist. Die teure Gemahlin Sophie Charlotte drang sehr in den Gatten, zum Vertrag zu stehen, da sie hoffte, für ihren Papa die Kurfürstenwürde bei dieser schönen Gelegenheit zu ergattern. Friedrich weigerte sich; erst 1695 erteilte der Kaiser den Dispens, das Testament zu annullieren. Der neue Kurfürst reichte gegen eine Kostenerstattung von 250 Tsd. Gulden, die Brandenburg angeblich in Schwiebus investiert haben wollte, das Ländle zurück.
Während all dieser mehr oder minder normal schmutzigen Geschäfte seines Sohnes, der einen ausgezeichneten und durchtrieben rechtsstaatliehen Politiker der Neuzeit abgegeben hätte, hielt sich der Große Kurfürst handlungsunfähig und krank zu Potsdam auf; vom Jahre 1684 meist im Bett oder im Stuhl. Der sterbende Löwe befasste sich mit der Frage des Lebens nach dem Tode, kam aber, wohl wie alle anderen auch, zu keinem Schluss; wie es heißt, soll er darin Trost gefunden haben, ... sich zu den Auserwählten ... zu rechnen. Untersuchen können wir dies nicht, stellen aber auch nicht in Abrede, dass es diesem Großen Kurfürsten an einem Nachfolger mangelte. Schließlich schickte er sich in das nicht Abzuwendende und fand zu seiner menschlichen Würde zurück, wie es nicht allen Sterbenden gelingt, er segnete seine Gattin, die ihm bald nacholgte, ermahnte die Familie, sich um alle Flüchtlinge und religiös Verfolgten zu kümmern, womit er bis in die heutige Zeit erfreulich herüberreicht, und verschied. Er hinterließ einen König, aber was für einen, den König in Preußen.