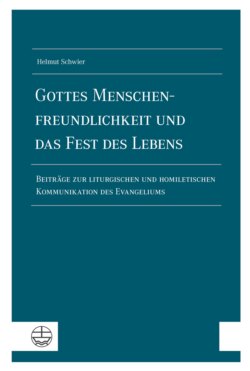Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 67
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Ostern feiern
ОглавлениеAm Beginn des Christentums stehen historisch betrachtet die Osterzeugen, die Erscheinungs-, nicht Auferstehungszeugen sind. Die zu den ältesten literarischen Bestandteilen des NT zählenden Auferweckungs- und Bekenntnisformeln (1Thess 1,10; 1Kor 6,14; 15,3b–5; 2Kor 4,14; Gal 1,1; Röm 4,17.24 f; 10,9) gehören wohl in den Kontext der frühchristlichen Versammlungen und ihrer von Parusie-Erwartung geprägten Gottesdienste. Die sich schnell entwickelnden christlichen Mahlfeiern und die frühe Sitte, am ersten Tag der Woche, dem Herrentag, eigene Gottesdienste zu feiern, stellen die rituelle Seite dar und prägen Abgrenzungsprozesse und Identitätsbildungen. Der Glaube an Gott durch Christus im Heiligen Geist strukturiert nicht nur frühchristliches Beten, sondern wirkt als Identitätsmarker und bildet eine kognitive wie emotionale und pragmatische Basis theologischer Konzepte. Der auferweckte ist der erhöhte Christus und wird in den Gottesdiensten gefeiert und als gegenwärtig erfahren. Dies begründet den sachlichen Primat der österlichen Feier, die wiederum jedem Gottesdienst zugrunde liegt.
Ostern zu feiern,1 steht auch heute am Anfang. Dem folgt das Verstehen. Zur spätmodernen Signatur gehören nicht nur Traditionsabbruch und Individualisierung, sondern auch die neue Pflege von Traditionen, seien sie bekannt oder wiederentdeckt. Dazu zählt zum Beispiel die Auferstehungsfeier am frühen Ostermorgen auf dem Friedhof. Der unlösbare Zusammenhang zwischen der Auferweckung Jesu Christi und der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten (1Kor 15) findet hier seine Feiergestalt. Posaunenchor und Gemeinde lassen die Osterbotschaft über den Gräbern erschallen und sind kraftvolle Zeichen, dass dem Tod nicht das letzte Wort gehört.
Auch eine differenzierte gottesdienstliche Festkultur in den Gemeinden wird vielerorts praktiziert und kann noch verstärkt werden. Abgesehen von der Gestaltung der gesamten Passionszeit, die beispielsweise durch die Aktion »Sieben Wochen ohne« neue Aufmerksamkeit auf Fasten und leibliche Erfahrungen lenkt, ist die sorgfältige Abstimmung der Gottesdienste von Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag notwendig. Traditionskontinuierliche und neue Formen, Beteiligung und Mitwirkung verschiedener Gruppen, Junger und Älterer, unterschiedliche musikalische Stile, reduzierte und reiche Liturgien bieten einen großen Fundus zur Feier der Heilsgeschichte. Prozessionen und Nachtwachen, Feierabendmahl und Eucharistie, Lehrpredigten und Ostereierbräuche deuten die Spannweite an. Hin und wieder werden auch theatrale Formen entdeckt wie im Osterspiel von Gernrode, das bewusst und überzeugend als Gottesdienst inszeniert wird, Kult und Kultur zueinander führt und nicht zuletzt auf erstaunliche Resonanz stößt.2
Historisch gesehen ist die Feier der Osternacht schon seit der frühen Kirche die »Herzmitte« des Kirchenjahres und seiner Gottesdienste.3 Gegenwärtig wird sie nach Neuanfängen in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg in vielen evangelischen und katholischen Gemeinden gefeiert, teilweise sogar in ökumenischer Annäherung. Die Stile sind durchaus unterschiedlich, agendarisch oder frei gestaltet, verbunden mit alter Tradition und mit den Möglichkeiten vor Ort. Als Grundformen sind eine am Samstagabend beginnende Langform und eine am frühen Ostermorgen gefeierte kürzere Form geeignet. Im Kern bestehen beide Formen aus einer Lichtfeier mit Kerzenritus und österlichem Lob (traditionell: »Exsultet«), einem (langen) Lesungsteil, Taufe und / oder Tauferinnerung, dem Osterevangelium samt Predigt und der Abendmahlsfeier. In der Langform kommen meist längere Phasen der Nachtwache samt meditativen Impulsen hinzu.
Die Osternacht ist im Unterschied zum üblichen Gottesdienst am Ostersonntag eine spannungsreiche Prozess- und Transitusliturgie. Sie inszeniert die Spannungen von Licht und Dunkel, von Tod und Leben, von Durchgängen und Gefährdungen (Schöpfung, Sintflut, Exodus, Tauftod). Dies geschieht sowohl erfahrungsbezogen wie erfahrungsanregend, eröffnet in Symbolen und Riten ganzheitliche Vollzüge. Gleichzeitig ist die Osternacht nicht einfach ein Event, sondern bietet schon durch die langen Lesungen und ausgeführten Liturgien auch ein Durchbrechen von Eventerwartungen. Peter Cornehl hat dies – auch auf dem Hintergrund der Auswertung der Befragungen von Mitwirkenden und Feiernden – treffend als dreifache Zumutung erfasst. Die Osternachtfeier »ist zunächst eine physische Zumutung: Man muss den Weg mitgehen, muss wach bleiben (oder wieder wach werden), und allein das ist eine nicht geringe Anstrengung! Sie ist sodann eine seelische Zumutung: Man muss bereit sein, die Begegnung mit Leiden und Destruktivität, mit dem Schweren, Ungelösten auszuhalten, mit der Dunkelheit, der Stille und mit sich selbst. Die Osternacht ist schließlich eine theologische Zumutung. Wer daran teilnimmt, ist herausgefordert, die vielfältigen Informationen, Texte, Bilder, Lieder, Gesänge, Symbole und Zeichen, die im Laufe der Nacht angeboten werden und die keineswegs einer einheitlichen theologischen Logik folgen, zu verarbeiten, um das für sich selbst Wichtige auszuwählen und sich anzueignen.«4
Das Fehlen einer solchen Einheitslogik erschwert auch die schnelle Zusammenfassung.5 Grundsätzlich gilt, dass hier Liturgie und Theologie komplex ineinander greifen. Dabei lassen sich folgende Dimensionen erkennen:
(1)Theologische Dimension: Die Feier der Osternacht nimmt wie kein anderer Gottesdienst die spannungsreiche Zusammengehörigkeit von Kreuz und Auferweckung in den Blick und gestaltet dies überzeugender als die leicht als historisierend wirkende Abfolge der Stationen von Palmsonntag bis Ostern, dann Himmelfahrt und Pfingsten. Kreuz und Auferweckung / Erhöhung kommen zur Sprache als Bekenntnis zum letztgültigen Handeln des einen Gottes, dessen Liebe zum Menschen stärker ist als der Tod.
(2)Rituelle Dimension: Jede Feier der Osternacht geschieht zwischen Anfechtung und Hoffnung, Zweifel und Zuversicht, Finsternis und Licht, Tod und Leben. In ihren Symbolen und Riten bildet sie gerade diese Spannung selbst ab, und zwar sowohl erlebnisreich wie als Zumutung. Als Prozess- und Transitusliturgie setzt sie wie kein anderer Gottesdienst auf Veränderung und Neuschöpfung. Ihre rituelle Dimension ist dynamisch, nicht statisch oder starr.
(3)Erlebniskritische Dimension: Die Erlebnisdimension ist in der Osternacht allerdings auch eigentümlich gebrochen, denn neben Lichtsymbolik, Wasser, Brot und Wein ist ihr Hauptmedium die Sprache – in teilweise nicht enden wollenden biblischen Lesungen. Auch dies ist eine Zumutung, die sich deutlich gegen Dramatisierungen und Events sperrt und notwendig ist als Grenzziehung zu kultischen Vereinnahmungen wie möglichen Banalisierungen von Gottesdienst.
(4)Liturgische Dimension: Die Ostervigil benötigt eine reflektierte liturgische Gestaltung, die die Möglichkeiten der Musik, des Raumes, der Tageszeiten einbezieht und eine Feier der ganzen versammelten Gemeinde wird. An ihr ist wahrzunehmen und zu lernen, dass evangelischer Gottesdienst zuerst ein Fest und eine Feier zur Ehre Gottes und nicht eine Veranstaltung ist. Dies braucht traditionskontinuierliche wie neue Formen, die innere und äußere Partizipation ermöglichen.
(5)Homiletische Dimension: Die Ostervigil benötigt eine klärende Predigt, die das Evangelium der Auferweckung und Erhöhung des Gekreuzigten je neu und inhaltlich pointiert mitteilt. Wie die Lesungen und diese aufnehmend steht die Predigt in einer notwendigen Spannung zur rituellen Erlebnisdimension und geschieht in der Zuversicht, dass Gott sich selbst im Wort mitteilt.
(6)Ekklesiologische Dimension: Die Feier der versammelten Gemeinde steht im wechselseitigen Austausch mit allen Bereichen kirchlicher Arbeit und benötigt daher Diakonie, Bildung und Seelsorge. Die Osternacht ist Zentrum der christlichen Gottesdienste und darin Ermutigung zum Christsein im Alltag und zum Kirchesein in der Welt.
(7)Ökumenische Dimension: Konfessionalistisch Ostern zu feiern ist ein Widerspruch in sich. Die Osternacht zeigt nicht nur ökumenische Konvergenzen in Gebeten, Lesungen, Riten und der gesamten Feiergestalt, sondern verbindet die feiernde Gemeinde vor Ort mit der zeit- und raumübergreifenden Kirche und dem in ihr bezeugten Gottesbekenntnis als dem Bekenntnis zu Gottes Auferweckungshandeln.
Das Osterfest und seine liturgischen Feiern, insbesondere die Osternacht, lassen die grundlegenden Funktionen christlicher Feste, die Unterbrechung des Alltags, die Feier des Lebens und die Antizipation der Zukunftsgewissheit, erfahrbar werden. Ihre Stärke liegt in der komplexen Verbindung menschlicher Grunderfahrungen und des Evangeliums, in denen jeweils Scheitern, Leiden, Ungerechtigkeit und Tod nicht ausgeklammert, aber als zeichenhaft überwunden dargestellt und inszeniert werden.