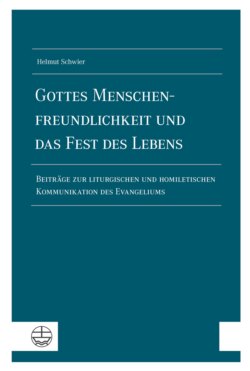Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 68
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Ostern als theologische Revolution verstehen und österlich denken
ОглавлениеDas Verstehen folgt der Feier und ihrer Darstellung des Evangeliums. Aus den frühen Zeugnissen des NT wird deutlich, dass Auferweckung als grundlegende Tat Gottes gilt. Er ist als derjenige, der Christus von den Toten auferweckte, prinzipiell bestimmt. Daraus ergeben sich elementare Inhalte und Grenzziehungen: Jesus ist nicht wiedererweckt worden und so zum Leben gebracht, dass er erneut sterben müsste – theologisch ausgedrückt: Er ist in Gottes Leben hinein auferweckt und erhöht worden.6 Nicht irgendein Mensch ist erweckt worden, sondern dieser Jesus, also genau der, der das Reich Gottes als Heil für die Verlorenen ankündigte und in Heilungen wie Mahlgemeinschaften zeichenhaft realisierte und den brutalen und schmachvollen Kreuzestod starb; die Auferweckung durch Gott ist und bleibt die Auferweckung des Gekreuzigten,7 sie bleibt Gottes Deutung dieses Todes8 und seine Selbstkundgabe als Liebe.9 Schließlich bedeutet solches Auferweckungshandeln Gottes etwas prinzipiell Neues, das nun im Prinzip, also umfassend und grundsätzlich, für die Menschen, für den Kosmos, gilt: Dieses Handeln ist ein Sieg über den Tod, der als letzte Grenze keinen Bestand mehr haben kann – diese Einsicht hat Paulus z. B. mit dem Begriff »Erstling der Entschlafenen« (1Kor 15,20) verdeutlicht und Paul Gerhardt mit den Bildworten von Christus, der uns als seine Glieder und Gesellen stets hindurch reißt durch Tod, Welt, Sünde, Not und Hölle (EG 112), was notabene kraftvoller wirkt und realistischer ist als die naive Wunschvorstellung, am Tod und den anderen Mächten unbemerkt vorbeizukommen.
Ostern zu denken, bedeutet eine theologische Revolution: Gott, die Gottesrede und das gesamte Verständnis von Leben und Wirklichkeit sind radikal verändert. Unsere traditionelle Weltsicht und Alltagsontologie erhält einen Riss.10 In Kontinuität zum Handeln des Gottes Israels, die Paulus als das Lebendigmachen der Toten und als ›sein Rufen des Nichtseienden, dass es sei‹ systematisiert (Röm 4,17), erschließt sich Gott nicht nur als Verändernder, sondern auch als Veränderter: in Christus als unwiderruflich Liebender, dessen Reich und Herrschaft schon jetzt im Kleinen anbricht, in Zuwendung, Vergebung, Heilung und im Tun des Gerechten, und dessen Kommen Ziel, Grenze und Verwandlung des Kosmos bedeutet.
Dass ein Mal der Tod besiegt wurde, dass ein Mal Gott sich als Auferweckender hat erkennen lassen, hat prinzipielle Auswirkungen auf Leben und Denken. Österlich zu denken, ist daher die Aufgabe, die nicht nur systematischtheologisch,11 sondern auch praktisch-theologisch gestellt ist. Die Auferweckung ist die Auferweckung des Gekreuzigten, und das Bekenntnis der Kirche und Einzelnen geschieht angesichts individueller und gesellschaftlicher Leidens- und Todeswirklichkeiten, in Anfechtung und Hoffnung, als Bekenntnis zur Auferweckung und Erhöhung des Menschen Jesus durch Gott. Diese Spannung lässt die Osternacht erfahren und regt dadurch zu je neu veränderter Reflexion und Praxis an, die in allen kirchlichen Handlungsfeldern und bei allen religiösen Sinndimensionen an der Relation zu Gott und zur Welt im Licht des coram Christo resurrecto et exaltato festhält, welches zugleich die Gegenwart umfassend bestimmt.12 Schon daher ist Praktische Theologie als Theologie nicht an Vergangenheit und Traditionsbewahrung orientiert, sondern neugierig und offen für die Veränderungen der Zukunft und die Gestaltung der Gegenwart. Österliche Zeitwahrnehmung und -diagnose gehören dann zu den zentralen Aufgaben praktisch-theologischer Reflexion.