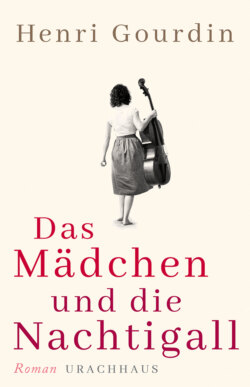Читать книгу Das Mädchen und die Nachtigall - Henri Gourdin - Страница 10
Renée Levêque
ОглавлениеDunkelheit brach über die Rue Saint-Jacques herein, als der Rundweg auf der Befestigungsmauer uns wieder dorthin zurückführte.
»Und Sie, Marie?«, fragte der Priester, als er seinen Mantel wieder über dem Schlüsselbund zuknöpfte. »Sie haben bei sich zu Hause den Krieg erlebt. Den Krieg … wie soll ich sagen? Den Bürgerkrieg, den schlimmsten von allen, nicht wahr?«
Eine einfache Frage im Verlauf der Unterhaltung, doch sie erinnerte mich an Teresa und die schmerzhaften Ereignisse jener letzten Stunden. Teresa! Ich sah wieder ihr Gesicht vor mir, hörte ihre Stimme. Ich spürte das eiskalte Gewicht ihres Körpers an dem meinen, auf unserem Lager in der Baracke von Argelès.
»Kommen Sie mit und wärmen Sie sich im Pfarrhaus auf«, schlug der Priester vor, als er mich zittern sah.
»Oder bei mir zu Hause«, sagte Agnès und hakte sich bei mir unter.
Bei ihr, bei ihm, das war mir gleich. In Wirklichkeit wünschte ich nur, mein Zimmer und mein Bett aufsuchen zu können, um meine Verzweiflung im Schlaf und im Alleinsein zu ertränken. Doch Agnès bestand darauf, mich zu sich nach Hause mitzunehmen, zum Vauban, genauer gesagt in die Wohnung ihrer Eltern im ersten Stock des Hauses über dem Café. Man durchschritt das Café und öffnete eine Tür am Ende der Bar, stieg eine Steintreppe hinauf und befand sich in einer kleinen schmucken Halle. Eine Tür auf der rechten Seite führte in die Küche, die auf der linken zum Flur mit den Schlafzimmern, eine letzte lag gegenüber, und diese öffnete Agnès für mich.
Madame Levêque saß strickend in einem kleinen Sessel vor dem Fenster, und ich war von diesem ersten Anblick ihres heiteren Gesichtsausdrucks verblüfft. Heiter? Nein, es war etwas anderes, ein Ausdruck von Glück, fast von Glückseligkeit, der mich an Julia, unsere Nachbarin in Tarragona, erinnerte. Wenn sie wie jeder hier auf Erden ihren Anteil an Trauer und Widrigkeiten erlebt hatte, so hatten diese Unglücke sie nicht berührt, oder sie ließ sich nichts davon anmerken.
Monsieur Levêque spielte an dem großen Tisch mit den beiden Kindern, auf die Agnès auf jenem Platz aufgepasst hatte, als wir sie am frühen Nachmittag aufsuchten. Seine Gesichtszüge konnte ich im Halbdunkel nicht erkennen, aber er war groß, hielt sich aufrecht und vermittelte Sicherheit und Autorität.
Insgesamt herrschte eine wirklich gemütliche Atmosphäre, ganz anders als bei den Puechs. Alle begrüßten mich, sogar die kleine Hündin zu Füßen von Madame Levêque, und diese wies mir den Sessel zu, der neben ihr vor einem Fenster stand, das zur Rue Saint-Jacques hinausgehen musste. Sie stellte mir auf Katalanisch einige Fragen, bis Agnès mit einem großen Tablett voll dampfender Schalen aus der Küche zurückkehrte.
»Ich wusste, dass du sie belästigen würdest«, sagte sie in dem leicht scharfen Ton, der ihr eigen war. »Immer musst du unseren Gästen tausend Fragen stellen. Hast du dich nicht gefragt, ob die Leute wirklich Lust haben, solchen Verhören ausgesetzt zu werden?«
»Die Neugier …«, begann Madame Levêque.
»… ist ein schlimmer Fehler«, beendete ihre Tochter den Satz. »Was würdest du sagen, wenn Marie dich so ausfragen würde?«
»Ausfragen, ausfragen … Soviel ich weiß, haben wir nicht unsere Folterinstrumente herausgeholt.«
»Wir würden antworten«, entgegnete Monsieur Levêque, ohne den Blick von seinem Kartenspiel zu heben.
»Du würdest antworten? Du willst doch nicht einmal, dass man weiß, dass du Bürgermeister bist.«
»Nicht Bürgermeister, Agnès, wie oft muss man es dir noch wiederholen? Ich bin nicht Bürgermeister, nur Präsident der Sonderdelegation.«
»Ja, gut …«
»Das ist nicht das Gleiche. Ganz und gar nicht.«
In diesem Moment hob Madame Levêque den Blick von ihrem Strickzeug und berichtete mir in sehr einfachem Französisch, wie ihr Mann zum Stellvertreter des kommunistischen Bürgermeisters von Villefranche ernannt worden war. Das war für mich keine Überraschung. Die Ereignisse in Spanien hatten uns wider Willen politisiert. Die deutschen Sturzkampfflugzeuge und die Kanonen der Italiener hatten uns gelehrt, dass der Ausgang des Krieges von den internationalen geheimen Machenschaften abhing, aber ebenso – oder vielleicht sogar noch mehr – von den Auseinandersetzungen vor Ort. Und in Argelès waren wir über das Tagesgeschehen informiert, durch unsere Gewerkschaftskameraden insbesondere über die aktuelle französische Politik.
Die Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts im August 1939 hatte leidenschaftliche Diskussionen ausgelöst, und wir wussten, dass die französische Regierung Maßnahmen ergriffen hatte, um die Kommunisten und die Sympathisanten der spanischen Republik auszuschließen und durch Konservative zu ersetzen, doch all das schien sehr weit weg und blieb für uns quasi theoretisch. Die Geschichte der Absetzung des Bürgermeisters von Villefranche zeigte mir die praktische Seite dieser Frage.
»Villefranche ist eine rote Hochburg«, erklärte Madame Levêque, da ihr mein Interesse aufgefallen war. »Das freut meinen Mann nicht wirklich«, sprach sie mit leicht provozierendem Lächeln weiter, »aber es ist so.«
»Ich dachte, in Frankreich wären die Leute auf dem Land konservativ.«
»Ah! Ich sehe, dass Mademoiselle gut informiert ist«, entgegnete sie und strickte eine weitere Masche. »Nun, haben Sie sich einmal gefragt, liebe Marie, ob wir hier wirklich auf dem Land sind?«
»Villefranche ist ein Dorf, oder etwa nicht?«
»Ein Dorf sicher, wenn man die Einwohnerzahl bedenkt. Aber wie vielen Kühen und Schafen sind Sie seit Ihrer Ankunft begegnet? Keinem einzigen Tier, stimmt’s? Wie vielen Bauern? Ich wette, nicht einem.«
»Was tun die Menschen dann? Wovon leben sie?«
»Eine berechtigte Frage. Außer den Geschäftsleuten, dem Lehrer und den Angestellten im Rathaus sind die Menschen in Villefranche Arbeiter.«
»Arbeiter?«
»Das wundert Sie? Oh, Sie werden in dem Ort keine Fabrik sehen, außer der Limonadenfabrik meines Mannes, aber es gibt das Elektrizitätswerk, die Eisenminen, die Gießerei, die …«
»Die Eisenbahngesellschaft«, fiel Agnès ein und warf durch den Dampf ihrer Schale einen verstohlenen Blick zu ihrem Vater hinüber. »Der erste Arbeitgeber des Kantons. Ein Nest von Gewerkschaftlern.«
»Sehen Sie den Bahnhof vor sich, wo Sie ausgestiegen sind, den Bahnhof von Fuilla?«, fiel Renée ein, als wollte sie einen Streit im Keim ersticken.
»Ja, wir haben ihn auch oben von der Befestigungsmauer aus gesehen.«
»Das ist ein wichtiger Bahnhof. Ein Knotenpunkt des Eisenbahnnetzes zwischen den Linien der Ebene und denen der Cerdagne. Von dort aus werden diese Linien gewartet und verwaltet, mit zweihundert Angestellten. Und wo wohnen sie und ihre Familien?«
»In Villefranche?«
»Ja. Das ist für sie am nächsten. Fuilla, Ria, Corneilla … das ist alles viel zu weit weg. Nun verstehen Sie wohl, dass die Arbeiter der Fabriken und der Eisenbahngesellschaft nicht gerade diejenigen sind, die rechts wählen werden.«
»Daher kommt die kommunistische Mehrheit?«
»Genau. Und daher die Absetzung des Bürgermeisters nach der Unterzeichnung des Nichtangriffspakts, versteht sich. Frankreich ist im Krieg mit Deutschland, Deutschland hat sich mit Russland verbündet. Wir werden nicht Leuten die Führung überlassen, die Kontakte und vielleicht sogar Beziehungen zum Feind haben.«
»Und was ist aus dem Bürgermeister geworden?«, fragte ich.
»Er war reif für das Gefängnis, oder das Arbeitslager«, antwortete René Levêque und sammelte seine Karten ein, »aber machen Sie sich um ihn keine Sorgen, die Gewerkschaft hat ihn ins Grüne gebracht, er soll bei einem kleinen Bahnhof weit abseits von allem leben und Kohl pflanzen.«
»Ich lass mich nicht davon abbringen«, sagte Agnès. »Bürgermeister oder Präsident, das ist das Gleiche, nur die Bezeichnung ist eine andere.«
»Der Bürgermeister ist gewählt worden, der Präsident amtlich bestimmt«, antwortete ihr Vater schlagfertig. »Wenn es nur das wäre …«
Die politische Situation von Villefranche stand in jenem Augenblick wirklich nicht im Mittelpunkt unserer Sorgen, doch sie hatten versucht, mir meine Befangenheit zu nehmen und mich so auf mein neues Leben vorzubereiten. Es war ihre Art und Weise, mich zu empfangen, und deshalb berührte es mich.
Anschließend machte es sich Agnès zur Aufgabe, mir von der Geschichte ihrer Eltern zu erzählen, in ihrer Gegenwart und folglich gewissermaßen unter ihrer Kontrolle. René Levêque war in Algerien in einem Dorf bei Mostaganem geboren. Seine Eltern besaßen ein Stück Land, von dem sie nur schwer leben konnten, und so drängten sie ihren Sohn in andere Bahnen. Also studierte er ein wenig, um ihnen zu gehorchen, und von einem Tag auf den anderen hatte er sich bei der Reitertruppe der Spahis verpflichtet. Offizier im Ersten Weltkrieg, dann Jahre des Hin und Her zwischen Marokko, wo er seine Männer rekrutierte, und seiner Kaserne in Perpignan. Dann kam Renée.
»An einem 14. Juli auf dem Ball von Prades«, führte Madame Levêque die Erzählung weiter. »1921. Wir haben sofort geheiratet, und Agnès wurde neun Monate später geboren.«
»Am 23. April 1922«, warf eines der Kinder voller Stolz auf sein Wissen ein.
»Auf der Krankenstation der Kaserne«, sagte Agnès seufzend. »Wie ein Bühnenauftritt …«
»Wie bitte? Wie ein Bühnenauftritt? Die Armee bot uns eine Unterkunft an, und wir konnten diese Annehmlichkeiten doch nicht ausschlagen. Im Übrigen war die Krankenstation sehr sauber. Und außerdem – worüber beklagst du dich? Du hast an jenem Tag sehr glücklich ausgesehen, und ich muss es ja wissen. Du wurdest nach Strich und Faden verwöhnt.«
Der Vater von Renée war ein Jahr später gestorben, und daraufhin hatte René gebeten, vorzeitig entlassen zu werden, um die Geschäfte zu übernehmen: das Café, die Abfüllfabrik, die Wohnung … Und Renée war sozusagen in die ›Startposition‹ zurückgekehrt, in die Wohnung ihrer Mutter, in deren Sessel, sogar in ihr Bett, Lichtjahre von einem Leben des Reisens in fremde Länder entfernt, wie sie es sich erträumt hatte. Doch sie hatte die Wahl ihres Mannes bereitwillig akzeptiert. Denn Monsieur Levêque gefiel es in Villefranche. Hier fühlte er sich in Sicherheit. Die Befestigungsmauer erinnerte ihn an die Mauern seiner Kaserne und gab ihm dasselbe Gefühl von Schutz.
»Deshalb hat er mich geheiratet«, bemerkte Madame Levêque lachend, »wegen der Mauern von Villefranche.«
»Das ist nun alles vorbei«, erwiderte ihr Mann, ohne sich von seinem Tisch fortzubewegen.
»Was heißt vorbei? Was willst du damit sagen? Wir sind da und Villefranche auch.«
»Du weißt sehr wohl, was ich damit sagen will. Möchtest du, dass ich dich daran erinnere, wo ich letzte Woche war?«
Das Klappern der Stricknadeln verstummte. Die kleine Hündin seufzte in die anhaltende Stille hinein.
»René ist Reservist«, sagte Madame Levêque schließlich und warf mir einen hilflosen Blick zu. »Sie haben ihn zu einem Manöver einberufen.«
»Ich kann euch nur sagen, das ist nicht gerade einfach, gleichzeitig noch ein Unternehmen zu leiten. Also, an dem Tag, an dem ich meinen Einberufungsbescheid erhalte …«
»Aber nein, das wird nicht geschehen«, sagte seine Frau und hantierte nervös mit ihrem Wollknäuel herum.
»Und ich sage dir, dass es passieren wird, und zwar schneller, als wir denken. Wir sollten lieber die Augen offen halten.«
»Werden Sie gehen?«
»Natürlich werde ich gehen, was soll ich denn Ihrer Meinung nach sonst tun? In meinem Alter werde ich wieder durchwachte Nächte, Gewaltmärsche und Pausen inmitten von Schlamm durchmachen müssen. Tage und Monate lang. Von den Granaten und dem Pfeifen der Kugeln ganz zu schweigen.«
»Und Sie, Marie?«, fragte Madame Levêque mit zugeschnürter Kehle. »Erzählen Sie uns ein wenig von sich, das bringt uns Abwechslung.«
»Oh, das ist schnell erzählt. Ich bin in Tarragona geboren, habe dort meine Kindheit verbracht, und ohne den Staatsstreich der Nationalisten wäre ich noch immer dort.«
»In Tarragona!«, wiederholte Monsieur Levêque mit eigenartiger Stimme. »Ihre … Ihre Eltern waren von dort?«
»Papa, ja. Bei Mama ist es komplizierter. Ich glaube, sie ist wie Sie in Algerien geboren. Ihre Eltern hatten sich dort niedergelassen. Aber sie ist zurückgekommen, warum, weiß ich nicht genau. Sie hat nie darüber gesprochen.«
»Sie hat nie darüber gesprochen?«
»Darf ich dich daran erinnern«, fiel Agnès ihm unfreundlich ins Wort, »dass wir uns hier in einem Wohnzimmer befinden, in unserem Wohnzimmer, und nicht in einem Folterraum der 24. Kolonialtruppe?«
Monsieur Levêque ließ es sich gesagt sein, aber seine Frau wollte mehr darüber wissen und brachte mich unsensibel, mit einer Frage nach der anderen, dazu, meine Leidensgeschichte zu erzählen. Ich fürchtete diese Rückkehr zu den schwierigen Momenten meines Lebens, doch in Wahrheit brachte es mir Erleichterung. Ich hatte das alles für mich behalten, ohne das Gewicht abzuschätzen, das dieses Schweigen meiner Seele auferlegte. Zu Beginn ließ ich mich ein wenig bitten, doch bald floss mein Bericht nur so dahin. Sie hörten mir alle zu, sogar die Kinder, und ich spürte, wie die Last im Verlauf des Erzählens immer mehr von meinen Schultern fiel.
Sie wollten, dass ich den Abend über bei ihnen blieb, doch ich fiel vor Müdigkeit fast um und fühlte mich erneut unwohl. Der Anblick dieser Familie erinnerte mich daran, dass ich die meine verloren hatte, und dieses Mal war es stärker als Granados, stärker als Das Mädchen und die Nachtigall. Die Verzweiflung im Herzen und die Hitzewellen, die meinen Körper durchliefen, die Anfälle von Schüttelfrost und Niedergeschlagenheit raubten mir jede Kraft. Was würden zudem die Puechs sagen, wenn ich sie vom ersten Abend an allein ließ? Es gelang mir, mich aus dem Sessel von Monsieur Levêque hochzuziehen, genau genommen aus dem Sessel seines Schwiegervaters, und Agnès begleitete mich zu meinem ›Zuhause‹.
Als wir so Arm in Arm unter den kahlen Ästen der Bäume auf dem kleinen Platz dahingingen, begriff ich durch einen Druck ihrer Hand, einen kleinen Seufzer, der ihr entfuhr, dass das Leben für sie nicht immer einfach war, entgegen allem Anschein.
»Ich wusste, dass es so enden würde«, sagte sie wütend. »In einem regelrechten Verhör.«
»Einem Verhör? Aber nein«, murmelte ich und sammelte meine Kräfte, »ich habe es nicht so empfunden. Soll ich dir etwas sagen? Ich habe so einen Empfang nicht erwartet. Im Allgemeinen sind die Franzosen sehr hart gegenüber den Flüchtlingen. Vor allem den Dienstmädchen. Sie behandeln sie wie Nichtsnutze.«
»Wie kommst du darauf?«
»Einige Kameraden in Argelès, die in französischen Familien untergebracht wurden, haben uns geschrieben und erzählt, wie es war. Nein, glaube mir, deine Eltern sind sehr gut, du …«
»Hör auf, Marie. Mein Vater ist unerträglich, das hast du doch gesehen.«
»Unerträglich?«
»Ja. Im Übrigen reden wir kaum miteinander. Guten Tag, auf Wiedersehen, und manchmal nicht einmal das. Und du, wie war es mit dir und deinem Vater?«
»Wunderbar!«, sagte ich und trat vor Rührung auf der Stelle. »Aber das war etwas anderes, uns verband die Musik. Er war der Erste, der mich unterrichtete, verstehst du? Das hat uns einander sehr nahegebracht. Mama sagte, dass wir beide ein Clan wären, ein Clan im Clan. Ja, wir haben uns oft unterhalten. Sehr oft. Auf jeden Fall wusste er von allem, was in meinem Innern vor sich ging. Also war es auch sinnlos, ihm etwas zu verheimlichen, ebenso gut konnte ich es ihm erzählen.«
»Das gibt es, ein Vater, der seine Tochter versteht?«
»Natürlich gibt es das.«
»An dem Tag, an dem mein Vater sich die Zeit nimmt, mir zuzuhören, nichts tut, als mir zuzuhören … und was das Verstehen angeht …«
Der Weg vom Vauban zur Bäckerei der Puechs war nicht sehr weit. Der Platz vor der Kirche, eine kleine Seitenstraße, einige Schritte in der Rue Saint-Jean, dafür brauchte man nur wenige Minuten.
»Mostaganem, das sagt mir etwas«, meinte ich, als wir ankamen. »Das ist seltsam, ich kenne nur einen Städtenamen in Algerien außer Algier und Constantine, und das ist ausgerechnet die Stadt, in der dein Vater geboren ist.«
»Und was sagt es dir?«
»Nichts«, antwortete ich nach einigem Nachdenken. »Nichts. Vielleicht etwas von der Seite meiner Mutter her. Meine Mutter war wie dein Vater: Sie sagte nicht ein Wort über ihre Vergangenheit.«