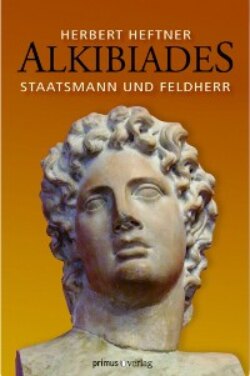Читать книгу Alkibiades - Herbert Heftner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kindheit und Jugendjahre
ОглавлениеPlaton macht es später dem Perikles zum Vorwurf, die Erziehung des Alkibiades in die Hände des „unbrauchbarsten unter seinen Sklaven, eines Thrakers namens Zopyros“, gelegt zu haben.7 Diese Behauptung des großen Philosophen dürfte von der Sache her zutreffen, die damit verbundene Kritik aber war zwar vom Standpunkt der hochgestimmten platonischen Erziehungsideale gerechtfertigt, nicht jedoch nach den im realen Leben Athens im 5. Jh. geltenden Maßstäben. Es war damals und noch in späteren Epochen der griechischen Geschichte durchaus üblich, für die Beaufsichtigung und Pflege der Kinder alte, für körperliche Tätigkeiten nicht mehr recht taugliche Sklaven abzustellen. Wenn Perikles bei seinen Pfleglingen dasselbe tat, kann dies gewiss nicht als Zeichen absichtlicher Vernachlässigung gedeutet werden. Im Übrigen beschränkte sich die Rolle des Paidagogos, ‚Knabenführers‘, auf die Beaufsichtigung der Kinder; der Unterricht im eigentlichen Sinne lag in den Händen von Lehrern, die ihre Tätigkeit hauptberuflich ausübten, sei es als Hauslehrer oder als Beisitzer eines eigenen kleinen Schulbetriebs. Solcher Unterricht ist natürlich auch dem jungen Alkibiades zuteil geworden. Alle darauf bezüglichen Nachrichten der Überlieferung deuten darauf hin, dass er die in den Kreisen der athenischen Oberschicht übliche Ausbildung in vollem Maße erhalten hat.8
Zu dieser Ausbildung gehörte zunächst einmal ein intensives Körpertraining, das einerseits auf Erfolg im sportlichen Wettkampf und in der Jagd, zugleich aber auch auf die Anforderungen des künftigen Militärdienstes abzielte. Gleichberechtigt stand daneben die Unterweisung in musischen Disziplinen wie Tanz, Gesang, Leier- und Flötenspiel – Künste, die von den griechischen Aristokraten sowohl im Rahmen privater Symposien als auch bei öffentlichen Festspielauftritten zu Ehren der Götter regelmäßig ausgeübt zu werden pflegten, und deren souveräne Beherrschung als Voraussetzung für die Entwicklung einer harmonischen Persönlichkeit galt. Neben diesen musisch-persönlichkeitsbildenden Unterrichtsgegenständen standen im damaligen Athen längst auch schon die im engeren Sinne intellektuellen Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens sowie die umfassende Kenntnis des großen literarischen Erbes der Griechenwelt auf dem ‚Bildungsplan‘ der aristokratischen Jugend.9
Abb. 1: Herme des Perikles. Rom, Vatikanische Museen
Alles in allem war das ein Bildungsgang, der darauf abzielte, körperliche Fitness, Aufgeschlossenheit für das Musische und literarisch-sprachliche Talente zu einer in sich ausgewogenen Verbindung zu bringen, deren äußerer Ausdruck dann eine an Körper und Geist wohlgestaltete, in den Kreisen der aristokratischen Standesgenossen präsentable Persönlichkeit sein sollte. Urteilen wir nach der Wirkung, die er auf seine Zeitgenossen ausübte, so kann kaum ein Athener diesem Bildungsziel besser entsprochen haben als der junge Alkibiades. Die Quellen sind sich darin einig, dass er von frühester Jugend an als der strahlendste Stern am Himmel der athenischen Aristokratenjugend gegolten hat.10
An konkreten Details sind uns aus seiner Kindheit allerdings nur wenige vereinzelte Episoden überliefert, anekdotenhaft zugespitzte Geschichten, die in ihrer Grundtendenz allerdings übereinstimmen. Sie alle stellen uns das Bild eines schon im Knaben- und Heranwachsendenalter extrem willensstarken und weit über das normale Maß hinaus von sich eingenommenen jungen Aristokraten vor Augen. So hören wir davon, dass er schon als kleines Kind beim Würfelspielen auf der Straße sich lieber überfahren lassen wollte, als einem Fuhrwerk Platz zu machen, das seinen Wurf zu verwischen drohte. Späterhin soll er das Erlernen des Flötenspiels, an sich ein fester Bestandteil des aristokratischen Bildungskanons, verweigert haben, weil ihm die damit verbundene unästhetische Verzerrung der Gesichtszüge zuwider gewesen sei.
Als die bekannteste unter diesen Kindheits-Anekdoten kann wohl eine von Plutarch, dem bedeutendsten unter den antiken Biographen des Alkibiades, überlieferte Episode gelten, die uns in die von Übermut und Wettstreitseifer erfüllte Atmosphäre der Knabenringschule führt: „Als er einmal beim Ringen von seinem Gegner umklammert wurde, riss er, um nicht zu Fall gebracht zu werden, die ihn umklammernden Arme des Gegners an seinen Mund und machte Anstalten, dessen Hände zu zerbeißen. Jener musste den Griff lockern und rief ‚O Alkibiades! Du beißt, wie die Frauen es zu tun pflegen!‘ Darauf erwiderte er: ‚Nicht wie die Frauen, sondern wie die Löwen.‘“11
Solche Anekdoten sind, soweit es die konkreten Fakten betrifft, in ihrem historischen Wert zweifelhaft; die meisten von ihnen sind wohl nichts anderes als gut pointierte Erfindungen, deren Schöpfer sich von dem enfant terrible-Image, das dem erwachsenen Alkibiades stets anhaftete, inspirieren ließen. Zusammengenommen bezeugen sie uns in ihrer übereinstimmenden Tendenz aber immerhin, dass dieses Image nach der Überzeugung der Athener bereits den Knaben Alkibiades charakterisiert hat.
Wir dürfen es daher wohl für glaubhaft halten, dass der Perikles-Zögling alles andere als ein pflegeleichtes Kind war, dass er aber trotz ungebärdigen Benehmens durch Schönheit, Charme und Brillanz immer wieder die Sympathien seiner Umwelt zu gewinnen verstand, dass ihm schließlich die Bestätigung, die er empfing, zu Kopf stieg und ihn in seinem Eigenwillen bestärkte.
Es lag in der Natur der Sache, dass das auf diesen frühen Prägungen beruhende Selbstgefühl sich noch um ein Beträchtliches verstärkt haben muss, als Alkibiades im frühen Jünglingsalter zum Objekt homoerotischer Aufmerksamkeiten zu werden begann. Päderastisches Liebeswerben und das Körperliche mehr als nur streifende Beziehungen zwischen reifen Männern und heranwachsenden Jünglingen gehörten im Athen der klassischen Epoche zum allgemein akzeptierten Brauch nicht nur, aber vor allem der aristokratischen Kreise. Für die Männer der athenischen Elite bedeutete das Bemühen um die Gunst vornehmer Knaben nicht nur ein Ausleben genuiner erotischer Gelüste, sondern auch ein Mittel zur Bestätigung des Sozialprestiges. Platon legt einem der Dialogpartner in seinem ‚Symposion‘ die Feststellung in den Mund, dass es in Athen gesellschaftlich akzeptiert war, dass ein Liebhaber, um den begehrten Knaben zu gewinnen, „seltsame Dinge“ zu tun pflegte, „für die er, wenn er sie bei der Verfolgung irgendeines anderen Ziels außer diesem wagte, schärfsten Tadel ernten würde … Denn wenn einer, etwa um Geld von irgendjemandem zu bekommen, oder um ein Amt oder eine Machtposition zu erlangen, solche Dinge täte, wie die Liebhaber, die ihre Knaben anbetteln und anflehen, ihnen Eide schwören, sich vor ihrer Türe hinlagern und willig Dienste verrichten wie kein Sklave sie tun würde, so würde man ihn daran hindern.“12
Das von Platon gezeichnete Sittenbild zeigt deutlich, in welchem Maße diese päderastischen Liebeständeleien von Theatralik und exhibitionistischer Selbstdarstellung bestimmt waren. Ähnlich dem ‚Minnedienst‘ des Hochmittelalters handelte es sich vor allem um ein Gesellschaftsspiel, mit dem die Angehörigen einer Adelselite sich gegenseitig ihre Standeszugehörigkeit bestätigen und zugleich die damit verbundenen ästhetisch-ethischen Normen zelebrieren konnten.
Für die umworbenen Jünglinge standen bei diesem Spiel ‚emotionale Gewinne‘ mannigfacher Art in Aussicht: das Gefühl des Beachtet- und Respektiertwerdens, die Steigerung des eigenen Sozialprestiges und nicht zuletzt die Chance, sich unter der Ägide eines gesellschaftlich etablierten Liebhaber-Mentors in die Kreise der Erwachsenenwelt zu integrieren.13
Eine mehr oder weniger unvermeidliche Folge dieser Konventionen lag darin, dass selbstbewusste Jünglinge, denen die Huldigungen ihrer Verehrer zu Kopf stiegen, in Versuchung gerieten, ihren Übermut an den schmachtenden Päderasten auszuleben; es war bezeichnend für Alkibiades, dass er auch in dieser Hinsicht über jedes gewohnte Maß hinausging. Sein Biograph Plutarch weiß diesbezüglich einige Anekdoten zu berichten, die den umschwärmten Jüngling teils als großzügigen Gönner, teils als hochmütigen Tyrannen zeigen. So soll er einem seiner Verehrer, einem wenig begüterten Metöken, als dieser ihm sein letztes Geld antrug, großzügig zu einem lukrativen Steuerpachtvertrag verholfen haben.
Das Kontrastbild dazu bildet die übermütige Brutalität, mit der er einen anderen seiner Anbeter, den wohlhabenden Anytos, behandelte. Plutarch zufolge hatte er dessen Einladung zu einem Gastgelage ausgeschlagen, war dann aber doch, tüchtig berauscht, an der Spitze einer Bande ausgelassener Jünglinge erschienen. Er trat ein, warf einen Blick auf das kostbare Tafelgeschirr und befahl seinen Dienern, die Hälfte davon einzupacken. Dies getan, zog er mit der erhaschten Beute nach Hause, ohne Anytos und seine Gäste weiter eines Blickes zu würdigen. Bezeichnenderweise soll der Hausherr diesen Übergriff gutwillig hingenommen und sogar gesagt haben, er hätte sich von Alkibiades auch noch die andere Hälfte nehmen lassen.
Plutarch knüpft an diese Anekdote die Feststellung, Alkibiades habe fast alle seine Liebhaber auf solche Weise behandelt; auch wenn der Biograph auf dieses Verhalten nicht näher eingeht, dürfen wir annehmen, dass manche von ihnen sich die Frechheiten ebenso gutwillig gefallen ließen wie Anytos.14
Erlebnisse dieser Art waren geeignet, einen schon von Haus aus mit einem überentwickelten Ego ausgestatteten Jüngling in seinem Übermut zu bestärken, und sie haben sicherlich ihren Teil zur Prägung des späteren Politikers Alkibiades beigetragen. Die Überzeugung, den eigenen Willen allem anderen voranstellen zu dürfen und sich ungestraft fast alles erlauben zu können, ist ihm bis ins Erwachsenenalter erhalten geblieben – wie sich zeigen sollte, zum Schaden nicht nur für ihn selbst, sondern auch für Athen.