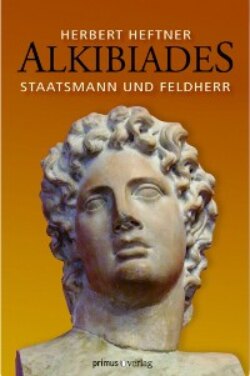Читать книгу Alkibiades - Herbert Heftner - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das geistige Umfeld von Alkibiades’ Jugend: Athen, das intellektuelle Zentrum Griechenlands
ОглавлениеDie Eskapaden des jungen Alkibiades, sein Charme und sein Auftreten erregten Aufsehen und verhalfen dem Perikleszögling, noch ehe er das volle Erwachsenenalter erreicht hatte, zu breiter Bekanntheit und einem feststehenden Image bei der athenischen Bürgerschaft. Seine Jugendjahre haben sich jedoch nicht in solchen Exzessen erschöpft; sie waren zugleich auch eine Zeit der Wissbegierde, des Lernens und der intellektuellen Formung.
Das Athen der 430er-Jahre hatte in geistiger und kultureller Hinsicht aufgeweckten jungen Leuten mehr Anregungen zu bieten als sie früheren Generationen zuteil geworden waren. Dank ihrer durch den Attischen Seebund begründeten politischen Vorrangstellung und den damit einhergehenden Gewinnen an Prestige und Wohlstand hatte sich die Stadt zum Zentrum des kulturellen Lebens der griechischen Welt entwickelt.
Zur Zeit von Alkibiades’ frühester Kindheit hatten die Athener ein Bauprogramm initiiert, dessen bedeutendste Errungenschaften schon von den Dimensionen und dem Reichtum der Ausstattung her zu den eindrucksvollsten Monumenten der Griechenwelt zählen durften, zugleich aber durch die vollendete Qualität ihrer Ausführung Standards setzten, die in der Folge für die Definition dessen, was wir unter der „Griechischen Klassik“ verstehen, maßgeblich geworden sind.
Der Parthenon auf der Akropolis, bis heute das große Wahrzeichen Athens, wurde im Jahre 438 eingeweiht, als Alkibiades etwa zwölf Jahre alt war; während seiner ‚Teenagerjahre‘ folgte der Bau der Propyläen, des in seiner Monumentalität bislang beispiellosen Eingangsbereiches der Akropolis. Unterhalb der Akropolis errichtete man das Odeion, einen für musikalische Aufführungen und andere Festivitäten bestimmten Hallenbau, der in seiner Form dem Prunkzelt des Perserkönigs nachgebildet gewesen sein soll und so den dem persischen Großreich als gleichberechtigt entgegengesetzten imperialen Machtanspruch Athens symbolisierte.15
In ihrer Verbindung von Größe, Ausstattungspracht und künstlerischer Vollendung waren diese Bauten dazu bestimmt, vor aller Welt Zeugnis für jenes Zusammenspiel von politischer Macht und kultureller Leistungsfähigkeit abzulegen, in dem sich nach Überzeugung vieler Zeitgenossen das Wesen der Polis Athen manifestierte. Sicherlich hat auch der junge Alkibiades sie so wahrgenommen und in ihrem Anblick den jedem Athener selbstverständlichen Stolz auf die Größe der Heimatstadt bestätigt gesehen. Vielleicht aber haben diese Großleistungen für ihn als Zögling des Perikles darüber hinaus noch einen ganz persönlichen Ansporn hin zur politischen Tätigkeit bedeutet.
Impulse für die Hinwendung zur Politik und zum öffentlichen Leben konnte ein junger Mann aus Alkibiades’ Generation auch aus dem literarischen und intellektuellen Leben der Zeit empfangen.
Die dramatische Dichtkunst, Athens großer Beitrag zur griechischen Literatur des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, war eine eminent politische Kunstform. Offenkundig war dies ebenfalls bei der Komödiendichtung, die immer wieder auf aktuelle politische und gesellschaftliche Themen Bezug nahm und die politischen Führer der Polis wie auch andere prominente Zeitgenossen zur Zielscheibe ihres von unbekümmerter Respektlosigkeit geprägten und mit einem guten Schuss ernst gemeinter Kritik versetzten Spottes zu machen pflegte.
Nicht in diesem tagesaktuellen Sinn, wohl aber in der Grundintention politisch ausgerichtet war auch die zeitgenössische Tragödiendichtung. Weit davon entfernt, ein Unterhaltungsmedium darzustellen, verstand sie sich als ein Mittel, das Volk von Athen mit den Problemen des Lebens in der Bürgergemeinschaft und den großen Fragen des Menschentums und seiner Stellung im Weltganzen zu konfrontieren.
Von den drei großen Tragödiendichtern, die allgemein als die überragenden Meister ihrer Kunst angesehen wurden, war der älteste, der urtümlich sprachgewaltige Aischylos, bereits vor Alkibiades’ Geburt gestorben, seine Werke waren aber immer noch fest im Bewusstsein der Athener verankert. Sophokles, der künstlerisch ausgewogenste, ‚klassischste‘ der attischen Tragiker, stand auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, und neben ihm wirkte bereits Euripides, der große Problematisierer der Widersprüche menschlicher Existenz, der als Gestalter zwiespältiger Charaktere und Zweifler an etablierten Werten bei den Zeitgenossen oftmals Befremden erregte, bei der Nachwelt aber bis in die Moderne hinein die stärkste Nachwirkung entfalten sollte.
Die Dramen dieser Bühnendichter wurden an sich nur für die einmalige Aufführung im Rahmen der alljährlich zu Ehren des Dionysos gehaltenen dramatischen Wettbewerbe verfasst, blieben aber durch private Rezeption, teils auch schon durch schriftliche Verbreitung über den Entstehungs-Anlass hinaus lebendig und fanden auch außerhalb des athenischen Publikums reges Interesse.16
Zentrum der kulturellen Entwicklung Griechenlands war Athen nicht nur durch Bildkunst und Dichtung, sondern auch dank seiner Bedeutung als Schauplatz der philosophisch-humanwissenschaftlichen intellektuellen Debatte. Führende Vertreter des philosophischen Denkens der Zeit fanden hier einen Ort des gegenseitigen Austausches und eine Bühne für die Darlegung ihrer Lehren und Erkenntnisse, für die sich in den intellektuell aufgeschlossenen Kreisen der Bürgerschaft ein interessiertes Publikum fand. Stärker als anderswo scheinen die von der zeitgenössischen Philosophie ausgehenden Denkanstöße in Athen Einfluss auf die geistige Formung der aristokratischen Jugend gewonnen zu haben. Damit wurde die Stadt zum Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen den Anhängern der traditionellen Bildungswelt und den Protagonisten eines neuen, sich auf Skepsis, Spekulation und rationeller Erkenntnis gründenden Weltverständnisses.
Die traditionelle Bildung, landläufig mit dem Ausdruck Sophia, ‚Weisheit‘, bezeichnet, hatte sich, soweit es die Grundlagen der von ihr vermittelten Kenntnisse betraf, auf die mythische Überlieferung, die Autorität von Dichtern wie Homer und Hesiod und auf die Weltklugheit allgemein respektierter Geistesgrößen der Vergangenheit gestützt. Der aus diesen Quellen geschöpfte Schatz an Kenntnissen, Dogmen und Lebensregeln galt weithin als sakrosankt und pflegte von den Traditionalisten unhinterfragt hingenommen zu werden; der Gedanke, dieses Wissensgut einer kritischen Prüfung zu unterziehen und womöglich durch eigene Überlegungen zu erweitern, lag ihnen meistenteils fern.17
Genau dieses Streben nach eigener Erkenntnis aber bildete den gemeinsamen Nenner und das Hauptanliegen einer ganzen Reihe neuer Denkschulen, deren inhaltliches Spektrum vom eher naturphilosophisch ausgerichteten reinen Erkenntnisstreben bis hin zum Bemühen um eine Verbindung von Wissen und praktischer Lebensbewältigung reichte.
Hatten zur Zeit von Alkibiades’ Kindheit und früher Jugend Naturphilosophen, wie etwa der Periklesfreund Anaxagoras, die repräsentativen Denkerfiguren dargestellt, begann zu der Zeit, als unser Held ins reifere Jünglingsalter trat, ein neuer Philosophentyp in den Vordergrund zu treten, die sogenannten Sophisten. Deren Forschungsinteressen berührten die unterschiedlichsten Wissensgebiete, und auch ihre Lehren waren im einzelnen recht unterschiedlich. Was sie in den Augen des athenischen Durchschnittsbürgers als Vertreter ein und derselben ‚Schule‘ erscheinen ließ, waren ihr Auftreten als berufsmäßige Weisheitslehrer, ihr Anspruch, lebenspraktisches Wissen vermitteln zu können, vor allem aber die von ihnen gepflegte Verbindung von Weisheitslehre und Redekunst. Fast alle Sophisten pflegten regelmäßig als Publikumsredner aufzutreten, und in ihrem sonst vielfältig bunten Lehrprogramm nahm stets der Unterricht in der Kunst der öffentlichen Rede einen bevorzugten Platz ein.
Was die inhaltliche Ausrichtung ihrer Lehren betrifft, standen die Sophisten dem um seiner selbst willen betriebenen Erkenntnisstreben der Naturphilosophen skeptisch gegenüber. Da aus ihrer Sicht das Denken auf praktischen Nutzen hinzuzielen hatte, schien es ihnen angebracht, sich auf die Beschäftigung mit für den Menschen sinnlich oder verstandesmäßig fassbaren Fakten zu beschränken und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Wahrnehmung dieser Fakten zwangsläufig von Mensch zu Mensch divergieren musste. Protagoras, der führende Kopf unter den frühen Sophisten, hat diese Orientierung mit dem berühmt gewordenen programmatischen Satz, dass „der Mensch das Maß aller Dinge“ sei, treffend auf den Punkt gebracht. Aus dieser Grundorientierung heraus war es dann nur folgerichtig, wenn die Sophisten sich in ihrer Haltung der überlieferten Religion und den philosophischen Spekulationen über das Göttliche gegenüber gleichermaßen auf den Standpunkt eines skeptischen Agnostizismus zurückzogen. Wiederum ist es Protagoras, dem wir die treffendste Charakteristik verdanken: „Hinsichtlich der Götter habe ich nicht die Möglichkeit, etwas zu wissen; weder dass es sie gibt, noch dass es sie nicht gibt, noch, welches ihre Gestalt sein mag; vieles nämlich hindert unsere Erkenntnis: ihre Unsichtbarkeit und die Kürze des Menschenlebens.“18
Es war klar, dass solche Grundsätze die Sophisten und ihre Anhänger in den Augen der in ihrer Mehrheit immer noch traditionell-frommen Athener Bürger in ein zweifelhaftes Licht setzen mussten. Ihr Rhetorikunterricht und die Tatsache, dass manche von ihnen die Verbindlichkeit der geltenden Gesetze in Zweifel zu ziehen wagten, indem sie den von der Polis gesetzten Rechtsnormen das Konzept der Physis, der unveränderlichen menschlichen Natur, entgegenstellten, trugen noch zusätzlich dazu bei, die Sophisten in den Augen konservativer Bürger als moralfreie Opportunisten, Spötter und Verächter aller für heilig gehaltenen Werte erscheinen zu lassen. Gerade deshalb aber übten sie eine starke Anziehungskraft auf intelligente junge Männer der Oberschicht aus, die an ihren Tabubrüchen Gefallen fanden, sich vom Wort- und Gedankenspiel des philosophischen Disputs intellektuell angezogen fühlten und zugleich hofften, im Unterricht der Sophisten das rednerische Rüstzeug für eine Karriere als Politiker zu erlangen.19
Alkibiades kann von dem zur Zeit seiner Jugendjahre in Athen herrschenden Klima der intellektuellen Veränderung nicht unberührt geblieben sein. Sein Vormund Perikles stand in engen Beziehungen zu literarischen und philosophischen Größen wie Sophokles und Anaxagoras, er hat oftmals auch anderen Vertretern des zeitgenössischen Denkens in seinem Haus gastfreundliche Aufnahme gewährt, so etwa dem schon genannten Sophisten-Vorkämpfer Protagoras. Schon durch die in diesem Umfeld miterlebten Gespräche hatte der junge Alkibiades beste Gelegenheit, mit den geistigen Strömungen der Epoche Bekanntschaft zu schließen, und es ist kaum vorstellbar, dass ein aufgeweckter Geist wie der seine an diesen Themen und an der Art, wie sie behandelt zu werden pflegten, kein Interesse gefunden haben sollte. Nicht nur aufgrund dieser frühen Erfahrungen, sondern auch im Hinblick auf die generelle Popularität der modernistisch-philosophischen Bildungsgüter in den Kreisen der jungen Aristokraten Athens stand es zu erwarten, dass auch Alkibiades sich dem Schülerkreis eines ‚Weisheitslehrers‘ anschließen würde. Nicht wenigen Zeitgenossen dürfte er mit seiner respektlos-kritischen Haltung gegenüber allen Autoritäten, seinem Talent für das geschliffene Wort und seinem Hang zur egozentrischen Selbstdarstellung als typischer potentieller Sophisten-Adept erschienen sein.
Doch es kam anders. Statt in die Schulen der Sophisten führte Alkibiades’ Weg in den Kreis eines Mannes, der zwar der breiten Öffentlichkeit als ein Sophist unter vielen galt, unter seinen Schülern aber als entschiedener Gegner und Überwinder des Sophistentums gewertet wurde: Sokrates.
Mit ihm tritt eine Gestalt in das Leben des Alkibiades, die den Freunden klassischen Geistesguts besser vertraut zu sein scheint als jede andere Persönlichkeit des klassischen Athen.
Dank der Darstellungskunst des Platon und anderer Sokratesschüler ist die Gestalt des silenhaften, bärtigen Weisen, der disputierend sein Athen durchstreift, mit Ironie und hintergründigen Fragen seine in ihren Anschauungen allzu gefestigten Gesprächspartner aufs Glatteis führt, dabei zugleich der Schar seiner meist jugendlichen Anhänger die Suche nach Wahrheit und Tugend ans Herz legt, Teil des Allgemeingutes klassischer Bildung geworden.20
Zu diesem Bild gehört untrennbar auch das ideal gezeichnete Verhältnis zwischen Sokrates und Alkibiades, der, wenn wir Platon Glauben schenken wollen, von den späten 430er-Jahren an zu dem Philosophen in einer Verbindung gestanden haben soll, die über ein Lehrer-Schüler-Verhältnis hinaus dem Idealbeispiel eines pädagogisch motivierten Liebesverhältnisses nahegekommen sein soll.
Gleichsam die repräsentative Zusammenfassung dieser verklärten Sicht der Sokrates-Alkibiades-Beziehung bietet uns der Platonverehrer Plutarch in seiner Alkibiadesbiographie:
„Als schon viele und vornehme Männer ihn umdrängelten und umschwärmten, da war es offenkundig, dass die übrigen ihm nachliefen, weil der Glanz seiner Jugendschönheit sie in seinen Bann schlug, des Sokrates’ Eros aber war ein starkes Zeugnis für die zur Tugend hindrängende Natur des Knaben, die jener hinter Alkibiades’ äußerem Erscheinungsbild hervorleuchten sah. Er fürchtete die Wirkung des Reichtums und des Ruhmes und die Masse von Bürgern, Fremden und Bundesgenossen, die ihn mit Schmeicheleien und Liebedienereien zu umgarnen suchten, und war imstande, ihn zu schützen und nicht zuzulassen, dass er wie eine Blume in ihrer Blütezeit die ihm innewohnende Frucht wegwerfe und verderbe … So kam es, dass Alkibiades, obwohl er von allem Anfang an von den ihn umdrängenden Schmeichlern verzogen und davon abgehalten worden war, auf einen vernünftigen Erzieher zu hören, dank seiner guten Naturanlagen den Sokrates erkannte und ihm folgte … Das Wirken des Sokrates erschien ihm in der Tat als ein göttlicher Auftrag zum Nutzen und zur Rettung der Jugend; er verachtete sich selbst, bewunderte jenen, genoss die Freundschaft mit ihm und schämte sich vor der Tugend des anderen. Unversehens wurde er von ‚der Liebe Widerspiegelung, der Gegenliebe‘, wie Platon sie nennt, erfasst, so dass alle sich wunderten, wenn sie sahen, dass er, der sich allen anderen Liebhabern gegenüber so unfreundlich und unnahbar gezeigt hatte, jetzt mit Sokrates einträchtig zusammenspeiste, gemeinsam mit ihm in der Ringschule übte und sein Zelt teilte.“21
Plutarchs Schilderung lässt deutlich erkennen, wie sehr die von der idealisierten Vorstellung vom Wirken des sokratischen „pädagogischen Eros“ auf den egozentrischen, aber bildungsfähigen Aristokratenjüngling ausgehende Faszination den platongläubigen Biographen in ihren Bann geschlagen hat; sie hat denn auch in jenen Kreisen, die der Philosophie einen vornehmlich pädagogischen Auftrag zuerkennen möchten, bis in die Neuzeit hinein eine starke Wirkung entfaltet.
Unglücklicherweise bleibt von dem schönen Bild, wenn man es mit den Mitteln der kritischen Wissenschaft zu hinterfragen beginnt, nicht viel übrig, was als historisch zuverlässig oder auch nur einigermaßen wahrscheinlich gelten könnte.
Abb. 2: Sokrates findet Alkibiades, Karl von Blass (1836)
Den Schilderungen Platons von der langen und vertrauten Beziehung zwischen Sokrates und Alkibiades steht die Angabe eines anderes Sokratesschülers, des Philosophen und Historikers Xenophon, gegenüber, demzufolge Alkibiades sich bald von Sokrates abgewendet habe, weil er in dessen Lehren nichts mehr gefunden habe, was ihm bei seinem Streben nach Macht und Ansehen nützlich erschienen wäre.22
Angesichts dieses Widerspruches einerseits und der mit Händen zu greifenden moralisch-didaktischen Ausschmückungen andererseits bleibt als historischer Kern der Sokrates-Alkibiades-Legende nicht viel mehr als das bloße Faktum einer zeitweiligen engeren Beziehung zwischen dem aufstrebenden jungen Aristokraten und dem Philosophen übrig. Wir dürfen es für glaubhaft halten, dass Alkibiades in seinen jungen Jahren eine Zeitlang zum engeren Kreis der sich um Sokrates scharenden Jünglinge gehört hat und dass er damals – in welchem Sinne auch immer – der ‚Geliebte‘ des Philosophen gewesen ist. Ob sich daraus aber eine auch noch in späterer Zeit wirksame freundschaftlich-vertraute Bindung zwischen ihnen entwickelt hat, muss ebenso ungewiss bleiben wie die Frage, was Alkibiades in geistiger Hinsicht aus dieser Beziehung mitgenommen hat. Letztere lässt sich schon deshalb kaum beantworten, weil im überlieferten Schrifttum die authentische Lehre des Sokrates unter den Gedankengebäuden begraben ist, die seine Schüler, Platon allen voran, darauf errichtet haben.
Im Hinblick auf diese Ungewissheiten tut der Historiker gut daran, in der Frage nach Sokrates’ Einfluss auf die geistige Formung des Alkibiades Zurückhaltung zu üben. Wir wollen uns auf die Feststellung beschränken, dass jedenfalls von dem, was nach dem Zeugnis fast aller Quellen der Kern von Sokrates’ Lehren gewesen ist, nämlich der Anleitung zur Hintanstellung aller Äußerlichkeiten und zur Fürsorge für die eigene Seele, im späteren Leben des Alkibiades nicht viel zu finden ist.23
Das Sokrateserlebnis des Alkibiades scheint also, selbst wenn es auf der menschlichen Ebene ein bleibendes Band der Sympathie begründet hat, im Geistig-Moralischen von recht begrenzter Wirkung gewesen zu sein. Den Grund dafür dürfen wir getrost in der Unvereinbarkeit der von den beiden verfolgten Lebenshaltungen erkennen. Während Sokrates seinen Adepten das Streben nach Selbsterkenntnis und Seelenpflege ans Herz legte, hatte Alkibiades sich schon sehr früh für ein Lebensziel entschieden, das mit den von dem Philosophen vertretenen Idealen kaum in Einklang zu bringen war: die Erlangung einer politischen Führungsposition.