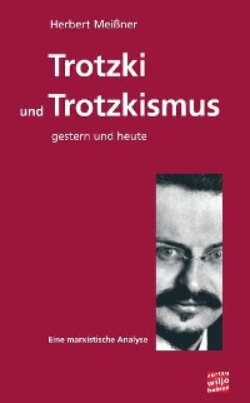Читать книгу Trotzki und Trotzkismus - gestern und heute - Herbert Meißner - Страница 13
6.1 Erste Etappe: 1918 – 1924
ОглавлениеDieser Prozess begann bereits im Herbst 1918 während des Bürgerkrieges. Die äußerst wichtige Südfront war ins Wanken geraten und drohte zusammenzubrechen. Sie wurde von Woroschilow kommandiert, der von Stalin protegiert wurde. Zur Stabilisierung der Front nahm Trotzki als Oberkommandierender eine Reorganisation der Front in Angriff, die im Gegensatz zu Woroschilows und Stalins Strategie stand. Dies stieß auf solchen Widerspruch Stalins, dass dieser sich in Moskau über Trotzki offiziell beschwerte. Stalin forderte militärische Vollmachten, obwohl er nicht als Militär nach Zarizyn entsandt worden war, sondern als Verwaltungsbeamter zur Sicherung der notwendigen Getreidetransporte nach Moskau. Lenin, der diese Zwistigkeiten aufmerksam verfolgte, gab zunächst Stalin nach und erteilte ihm die gewünschten Vollmachten. Als aber Stalin auf einen der Befehle des Oberkommandierenden Trotzki an Abschnittskommandeure die Randbemerkung schrieb: »Nicht beachten«, kam das Fass zum Überlaufen und Trotzki telegrafierte nach Moskau: »Ich bestehe kategorisch auf der Abberufung Stalins: Die Dinge entwickeln sich auf der Zarizyn-Front trotz überreichlicher Militärkräfte schlecht. Woroschilow ist befähigt, ein Regiment zu kommandieren, aber keine Armee von 50.000 Menschen.« Lenin gab Trotzki recht und zwei Tage danach wurde Stalin nach Moskau zurückbeordert.
Am Rande sei bemerkt, dass Woroschilow auch später stets auf Seiten Stalins zu finden war und dafür mit der Mitgliedschaft im Politbüro und dem Posten des Verteidigungsministers belohnt wurde. Und dies, obwohl er weder im Bürgerkrieg mit Männern wie Tuchatschewski oder Budjonny vergleichbar war und auch im II. Weltkrieg neben Heerführern wie Tschuikow oder Shukow keine Rolle spielte.
Den zweiten größeren Zusammenstoß gab es 1920 im Zusammenhang mit der sogenannten Gewerkschaftsfrage. Trotzki wollte im Interesse eines wirksameren wirtschaftlichen Aufbaus die Arbeit der Gewerkschaften straffen und dabei vom Prinzip der Wählbarkeit ihrer Leitungen zum Prinzip der Ernennungen übergehen. Dabei bestand aber die Gefahr, dass militärische Leitungsmethoden in die Gewerkschaften und in die Betriebe getragen werden. Bei den Auseinandersetzungen hierüber bildeten sich bereits zwei Gruppierungen. Trotzki wurde unterstützt von Preobraschenski, Radek, Serebrjakow und Smirnow. Stalin war gegen Trotzkis Vorschlag und an seiner Seite standen Sinowjew, Molotow, Woroschilow und Ordschonikidse. Lenin hielt sich zunächst zurück, sorgte sich aber dann um die Möglichkeiten der Einflussnahme der Arbeiter und um die Entfaltung von Wirtschaftsdemokratie und trat ebenfalls gegen Trotzkis Vorstellungen auf. Damit war dieser Streit entschieden. Aber ungeachtet dieses Streitpunktes selbst nahm nun der Gegensatz Trotzki–Stalin schon Gruppierungsform an.
Die nächste Kollision hing mit der Einführung der NÖP zusammen. Trotzki stand voll auf der Seite Lenins. Aber es gab in der Führung eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit hinsichtlich des wirtschaftspolitisch äußerst wichtigen Außenhandelsmonopols des Staates. Lenin und mit ihm Trotzki bestand auf der Beibehaltung des Außenhandelsmonopols, um die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen des Landes unter Kontrolle zu halten. Stalin und einige andere Parteiführer (z.B. Bucharin, Sokolnikow u.a.) plädierten für seine Abschaffung oder wenigstens Einschränkung. In krankheitsbedingter Abwesenheit Lenins wurden auf der Plenartagung des ZK am 6. Oktober 1922 Maßnahmen beschlossen, die eine »Durchbrechung des Außenhandelsmonopols« (Lenin) bedeuteten. Als Lenin davon Kenntnis erhielt, hat er sofort in einem Brief vom 13. Oktober 1922 ausführlich begründet, weshalb dieser Beschluss ein Fehler war. [34] Einen Tag vorher hatte Lenin ein Gespräch mit Stalin, um diesen zu überzeugen. [35] Daraufhin argumentierte Lenin nochmals in einem Brief »Über das Außenhandelsmonopol – An Genossen Stalin für die Plenartagung des ZK« [36] Auf diesen Brief hat Stalin eigenhändig wie folgt reagiert: »Der Brief des Genossen Lenin hat meine Ansicht über die Richtigkeit der Entscheidung …, den Außenhandel betreffend, nicht geändert.« Daraufhin wurde die Sache dem ZK-Plenum vom 18. Dezember 1922 vorgetragen, an dem aber Lenin wiederum nicht teilnehmen konnte. Und jetzt kommt das für diese Thematik Wesentliche: Lenin schrieb am 15. Dezember 1922 an Trotzki: »Genosse Trotzki, ich glaube, wir sind zu einem vollen Einverständnis gelangt, und ich bitte sie, auf der Plenarsitzung unsere solidarische Haltung zu bekunden.« Und in einem Brief an die Mitglieder des ZK schrieb Lenin: »Ich bin zu einem Einvernehmen mit Trotzki in der Vertretung meiner Ansichten über das Außenhandelsmonopol gekommen… Ich bin überzeugt, dass Trotzki meinen Standpunkt genauso gut wie ich selbst verteidigen wird« – was auch geschah. Am 18. Dezember widerrief das ZK seine Entscheidung vom Oktober und folgte Lenins und Trotzkis Argumenten. Was dieser Vorgang für das Verhältnis Stalin–Trotzki bedeutete muss man nicht ausführen.
Nun verschärften sich schrittweise auch die Auseinandersetzungen Lenins mit Stalin. Dieser betrieb als Volkskommissar für Nationalitätenfragen die Einverleibung Georgiens in die Russische Förderation von Sowjetrepubliken, und dies zum Teil mit militärischer Gewalt und bei Einschränkung von Georgiens Autonomie. Lenin war strikt gegen einen solchen Weg. Er wurde durch Intrigen, Desinformationen und Unterschlagung von Fakten hingehalten, bis er Schritt um Schritt die Gefährlichkeit der stillschweigend angehäuften Machtfülle Stalins erkannte. Da Lenin aus gesundheitlichen Gründen an der ZK-Sitzung zu diesem Thema nicht teilnehmen konnte, schrieb er am 5. März 1923 folgenden Brief an Trotzki: »Ich möchte Sie sehr bitten, die Verteidigung der georgischen Sache im ZK der Partei zu übernehmen. Die Angelegenheit steht jetzt unter ›Verfolgung‹ von Stalin und Dserschinski, und ich kann mich auf deren Unparteilichkeit nicht verlassen. Sogar im Gegenteil. Wenn Sie bereit wären, die Verteidigung zu übernehmen, könnte ich ruhig sein… Mit bestem kameradschaftlichen Gruß Lenin.« Dieser Brief zeigt erneut einerseits das große Vertrauen Lenins zu Trotzki und das wachsende Misstrauen gegenüber Stalin. Aber dies hat auch einen persönlichen Aspekt. Lenin unterzeichnete offizielle Dokumente, Anweisungen und politische Briefe allgemein nur mit »Lenin«. An Personen gerichtete Briefe meist »Mit kommunistischem Gruß«. An Vertraute wie Maxim Gorki mit »Ihr Lenin«. Es werden kaum Schriftstücke zu finden sein, unter denen steht: »Mit bestem kameradschaftlichen Gruß«.
In diesen Zusammenhang gehört auch, dass Lenin zu diesem Zeitpunkt damit begann, ernsthaft gegen Verbürokratisierung, Schlamperei und Vetternwirtschaft aufzutreten. In einem Brief an den Parteitag bezog er sich auf die Aufgabe, »unseren Apparat zu überprüfen, zu verbessern und neu zu gestalten. Die Arbeiter- und Bauerninspektion, die diese Funktion zunächst innehatte, erwies sich als außerstande, ihr gerecht zu werden…« [37] In einem Brief »An die Kollegiumsmitglieder des Volkskommissariats der Arbeiter- und Bauerninspektion« vom 21. August 1922 heißt es: »Ich habe immer gehofft, dass der Zustrom neuer Funktionäre in das Kollegium der Arbeiter- und Bauerninspektion die Sache beleben wird, aber aus dem, was Stalin sagte, konnte ich nichts dergleichen ersehen.« [38] In seiner bekannten Arbeit »Lieber weniger aber besser« kam Lenin am 2. März 1923 erneut auf die Arbeiter- und Bauerninspektion zurück. Er stellte fest: »Sprechen wir offen. Das Volkskommissariat der Arbeiter- und Bauerninspektion genießt gegenwärtig nicht die geringste Autorität. Jedermann weiß, dass es keine schlechter organisierten Institutionen als die unserer Arbeiter- und Bauerninspektion gibt und dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen von diesem Volkskommissariat rein gar nichts zu erwarten ist.« [39] Für die Arbeit dieses Volkskommissariats war aber Stalin verantwortlich, weshalb Lenin auch mit diesem das oben angeführte kritische Gespräch führte. Insofern ging die ganze harte Kritik in hohem Maße an Stalins Adresse.
Obwohl Trotzki in dieser Hinsicht nicht explizit in Erscheinung trat, entwickelten sich die Dinge angesichts von Lenins Kampf gegen Verbürokratisierung, Misswirtschaft und Herrschaft der Apparate in eine Richtung, in der Stalin gegenüber seinem Widersacher Trotzki immer mehr ins Hintertreffen geriet. Lenin hat diese Gegnerschaft mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und darin eine Gefahr für die Stabilität der Partei erkannt. In seinem berühmten »Brief an den Parteitag«, der häufig als eine Art Testament angesehen wird, schrieb er am 24. Dezember 1922: »Ich denke, ausschlaggebend sind in der Frage der Stabilität unter diesem Gesichtspunkt solche Mitglieder des ZK wie Stalin und Trotzki. Die Beziehungen zwischen ihnen stellen meines Erachtens die größere Hälfte der Gefahr jener Spaltung dar, die vermieden werden könnte…« [40] Und Lenin setzt fort: »Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert, und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen.« [41] Über Trotzki schrieb er, dieser zeichnet sich »… nicht nur durch hervorragende Fähigkeiten aus. Persönlich ist er wohl der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK, aber auch ein Mensch, der ein Übermaß von Selbstbewusstsein und eine übermäßige Vorliebe für rein administrative Maßnahmen hat.« [42]
Aber zwei Wochen später, d.h. am 4. Januar 1923, fügt Lenin dem eine Ergänzung zu. Hier geht er einen deutlichen Schritt weiter und stellt fest: »Stalin ist zu grob, und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte und jemand anderen an diese Stelle zu setzen…« [43] Und Lenin zählt nochmals jene Verhaltensweisen Stalins auf, die unter dem Sammelbegriff Grobheit subsumiert sind und die ein anderer Generalsekretär nicht haben darf: »… dass er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft usw. ist.« [44]
Mit welch aus heutiger Sicht wirklich genial zu nennendem Weitblick Lenin dieses Problem erkannt hat, zeigt sich an folgender Bemerkung: »Es könnte so scheinen als sei dieser Umstand eine winzige Kleinigkeit. Ich glaube jedoch, unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung einer Spaltung und unter dem Gesichtspunkt der von mir oben geschilderten Beziehungen zwischen Stalin und Trotzki ist das keine Kleinigkeit, oder eine solche Kleinigkeit, die entscheidende Bedeutung erlangen kann.« [45] Heute ist bekannt, welch entscheidende Bedeutung »diese Kleinigkeit« für die KPdSU und für die gesamte internationale Arbeiterbewegung erlangt hat.
Am 21. Januar 1924 starb Lenin.
Damit war die erste Periode der Herausbildung des Trotzkismus beendet. Wieso ist das so zu kennzeichnen, wo doch dieser Begriff in der Zeit von 1918 bis 1924 noch gar nicht auftaucht? Das lässt sich daraus ableiten, dass sich die politischen Gegensätze zwischen Stalin und Trotzki in dieser Zeit an jeweils sehr unterschiedlichen Vorgängen entzündeten. Ihnen lag noch keine konzeptionelle und strategische Gestalt zugrunde. Erst mit der Verhärtung des Verhältnisses von Lenin zu Stalin, mit der Leninschen Empfehlung der Abberufung Stalins, mit der Ankündigung Lenins des Abbruchs aller persönlicher Beziehungen zu Stalin, wenn dieser sich nicht bei Lenins Frau Nadeschda Konstantinovna Krupskaja für erfolgte grobe Beleidigungen entschuldige – erst dann erkannte Stalin die akute Gefahr seines Machtverlustes. Es entstand für ihn die Notwendigkeit, seinem Konflikt mit Trotzki eine theoretische Konzeption unterzulegen. Insofern kann die Zeit bis zu Lenins Tod als erste Periode oder als Vorstufe für die Entstehung des Trotzkismus betrachtet werden.