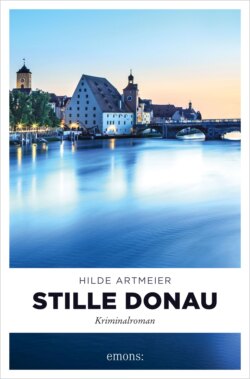Читать книгу Stille Donau - Hilde Artmeier - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеAlles begann mit Benedettas Leidenschaft für Regensburgs Gotteshäuser. Im Alten Rathaus war die junge Römerin schon gewesen, bei der jahrtausendealten Porta Praetoria und auf der Steinernen Brücke sowieso. Und nun also die Kirchen.
»Vor einer halben Stunde hätte sie mich ablösen sollen, vor einer halben Stunde!«, rief Mona mir empört ins Ohr. »Diese Kuh, ständig treibt sie sich nur herum, also echt, ich hab so was von die Nase voll!«
Die stellvertretende Geschäftsführerin meiner Boutique hatte mich angerufen und sich mit jedem Wort noch mehr in Rage geredet. Ich hatte bisher keine Möglichkeit gefunden, ihrem Redeschwall Einhalt zu gebieten. Nun schnaubte sie wie die Dampflok des Fränkischen Museums-Eisenbahnvereins, und ich nutzte die Gelegenheit.
»Mona, ich bin gerade mitten in einem geschäftlichen Termin, ich kann jetzt nicht …«
»Ich bringe sie um«, unterbrach sie mich wütend. »Ehrlich, Anna, dieses Mal bringe ich sie um.«
Sie hatte so laut gesprochen, dass das betagte Paar mir gegenüber, immerhin meine neuen Auftraggeber, vermutlich jedes Wort aus meinem Mobiltelefon verstanden hatte. Ich lächelte den beiden beruhigend zu. Ihre alarmierten Blicke waren mir nicht entgangen.
»Dabei sollte ich längst im Amtsgericht sein.« Mona verlegte sich nun aufs Jammern, wurde dabei aber keine Spur leiser. »Du weißt doch, ich muss zum Anwalt. Was mache ich jetzt bloß?«
»Non c’è problema«, entgegnete ich in meiner ersten Muttersprache und strahlte das trotz ihres Alters rüstige Architektenpaar mit unverändert gelöster Miene an. »Kein Problem, wir besprechen das gleich persönlich. In einer Viertelstunde?«
»Du bist die Beste.« Ein Stoßseufzer. »Die nächsten hundert Jahre kannst du mich als Babysitter einplanen, Anna-Schätzchen«, fügte Mona hinzu, jetzt wieder in ihrem üblichen frech-fröhlichen Tonfall. »Bis gleich im Laden, okay?«
Betont entspannt steckte ich das Smartphone in meine Handtasche aus regenbogenbuntem Patchwork, entschuldigte mich für die Störung und warf einen Blick auf das vor mir liegende Notizbuch. Alles Wesentliche hatte ich notiert, auch das Honorar für den neuen Auftrag war geklärt. Es war, man konnte es nicht anders nennen, geradezu fürstlich.
»Gut, dann bräuchte ich nur noch die Fotos der drei Gemälde, die ich für Sie ausfindig machen soll.« Ich schlug ein Bein übers andere. »Bis Mitte, spätestens Ende nächster Woche sollte die Angelegenheit erledigt sein.«
Und ich unterwegs in die Toskana, um dort gemeinsam mit meinem Lebensgefährten Maximilian und meinem Sohn Vincenzo unseren alljährlichen Sommerurlaub bei meinen Verwandten zu verbringen. Diese zusätzliche Motivation, den neuen Auftrag so bald schon abzuschließen, würde ich meinen Klienten jedoch selbstverständlich nicht auf die Nase binden.
»Das klingt ja vielversprechend«, sagte Julius Kalterer mit seiner sonoren Altmännerstimme. »So können wir also doch noch unbesorgt an die Nordsee fahren, wie wunderbar. Sylt ist die beste Gegend zum Entschleunigen, wie man heutzutage so schön sagt.«
Er legte seiner Frau, die neben ihm saß, die Rechte auf ihre im Schoß flatternden Hände. Dann ergriff er seine Pfeife, die im Aschenbecher auf dem Schellacktischchen zwischen uns lag, ließ das goldene Feuerzeug ein paarmal klicken, nahm einen tiefen Zug und blies einen Rauchkringel in die klimatisierte Luft.
»Die Fotos kriegen Sie per Mail, gleich im Anschluss.« Er sah dem nach Bergamotte duftenden, kreisförmigen Gebilde nach. »Und auch alle sonstigen Eckdaten.«
Zu Beginn unseres Termins hatte der nahezu Achtzigjährige mit jugendlich flamingoroter Hornbrille mir erklärt, das Zimmer, in dem unsere Besprechung stattfand, sei das einzige in der ganzen Wohnung, in dem er rauchen dürfe. Bei den Drucken und Bildern, die die Sitzecke mit den gediegenen Ledersesseln auf drei Seiten schmückten, handelte es sich um die »robusteren Exemplare« der Kalterer’schen Sammlung. Ich war keine Kunstexpertin, schätzte aber den Wert jedes der hier ausgestellten Werke im drei- bis vierstelligen Bereich ein.
»Und bitte, achten Sie auf äußerste Diskretion«, schärfte er mir nun schon zum dritten Mal ein, als ich auch das Notizbuch in der Tasche verstaute. »Wenn sich herumspricht, dass wir eine Privatdetektivin engagiert haben … Nein, das würde nur für unnötige Aufregung sorgen. Wir können uns doch auf Sie verlassen, Frau di Santosa?«
Seine Ehefrau nickte zustimmend, ihre Finger kamen endlich zur Ruhe. Rosina Kalterer war ein zartes Persönchen jenseits der siebzig im leicht angestaubten Chanel-Kostüm. Mit ihren Silberlöckchen, dem herzenswarmen Lächeln und den blitzwachen Augen inmitten der vielen Fältchen erinnerte sie mich an Nonna Emilia, meine geliebte italienische Großmutter.
Erneut versicherte ich, dass Diskretion für mich das höchste Gebot sei, was nicht gelogen war, und leerte ohne Eile meine Teetasse aus feinstem chinesischem Porzellan. Die kleine Anekdote des Hausherrn, wie er das wertvollste Stück der Sammlung, immerhin ein echter Pieter Brueghel der Jüngere, einem Formel-1-Rennfahrer aus Argentinien vor der Nase weggeschnappt hatte, bei einer Auktion in New York, quittierte ich mit interessiertem Lächeln.
Auch in der Diele, wo wir ausgiebig Hände schüttelten, ließ ich mir meine zunehmende Unrast nicht anmerken. Der Kunde war schließlich immer der König.
Kaum aber hatte ich die Tür der luxuriösen Loftwohnung mit direktem Blick auf die Donau hinter mir zugezogen, verschwand die gute Laune aus meinem Gesicht. Es war nicht das erste Mal, dass ich für Benedetta Castiglione einspringen musste, die neue Praktikantin in meiner Modeboutique mitten in der Altstadt und nicht weit von hier. Doch es war das erste Mal, dass ich ihretwegen einen wichtigen Kundentermin so zügig beendet hatte.
Ich lief die Treppe hinunter, knallte die Haustür hinter mir zu, sauste über den Donaumarkt, vorbei am erst vor Kurzem errichteten Museum Bayerischer Geschichte. Auf dem alten Kornmarkt zwängte ich mich zwischen rucksackbewehrten Schulkindern hindurch, die aus der Niedermünster-Schule strömten. Wie immer, wenn ich nicht so konnte, wie ich wollte, murmelte ich verhalten italienische Flüche vor mich hin.
An der Ostseite des Doms überholte ich im Laufschritt dahinschlendernde Touristen, die heute, an einem hochsommerlich heißen Freitag Ende Juli, die Innenstadt in Scharen bevölkerten. Auf den Stufen, die zum Südportal hinaufführten, saß noch mehr junges Volk und hielt unter den Augen der Wasserspeier und steinernen Fabelwesen auf Pfeilern und Balustraden die Gesichter in die Mittagssonne.
Ein Mann rempelte mich so heftig an, dass ich fast gestolpert wäre.
»He, passen Sie doch auf!«, rief er wutentbrannt, anstatt sich bei mir zu entschuldigen, und sah jemandem nach, der rannte wie der Teufel. Ein schmaler Rücken, ein schwarzer Pferdeschwanz, der unter einem froschgrünen Käppi auf- und niederhüpfte.
War das etwa Benedetta?
Ich kniff die Augen zusammen. Aber schon war die kleine, flinke Gestalt inmitten einer Touristengruppe verschwunden. Der Mann, der mich angerempelt hatte, war weitergegangen. Auch ich setzte meinen Weg fort, kam aber wieder kaum vom Fleck.
Die Frau mit Pferdeschwanz und Käppi musste von der schmalen Seitentür gekommen sein, die ins Dominnere führte. Davor saßen ein Pärchen und drei, vier Schulkinder, die sich über ihre Handys beugten. Zwei weitere steckten die Köpfe über einem Stickeralbum zusammen, ein Anblick, der mich rührte, musste ich dabei doch an meine eigene Kindheit denken, als man noch Sticker in Alben geklebt hatte.
Ein Schrei riss mich aus meinen Gedanken.
Nein, ein Brüllen aus tiefster Kehle.
Ich wandte den Kopf, sah eine Frau durch die Tür hinter den Kindern stürzen. Sie warf beide Hände nach oben, das Gesicht puterrot, die Augen voller Entsetzen. So plötzlich wie ein Luftballon, in den eine Nadel gestochen hatte, fiel sie in sich zusammen.
Die Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe hoben den Blick, erschrocken oder gleichgültig. Doch niemand rührte auch nur einen Finger. Ich steuerte auf die reglos daliegende Frau zu. Auch wenn ich es noch so eilig hatte – als gebürtige Italienerin war ich dazu erzogen worden, immer und überall jedem zu helfen, der in Not geraten war.
Schon war ich bei ihr, schüttelte sie. Ihr Rucksack war zur Seite gerutscht und hatte ihren Sturz gebremst.
»Können Sie mich hören?«, fragte ich.
Ihr Gesicht war nun kalkweiß, das fransige Haar klebte ihr an der Stirn. Sie reagierte nicht. Wieder rüttelte ich sie an den Schultern, dieses Mal heftiger.
Sie riss die Augen auf, starrte mich an.
»Mein Gott«, keuchte sie, »der Mann da … Der ist tot, der muss tot sein, das viele Blut, mein Gott, ich …«
Ein zweites Mal schrie sie, rau und verzweifelt.