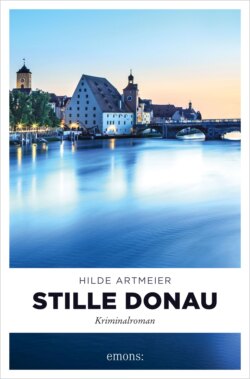Читать книгу Stille Donau - Hilde Artmeier - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеMein Zuhause befand sich am Ende der Prebrunnallee, am äußersten Rand der westlichen Altstadt, in einer ruhigen Gegend mit stilvollen Mehrfamilienhäusern und prächtig renovierten Villen aus lange vergangenen Tagen. Gegenüber lag der Herzogspark, wo um diese Uhrzeit höchstens noch ein paar Spaziergänger die Abendsonne genossen oder Jogger ihre Runden drehten. Dahinter floss die Donau, die jedoch nur aus dem obersten Stockwerk zu sehen war.
Als ich meinen Wagen an den hinteren Teil der rückwärtigen Einfahrt quetschte, was angesichts seiner Größe nicht einfach war, hörte ich Gelächter und übermütiges Geschrei aus dem Garten. Vincenzos Stimme war darunter, auch Benedettas rauchige Stimme konnte ich ausmachen. Ihr Miet-Golf in unauffälligem Dunkelblau stand auf der Straße, Maximilians Alfa war noch nicht zu sehen. Monas knallroter Mini hingegen belegte wieder einmal den vorderen Teil der Zufahrt, was aber nicht bedeutete, dass sie schon zu Hause war. Seit es so warm war, war sie oft mit dem Rad unterwegs.
Mona war nicht nur die stellvertretende Geschäftsführerin des »BellaDonna«, sondern hatte auch die oberste Etage meines Hauses gemietet. Sie wohnte nun schon so lange bei mir, dass ich es mir längst abgewöhnt hatte, mich wegen ihrer rücksichtslosen Parkerei mit ihr zu streiten.
Ich klemmte mir die Tasche unter den Arm, holte den Korb mit den Einkäufen aus dem Kofferraum und umrundete das Gebäude, eine dreistöckige Jugendstilvilla mit allerhand Erkern, Gauben, Treppchen und verschnörkelten Balkonen, die ich wie den Maserati von meiner italienischen Großmutter geerbt hatte und mir nicht wirklich leisten konnte.
Das Haus mit Garten, angesichts seiner riesigen Ausmaße und der vielen alten Eichen, Ahornbäume, Linden und Buchen schon fast ein Park, war ein Juwel und nicht zuletzt der Grund, warum ich neben der Boutique schließlich eine Detektei eröffnet hatte. Die Instandhaltung des Bauwerks und die Pflege der Außenanlagen hatten schon vor Jahren den Großteil meiner finanziellen Reserven verschlungen, die mir ebenfalls Nonna Emilia hinterlassen hatte.
Trotz der anhaltenden Hitze quollen die Rosenbüsche, die den gekiesten Weg säumten, über vor Knospen und duftenden Blüten, wahre Farbkaskaden in Lachs und tiefem Rot leuchteten im Abendlicht. Sämtliche Zweige waren sauber gestutzt, und auf dem Weg selbst entdeckte ich keinen einzigen Halm Unkraut.
Allein den Garten nicht zu sehr verwildern zu lassen war bisher eine schier unlösbare Aufgabe gewesen. Seit Maximilian im April bei mir eingezogen war, hatte sich das jedoch grundlegend geändert. Sobald er nach Hause kam, warf er alles, was nach Klinik roch, weit von sich, packte Harken, Schaufeln, Rechen und stürzte nach draußen. Ein Ausgleich zu seinem Job als Arzt, pflegte er zu sagen, wo er stets von absoluter Sterilität umgeben war. Ich nahm mir vor, mich später bei ihm zu bedanken.
»Tor, Tor, Tor!«, brüllte Vincenzo begeistert, als ich die frisch gemähte Rasenfläche vor der Terrasse erreichte. »Brava, Benedetta, sei bravissima!«
Sie waren zu sechst: Vincenzo, sein Freund Florian, drei Nachbarsjungen und Benedetta, die auf dem zu einem Fußballfeld umfunktionierten Grasstück wie ein Wiesel auf meinen Sohn zuschoss. Dieser, außer sich vor Freude über das eben geschossene Tor, umarmte sie stürmisch. Florian hingegen warf ihr grimmige Blicke zu, offenbar gehörte er zur Gegenmannschaft. Am Rand des Spielfelds, das von zwei wackeligen Toren begrenzt war, lag ein Haufen Trinkflaschen und City-Turnschuhe.
Ich hatte Vincenzo zweisprachig erzogen, aber normalerweise weigerte er sich, mehr als das absolut Nötigste in seiner zweiten Muttersprache zu artikulieren. In aller Regel, wenn er mehr Taschengeld wollte oder fragte, wann das Essen fertig sei. Seit aber Benedetta eines der Gästezimmer im ersten Stock bewohnte, war alles anders.
Gleichgültig, ob die beiden gemeinsam dem Fußball hinterherjagten, die neuesten Instagram-Fotos auf ihren Notebooks und Smartphones begutachteten, sich über Sitcoms oder Youtube-Videos amüsierten – alles zwischen ihnen spielte sich auf Italienisch ab. An zwei Vormittagen in der Woche besuchte Benedetta einen Deutsch-Sprachkurs, auch in Italien hatte sie schon einen Crashkurs gemacht. Dennoch war ihr Deutsch alles andere als perfekt.
Ich begrüßte die Fußballmannschaft, stellte den Korb ab und erkundigte mich nach Vincenzos Nachmittag. Er hatte an einer Fridays-for-Future-Demo teilgenommen, seiner neuen Leidenschaft.
Die Radl-Tour, erfuhr ich, sei zwar »megageil« gewesen, das »Gequatsche« bei der anschließenden Kundgebung auf dem Haidplatz jedoch »krass ätzend«. Florian, der ihn begleitet hatte, gab zustimmende Brummlaute von sich.
»Hast du später ein paar Minuten Zeit?«, fragte ich Benedetta auf Italienisch. »Ich muss was mit dir bereden.«
Im Gegensatz zu den Jungs, alle wie Vincenzo zwischen vierzehn und fünfzehn Jahren alt, war Benedetta schon fünfundzwanzig. Dennoch war sie kaum von ihren Spielgefährten zu unterscheiden. Ihre Figur war schmal und so sehnig, als wäre sie ebenfalls ein Junge. Das halblange schwarze Haar, auf dem das obligatorische froschgrüne Käppi thronte, hatte sie wie immer zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden.
»Das wird eng.« Ein flüchtiger Blick aus ihren hellgrauen Augen streifte mich. »Hab nachher noch eine Verabredung.«
»Es geht um die Boutique. Dauert auch nicht lange.«
»Hm … Bestimmt findet mein Tanzpartner es gar nicht lustig, wenn ich ausgerechnet heute zu spät komme. Ich mache einen Tangokurs, und ich hab versprochen, dass ich pünktlich im ›TangoTango‹ bin.« Sie biss sich auf die schmale Unterlippe, als wäre ihr das zuletzt Gesagte ungewollt herausgerutscht.
»Dann eben gleich. Wir könnten kurz in die Küche …«
»Oh Manno, mamma, in einer halben Stunde muss Florian heim«, quengelte Vincenzo und raufte sich das fast schwarze Haar, das er von seinem Vater geerbt hatte, mit wahrhaft theatralischer Miene. »Bestimmt quatscht ihr wieder stundenlang, wir sind sowieso noch ein Tor im Rückstand, und wenn wir nicht sofort …«
»Von stundenlang ist keine Rede«, wies ich ihn zurecht. »Seit wann«, ich wandte mich wieder an Benedetta, »seit wann tanzt du denn Tango?«
Natürlich ging es mich nichts an. Aber ich wusste, dass sich hinter dem »TangoTango« ein erstklassiges und dementsprechend teures Tanzstudio verbarg, in dem sie sich wohl kaum Unterricht leisten konnte. Jedenfalls nicht von dem Geld, das sie bei mir verdiente.
Luciano, ein Freund aus Parma, hatte sie mir empfohlen. Ursprünglich hatte Benedetta in Bologna Italienisch und Anglistik studiert. Da sie aber nach Abschluss des Studiums erst einmal eine Weile im Ausland leben wolle, so Luciano, sei ein Minijob im »BellaDonna« perfekt für sie.
Im Klartext hieß das: Benedetta wohnte und aß bei mir umsonst und bekam ein Taschengeld. Dafür half sie in der Boutique aus. Bei ihrer Ankunft vor zwei Wochen hatten wir vereinbart, dass sie neben den festen Schichten auch nach kurzfristiger Absprache zur Verfügung stehen musste. Da kurz zuvor eine meiner Aushilfen gekündigt hatte, war ich froh gewesen um diese ebenso unerwartete wie flexible Arbeitskraft.
Allmählich aber bereute ich meine Entscheidung. Benedettas Interesse an Mode war nicht erkennbar – auch wenn sie nicht gerade Fußball spielte, trug sie meist nur Shorts und eines ihrer unifarbenen T-Shirts –, und auch die Arbeit in meinem Laden schien ihr keinen Spaß zu machen. Sie ging lieber auf Sightseeingtour und nutzte jede Gelegenheit, sich vor der Arbeit zu drücken.
»Okay, dann lieber jetzt.« Sie verzog ihre kindlichen Züge. Wenn ich nicht gewusst hätte, wie alt sie war, hätte ich sie noch um einiges jünger geschätzt. »Aber mach’s bitte wirklich kurz, okay? Ich muss ja auch noch unter die Dusche.«
»Und wir müssen noch mindestens ein Tor schießen, wenn wir gewinnen wollen, Benedetta«, kam es von Vincenzo in muffigem Ton. »Mamma, also echt, wieso …?«
Mein Handy meldete sich. Es war Mona.
Ich bat Benedetta um einen Moment Geduld, ging ein paar Schritte zur Seite und nahm das Gespräch an. Hinter mir spielte die Fußballmannschaft weiter.
»Bin noch im Laden«, sagte Mona in atemlosem Ton. »Ich sperre aber gleich zu, hier ist nichts mehr los.«
Als pflichtbewusste zweite Geschäftsführerin war sie nach ihrem Termin noch einmal ins »BellaDonna« zurückgekehrt, um dort nach dem Rechten zu schauen. Es erstaunte mich nicht zu hören, dass Benedetta sofort nach Monas Auftauchen wieder verschwunden war.
»Das mit Jakob lässt mir keine Ruhe«, sagte Mona im nächsten Atemzug. »Ich kann es echt nicht fassen – tot, ermordet, einfach so, und mitten im Dom. Wer tut denn so was?«
Über diesen Punkt hatte auch ich nachgedacht. Auch wenn die Stelle, an der Jakob Landauer getötet worden war, ziemlich versteckt war, so befand sie sich dennoch in einer der wohl am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Wieder brüllte Vincenzo so laut, dass ich mich noch ein wenig weiter entfernte. Offenbar hatte er oder Benedetta das ersehnte Tor geschossen.
»Eins steht zumindest fest, der Täter hat Nerven wie Drahtseile«, sagte ich, als ich unter dem Apfelbaum zum Stehen kam. »Woher kennst du Jakob Landauer eigentlich?«
»Wir haben miteinander studiert, zwei Semester. Aber dann hatte er genug von Germanistik, wie so viele, die klüger waren als ich, und hat auf Journalismus umgesattelt. Er ist nach München, an die LMU, über Facebook hatten wir aber immer Kontakt. Jedenfalls, wenn du meine Meinung hören willst, Anna – bestimmt ist er jemandem auf die Füße getreten, weil …«
Im Hintergrund hörte ich eine Frauenstimme. Mona erklärte mir, sie müsse sich nun doch noch einer Kundin widmen, und legte auf.
Ich ging zurück und sah, wie Vincenzo seine Flasche in einem Zug leerte. Seine Freunde waren noch da, aber Benedetta war nirgendwo zu sehen. Sie hatte sich einfach aus dem Staub gemacht.
»Kein Problem, amore«, sagte ich eine halbe Stunde später ins Handy, das ich mir zwischen Ohr und Schulter geklemmt hatte, und zerpflückte den Lollo Rosso. »Dann warten wir eben mit dem Essen.«
»Warten macht keinen Sinn«, entgegnete Maximilian in hektischem Ton, »vor elf, halb zwölf komme ich hier nicht raus. Die OP dauert zwei Stunden, mindestens, dazu die Vor- und Nachbereitungen. Lasst mir einfach was übrig.«
Natürlich war ich enttäuscht, dass er es wieder einmal nicht zum gemeinsamen Essen schaffte, vor allem heute, zu Beginn des Wochenendes. Ich versuchte jedoch, es mir nicht anmerken zu lassen, sondern wünschte ihm gutes Gelingen. Maximilian verabschiedete sich, schon klickte es in der Leitung. Nicht einmal für ein in den Hörer gehauchtes Küsschen hatte er noch Zeit gehabt.
Seufzend legte ich das Mobiltelefon auf den Küchentisch und widmete mich wieder meinen Vorbereitungen fürs Abendessen, bei dem wir heute also nur zu dritt sein würden. Vincenzo, Mona und ich.
Nach dem Salat würde ich eine Parmigiana servieren, in Olivenöl gebratene und mit Parmesan und Büffelmozzarella überbackene Auberginen- und Tomatenscheiben, und als Dessert eine Pannacotta mit frischen Beeren. Dazu würde ich mir ein Glas eiskalten Vermentino gönnen, den vollmundigen Weißwein vom Landgut meines Onkels Marcello, dem Castello di Santosa nahe bei Volterra im Herzen der Toskana.
Maximilian arbeitete als leitender Oberarzt in der Neurochirurgie am Regensburger Uniklinikum, und bei Notfällen ging sein Job naturgemäß vor. Heute handelte es sich außerdem um einen komplizierten Eingriff, den er keinem Assistenzarzt überlassen konnte. Da ich als Selbstständige daran gewohnt war, auch dann zu arbeiten, wenn andere Leute frei hatten, war das nie ein Problem für mich gewesen.
In den letzten Wochen hatte Maximilian allerdings oft bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit geschuftet, die gewohnt schwierige Personalsituation an der Klinik war jetzt in der Urlaubszeit besonders angespannt. Nach den langen Diensten wirkte er oft so fahrig, dass ich mitunter sogar froh war, wenn er sich an seinen Feierabenden in den Garten verzog. Beim Büschestutzen und Unkrautzupfen konnte er ein wenig den Kopf auslüften.
Allmählich litt unsere Beziehung unter der Situation, und auch in der kommenden Woche würde ich wenig von ihm sehen. Am Montag ging sein Flieger nach Jekaterinburg, wo er eine Partnerschaft mit der zukünftig geplanten Medizinischen Fakultät der Ural Federal University anleiern sollte, im Auftrag seines Chefs, der groß darin war, ständig neue Projekte an Land zu ziehen und die Ausführung grundsätzlich seinen Oberärzten zu überlassen. Erst Ende der Woche, pünktlich zur Abfahrt in die Toskana, würde Maximilian zurückkehren.
Ich freute mich auf die gemeinsame Zeit im Süden. Natürlich würden wir einen Großteil davon mit meiner italienischen Familie verbringen. Dennoch gäbe es auch Momente zu zweit, voller Innigkeit, Unbeschwertheit und ohne den ständigen Blick auf die Uhr oder aufs Handy.
Benedettas eilige Schritte rissen mich aus meinen Überlegungen. Ich legte das Salatsieb zur Seite und ging in die Diele. Sie kramte in der für sie reservierten Schublade des Vertikos und zog ihren kleinen Lederrucksack hervor.
»Wolltest du nicht zum Tangotanzen?«, fragte ich mit Blick auf ihr wieder einmal ziemlich burschikoses Outfit.
»Genau, und ich bin auch schon ziemlich spät dran.« Schlüssel und Handy verschwanden im Rucksack. »Ciao, Anna, a dopo – bis dann.«
Schon war sie bei der Haustür, die gerade aufging, stieß um ein Haar mit Vincenzo zusammen. Sie zerstrubbelte ihm das Haar, beide lachten. Er sah sofort wieder auf sein Smartphone und ließ die staubigen Fußballschuhe, die von seiner anderen Hand baumelten, einfach fallen. Florian, der hinter ihm aufgetaucht war, folgte seinem schlechten Beispiel.
»Bitte hebt das auf«, sagte ich zu den beiden. »Benedetta, nur eine Minute, wir wollten doch …«
»Später, okay?« Sie quetschte sich an den Jungs vorbei und war im nächsten Moment draußen.
Ich seufzte. Es hatte keinen Sinn, sie jetzt wegen der Boutique zur Rede zu stellen. Sie wäre ohnehin nicht bei der Sache gewesen.
»Da fällt mir ein«, rief ich ihr dann aber doch nach, »bist du heute im Dom gewesen?«
»Im Dom?« An dem Treppchen, das von der Veranda nach unten führte, blieb sie stehen. »Nein, wie kommst du darauf?«
»Ich dachte, ich hätte dich gesehen. So um Viertel nach eins.«
»Das war nicht ich. Um Viertel nach eins, da war ich gerade …« Sie wandte sich um, fuhr sich mit der Zunge über die Zähne. »In der Dreieinigkeitskirche. Echt schön, da oben auf dem Turm.«
Obwohl sie so in Eile war, fummelte sie ihr Smartphone aus der Hosentasche, wischte über das Display, kam ein paar Schritte zurück und hielt es mir unter die Nase. Der altbekannte Blick über die Dächer Regensburgs.
»Im Dom haben sie heute übrigens einen abgeknallt«, sagte Vincenzo. »Auf Insta gibt’s sogar Fotos von der Leiche, echt krass.«
»Einen Mann?« Benedettas Blick erstarrte.
»Einen Journalisten«, sagte ich.
Alle Farbe wich aus ihrem Gesicht.
»Jakob Landauer«, ergänzte ich und betrachtete sie überrascht. »Kennst du ihn etwa?«
Langsam schüttelte sie den Kopf, vermied dabei jeden Blickkontakt. Mit einem Gesichtsausdruck, den ich nicht deuten konnte, rief sie: »Ciao, ci vediamo«, und stürzte davon.
Eine Weile später saß Mona auf dem Küchentisch, ließ ihre langen Beine baumeln und informierte mich über den Tagesumsatz im Laden, der für einen Freitag ganz okay war.
Semiramis kam hereingehuscht und sah sich auffordernd maunzend um. Ausnahmsweise überließ Mona es heute nicht mir, ihre rabenschwarze Katzendame zu füttern. Sie sprang vom Tisch, häufte den Inhalt einer frisch geöffneten Dose in die Schüssel neben der Terrassentür und streichelte Semiramis schließlich sogar das dichte Fell, wenn auch mit etwas hektischen Bewegungen.
Die Pannacotta stand schon im Kühlschrank. Ich gab die in Scheiben geschnittenen Auberginen und einen Schuss Öl in eine Pfanne. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Mona unschlüssig an ihrem Engelslockenkopf herumzupfte – seit Wochen trug sie ihr Haar in Silberblond, ihrer natürlichen Haarfarbe. Schließlich ließ sie sich auf der Eckbank nieder und zog die Beine hoch. Wie sie nun so dasaß, mit den eng an den zierlichen Körper gepressten Beinen und das Gesicht so wächsern wie das einer Porzellanpuppe, hatte sie keinerlei Ähnlichkeit mehr mit der Elfe, die sie früher immer gewesen war.
»Wie war dein Termin?«, fragte ich. »Ist der Anwalt der richtige für dein Vorhaben?«
Mona zog ihr Handy aus der Gesäßtasche ihrer Jeans und zeigte mir kommentarlos seine Website. Mit Mitte vierzig konnte er auf eine lange Reihe erfolgreich abgeschlossener Verfahren am Familiengericht in genau der juristischen Sparte zurückblicken, die für Mona so wichtig war. Neben seinem Lebenslauf war ein Foto abgebildet. Er trug einen aparten Bart, hatte samtene Augen und passte auch sonst perfekt in Monas Beuteschema: in der richtigen Einkommensklasse und vermutlich verheiratet.
Normalerweise wäre sie an dieser Stelle ins Schwärmen gekommen, und nach höchstens vier Wochen hätte sie mir mit tränennassem Gesicht geschworen, sich nie, wirklich niemals mehr wieder mit einem Mann einzulassen, der schon in festen Händen war. Seit ihrer Episode mit Heiner Bach aber war alles anders.
»Was hat der Anwalt zu deinem Problem gesagt?«
»Anfang nächster Woche wird er den Antrag einreichen.« Ihre sonst so unbeschwerte Stimme flatterte, als wäre sie ein Geist, eine ruhelose Seele auf der Suche nach Erlösung. »Fünfzig Meter, hat er gesagt. Das ist wohl die übliche Entfernung in einem solchen Fall. Dann geht alles ganz schnell, vielleicht noch zwei Wochen, bis das Verfahren eröffnet wird.«
Vor anderthalb Monaten war Mona Heiner Bach begegnet. Als gut aussehender und noch besser verdienender Monteur Ende dreißig, der als Leiter eines mehrköpfigen Teams die Wartung und Reparatur von Abfüllanlagen für die Firma Krones im osteuropäischen Markt koordinierte, hatte er ihr Herz im Sturm erobert. Laut Mona war er ein erfindungsreicher Liebhaber. Außerdem verwöhnte er sie mit Einladungen in die angesagtesten Restaurants und überraschte sie mit kostspieligen Geschenken. Nach und nach legte er jedoch Eigenarten an den Tag, die sie anfangs nur irritierten, bald jedoch massiv störten und ihr irgendwann sogar Angst einjagten.
Während seiner Dienstreisen rief er sie ständig an, oft mitten in der Nacht und auch immer wieder in der »Mittelbayerischen Zeitung« oder im »BellaDonna«, und wollte alles wissen. Wo sie gerade stecke, welche Pläne sie für die nächsten Stunden habe, mit wem sie sich zu treffen beabsichtige. Bei jedem noch so flüchtigen Blick, den sie anderen Männern zuwarf, machte er ihr eine Szene. Da sie seinen Kontrollwahn bald nicht mehr ertrug, mündeten ihre Dates immer häufiger in Streitereien. Als er sie bei diesen Gelegenheiten zunehmend beschimpfte, mitunter sogar Dinge nach ihr warf – mal einen Stift, mal einen Löffel – und schließlich sogar die Hand gegen sie erhob, brach sie den Kontakt zu ihm ab.
Ab diesem Moment wurde alles nur noch schlimmer. Heiner Bach bedrängte sie in jeder erdenklichen Art und flehte sie an, sie möge doch wieder zu ihm zurückkommen – ohne sie habe sein Leben keinen Sinn. Er schickte ihr Endlos-Mails, lauerte ihr vor dem Redaktionsgebäude oder der Boutique auf, verfolgte sie bis zur Bushaltestelle oder zum Parkhaus. Längst hatte sie sich eine neue SIM-Karte besorgt, auch mein Pfefferspray trug sie immer bei sich, ging kaum noch aus. Ihre Kollegen bei der »MZ«, die Anwohner meines Ladens – an alle hatte Mona ein Foto mit dem Gesicht des Stalkers verteilt.
Bisher hatte Heiner Bach zum Glück noch nicht herausgefunden, wo Mona wohnte – einer inneren Eingebung folgend, hatte sie sich immer nur auswärts mit ihm verabredet. Wenn sie abends doch einmal unterwegs war, achteten Maximilian und ich darauf, dass bei ihrer Rückkehr einer von uns wach und die Villa hell erleuchtet war. Dennoch lebte sie in der ständigen Angst, Heiner Bach würde plötzlich vor ihr stehen und ihr Gewalt antun.
Seit einigen Tagen nun herrschte Funkstille. Unter einem Vorwand hatte ich bei Krones angerufen – Mona selbst hatte es nicht gewagt – und erfahren, dass Heiner Bach sich momentan im tschechischen Budweis aufhielt, wo eine Anlage ausgefallen war. Anfangs war sie so erleichtert gewesen, dass sie so unbekümmert wie früher durchs Haus wirbelte. Dann aber ergriff die Unruhe wieder von ihr Besitz, irgendwann nackte Panik. Ihrer Meinung nach war es nur eine Frage der Zeit, bis er ihr wieder nachstellte. Und vermutlich hatte sie damit leider recht.
Ich hatte Paolo davon erzählt. Er hatte versprochen, hin und wieder eine Streife vorbeizuschicken, konnte offiziell jedoch nichts unternehmen, solange er keine konkrete Handhabe gegen den Stalker hatte. Er hatte Mona geraten, Heiner Bach wegen der tätlichen Angriffe und anhaltenden Belästigung anzuzeigen. Und vor allem solle sie eine gerichtliche Verfügung mit einem Annäherungsverbot erwirken.
»Dann ist ja alles bestens«, sagte ich fröhlicher, als mir zumute war, und gab die angebratenen Auberginenscheiben in eine Auflaufform. »Du isst doch mit, oder?«
»Nein, ich hab keinen Hunger.« Mit trüben Augen sah sie hinaus auf die Terrasse, vor der Vincenzos Fußball lag. »Weiß man schon was Genaues wegen Jakob?«
Ich erklärte Mona, dass ich den ganzen Nachmittag über an einem neuen Auftrag gearbeitet hatte und den momentanen Stand der Dinge nicht kannte.
»Wie hast du das eigentlich gemeint, vorhin am Telefon?«, fügte ich hinzu. »Dass Jakob Landauer jemandem auf die Füße getreten ist?«
»Na ja, er hat hier recherchiert, was sonst? Bestimmt wollte er mal wieder einen Skandal aufdecken und den Pulitzerpreis dafür gewinnen. ›Bluthund‹ haben wir ihn genannt, früher an der Uni.« Ein winziges Lächeln glitt über ihre Züge. »Wenn wir anderen gefeiert haben, an den Sarchinger Weiher zum Baden gefahren sind oder zu einem geilen Konzert nach Nürnberg – der Jakob ist garantiert nie mitgekommen, jede noch so blöde Seminararbeit war ihm wichtiger. Aber genau aus diesem Grund ist er dann bei der ›SZ‹ gelandet.«
Ich verteilte den geraspelten Parmesan und den in Scheiben geschnittenen Mozzarella über dem Gemüse und schob die Auflaufform in den Ofen.
»Wann hast du Jakob Landauer zuletzt gesehen?«, fragte ich.
»Schon ewig her, aber Bilder hat er immer fleißig geschickt. Er war ja lange Auslandskorrespondent. Früher, in seinen Anfangszeiten bei der ›SZ‹, da hat er mich immer angerufen, wenn er in der Nähe zu tun hatte. Wir haben dann irgendwo einen Cappuccino miteinander getrunken und über alte Zeiten geredet.«
»Wo hat die ›Süddeutsche‹ ihn hingeschickt?«
»Erst nach Ungarn, dann in die Schweiz. Die Fotos, die er da gepostet hat, die waren der Wahnsinn.« Auf ihren Wangen erschien endlich ein zarter rosa Schimmer. »Auch im Winter noch dieser irre blaue Himmel über dem Luganer See, die Promenade mit tausend Palmen, dahinter die Berge, echt zum Neidischwerden.« Schon wieder trübte ein Schleier ihren Blick. »Ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass er wieder da ist.«
»Weißt du, für welches Ressort er zuständig war?«
»Politik. Die Königsdisziplin, was sonst?«