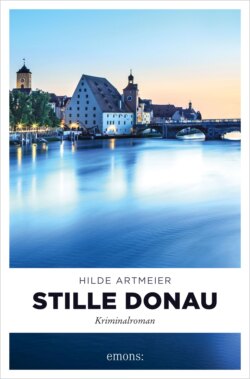Читать книгу Stille Donau - Hilde Artmeier - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление»Es tut mir wirklich leid, aber die Bilder befinden sich nicht mehr in meinem Besitz«, eröffnete Vittorio Rossignolo mir eine Stunde später auf Deutsch und nach der für einen Italiener ungewöhnlich knappen Begrüßung, jedoch mit ehrlichem Bedauern in der Stimme. »Ich habe sie verkauft.«
Ich lächelte und ließ mir meine Überraschung nicht anmerken. »Ich denke, Sie sind Sammler?«
»Das bin ich, und zwar mit Leidenschaft.«
Auch er lächelte, auf eine offene, charmante Art. Regelmäßige, blendend weiße Zähne kamen zum Vorschein, nur die eisblauen Augen wirkten seltsam unbeteiligt.
Bei der »Rossi-Immo-Service GmbH« schloss man die Bürotüren freitags tatsächlich schon früh. Dennoch war ich nach Straubing gefahren, einer etwa fünfzig Kilometer östlich von Regensburg gelegenen Kleinstadt in Niederbayern, in der Hoffnung, Vittorio Rossignolo in seinem Privathaus anzutreffen, das sich ebenfalls dort befand.
Wie immer war so kurz vor dem Wochenende auf der A 3 viel los gewesen. Zum üblichen Feierabend- und Pendlerverkehr kamen Urlauber aus anderen Bundesländern in bis unters Dach vollgepackten Pkws oder Wohnmobilen.
»Ich liebe die bildenden Künste, schon immer, meine Sammlung umfasst mehr als zweihundert Bilder«, fügte Vittorio Rossignolo ohne eine Spur von Überheblichkeit hinzu. »Normalerweise trenne ich mich nur ungern von einem Werk. Aber bei einem solchen Angebot konnte ich unmöglich Nein sagen. Noch dazu von einer so guten Freundin, wir kennen uns seit vielen Jahren. Sie verstehen das sicher – als Landsmännin.«
Er zwinkerte mir zu. Im Gegensatz zu mir sprach er Deutsch mit einem deutlich italienischen Akzent, jedoch fließend. Die Unterhaltung in unserer gemeinsamen Muttersprache zu führen hatte er abgelehnt.
»Natürlich.« Ich seufzte. »Trotzdem bin ich jetzt sehr enttäuscht. Ob Sie mir wohl ein wenig mehr über Ihre Freundin verraten könnten? Vielleicht würde sie mir die Bilder ja überlassen – gegen eine entsprechende Summe, versteht sich.«
Vittorio Rossignolo sah aus, wie man sich einen Italiener vorstellte. Höchstens eins siebzig groß, schlank und schmal gebaut. Sein längliches Gesicht zierte ein winziges Kinnbärtchen, die Form seiner römischen Nase konnte man nur als aristokratisch bezeichnen. Seine Haut hatte einen goldenen Bronzeton. Das pechschwarze, vielleicht schulterlange Haar hatte er am Hinterkopf zu einem Knoten gebunden.
»Sehr unwahrscheinlich«, sagte er. »Sie arbeitet für ein renommiertes Museum in Italien, so viel kann ich immerhin verraten. Alle Kunstschätze, die sie im Auftrag des Museums erwirbt, werden langfristig in die Bestände aufgenommen.«
Wir saßen uns in seinem Haus auf zwei ausladenden Sofas gegenüber, in einem sonnendurchfluteten Raum, der so groß war, dass ich ihn mir als Bankettsaal hätte vorstellen können. Das Mobiliar bestand aus spiegelglattem Metall, schneeweißem Leder oder Glas, überall blitzte und funkelte es. Riesige Zimmerpflanzen standen wie Inseln mitten in dem klimatisierten Raum, die einzige Wand – vom Boden bis zur Decke reichende, durchweg geschlossene Glastüren ersetzten die restlichen drei Wände – zierten abstrakte Gemälde und Drucke in stilvollen Rahmen.
»Wenn Sie mir den Namen Ihrer Freundin trotzdem nennen möchten«, beharrte ich und zwinkerte ebenfalls, »würde ich das natürlich vertraulich behandeln.«
»Meine liebe Signora di Santosa, was denken Sie von mir?«
Der Blick seiner klaren Augen bohrte sich in meine, während er sich bekreuzigte, eine Geste, die ich aus dem Süden zwar zur Genüge kannte, von einem so jungen Mann jedoch nicht erwartet hätte. Ich schätzte ihn auf höchstens Anfang dreißig. Ein leichter Duft nach Tabak und Leder umgab ihn, untermalt von einem Hauch Zimt.
»Meine Freundin würde kein Wort mehr mit mir wechseln, zu Recht, muss ich sagen«, fuhr er kopfschüttelnd fort. »Und das«, sein Ton klang nun fast empört, »wollen Sie doch sicher nicht, oder?«
Trotz seiner Haar- und Barttracht, die ihm eine extravagante, wenn nicht gar flippige Note verlieh, wirkte alles an ihm bis ins kleinste Detail solide und durchgestylt. Angefangen von den perfekt manikürten Händen bis zu den fast zierlichen Füßen, die in Budapestern aus feinstem Leder steckten. Zu schwarzen Jeans, der Passform nach zu schließen von Dolce & Gabbana, trug er ein eng anliegendes Hemd in Limettengelb.
Ich neigte den Kopf, trank einen Schluck caffè und blickte hinaus in den Garten.
Jenseits einer weitläufigen Terrasse aus Holzbohlen glänzte ein meerblauer Pool, umgeben von meterhohen Palmen und Bananenstauden, so vielen, dass der Eindruck eines exotischen Waldes entstand. Dahinter erstreckten sich ausgedehnte Grünflächen, von mächtigen Kastanienbäumen umstanden, bis zu einer hohen Mauer. Zwischen den Bäumen lagen sorgsam getrimmte Buchshecken, ein Pavillon und mehrere Häuschen, vielleicht eine Sauna und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Gartenmöbel und -gerätschaften.
Bisher war ich einer Hausangestellten begegnet, sie hatte mich in den Empfangsraum gebracht und Kaffee und Wasser serviert, und zwei Männern in schwarzen Anzügen. Der eine, der Pförtner, hatte sich an der Einfahrt nach dem Grund meines Besuches erkundigt und vor dem telefonischen Okay seines Arbeitgebers sogar meinen Ausweis sehen wollen. Er hatte mich so finster gemustert, dass ich anstelle von Monas Ausweis meinen eigenen hervorgezogen hatte. Der andere Mann, ein großer Blonder und wohl eher ein Sekretär, war mit einem Notebook und Computerausdrucken aus einem Büro gekommen, als die Bedienstete mich durch die Eingangshalle führte.
»Mir ist nicht ganz klar, woher Sie eigentlich meinen Namen haben«, sagte Vittorio Rossignolo, nun wieder in seinem lockeren Plauderton, der nicht zu seinen kalten Augen passen wollte. »Sie sind auch Sammlerin, sagten Sie?«
»Ja, und wie Sie mit Leidenschaft.« Wieder lächelte ich arglos und nippte an meinem caffè. »Was meine Insiderinformationen angeht – Sie werden gewiss verstehen, dass auch ich meine Quellen habe.«
Mein Gastgeber hob die wie gerade Striche geformten kohlrabenschwarzen Augenbrauen und nickte fast unmerklich. Auf dem Glastischchen zwischen uns, sicher ein Designerstück, hatte das Dienstmädchen auch für ihn Wasser und Kaffee bereitgestellt. Im Gegensatz zu mir hatte er bisher jedoch nichts davon angerührt.
»Ihre Objekte dort sind sehr interessant.« Ich deutete auf die Gemälde an der Wand und legte mir eine Formulierung zurecht, mit der ich mich hoffentlich nicht völlig blamierte. »Vor allem das kleine Gelbe in Acryl. Diese Linien, sehr beeindruckend, es wirkt so ursprünglich und dynamisch.«
Nun strahlte er. »Mein absoluter Liebling. Gunnar Pálsson, ein noch weitgehend unbekannter Künstler aus Island, ein echter Geheimtipp.«
Ich nickte anerkennend, schlug ein Bein übers andere und betrachtete das Werk noch interessierter.
Das Eis in seinen Augen schien endlich zu schmelzen. »Sammeln Sie nur, oder verkaufen Sie auch?«
Seine Frage überraschte mich. »Ersteres. Warum?«
»Nun, ich bin immer auf der Suche nach neuen Werken, das da drüben ist ja nur ein kleiner Teil meiner Sammlung. Meine wertvollsten quadri hängen im Obergeschoss, meine … Wie sagt man noch mal für ›Bild‹? ›Gemälde‹, ist das das richtige Wort?«
Ich bejahte und fragte ein zweites Mal, ob er die Unterhaltung vielleicht doch lieber in unserer gemeinsamen Muttersprache fortführen wolle.
»Das ist sehr freundlich, Signora, aber ich muss üben. Wenn man in einem fremden Land lebt, muss man die Sprache sprechen. Das gebietet der Respekt gegenüber den Menschen, gegenüber der Kultur.«
»Ihr Deutsch ist perfekt.«
»Grazie mille.« Erneut erschien dieses charmante Lächeln auf seinem Gesicht, das seine Augen jedoch wieder nicht erreichte. »Trotzdem bei Weitem nicht so gut wie das Ihre.«
Ich erklärte, dass ich, obwohl in der Toskana aufgewachsen, schließlich nur zu einem Viertel Italienerin war. »Wo haben Sie Deutsch so gut zu sprechen gelernt?«
»In Mailand, ich stamme von dort.«
Das erklärte seine mitunter kurz angebundene Art. Die Norditaliener waren seit jeher bekannt für ihre schnelle Redeweise und die zackigen Umgangsformen.
»Eine wundervolle Stadt«, sagte ich und lobte den berühmten Dom ebenso wie die noblen Einkaufspassagen mit den Boutiquen der alta moda. Als ich ihn fragen wollte, was ihn veranlasst hatte, eine Stadt wie Mailand zu verlassen, klopfte es an der Tür.
»Pronto«, rief Vittorio Rossignolo.
Während er sich in formvollendetem Ton für die Störung entschuldigte, trat der große Blonde ein, der mir in der Eingangshalle begegnet war. Mit raschen Schritten kam er näher, blieb hinter dem Sofa stehen, auf dem Vittorio Rossignolo saß, beugte sich zu ihm hinunter und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Mein Gastgeber lauschte, warf mir einen schnellen Blick zu, raunte ein paar Worte zurück.
»Es tut mir wirklich leid«, sagte er dann wie zu Beginn unseres Gesprächs und wieder mit ehrlichem Bedauern in der Stimme. »Aber die Pflicht ruft. Als Unternehmer ist man ja praktisch immer im Einsatz.«
»Kein Problem, ich kenne das, ich bin auch selbstständig.« Ich stand auf. »Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten, Signor Rossignolo.«
Dem Pförtner hatte ich neben meinem Ausweis eine der Visitenkarten gereicht, die mich als Inhaberin des »BellaDonna« auswiesen. Meine zweite Einkunftsquelle war im Internet zwar mühelos in Erfahrung zu bringen, aber ich wollte Vittorio Rossignolo nicht mit der Nase darauf stoßen.
Er nestelte am Kragen seines Hemds, als wollte er noch etwas sagen, erhob sich dann aber ebenfalls. Sein Blick fiel auf meine Tasse, die noch halb voll war.
»Trinken Sie bitte in Ruhe aus, kein Grund zur Eile.« Er reichte mir eine kühle Hand und machte eine Kopfbewegung zu dem Blonden, der sich nicht von der Stelle bewegt hatte. »Massimo bringt Sie zum Ausgang. Ja, dann bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen – buona giornata, signora di Santosa.«
Als ich bald darauf auf das Tor zufuhr, das von Kameras überwacht wurde und fast zwei Meter hoch war, trat der Pförtner aus seinem Glashäuschen. Mit unmissverständlicher Geste bedeutete er mir zu warten, während das Tor zur Seite glitt. Dann ging er hinaus auf die Zufahrtsstraße, warf einen Blick nach rechts und links und winkte mich hinaus. Ich bedankte mich mit einem Kopfnicken und gab Gas.
Am Himmel zeigte sich kaum ein Wölkchen. Ich kurbelte das Fenster herunter, trockene Sommerhitze drang in das ohnehin bis zur Unerträglichkeit aufgeheizte Auto. Wie so oft wünschte ich mir eine Klimaanlage für meinen Uralt-Maserati, der um diese Jahreszeit nur mit seinen wuchtigen Formen in sattem Bordeauxrot, den cognacbraunen Lederbezügen und dem vollklingenden Motor punkten konnte.
Mein Weg führte mich an der Mauer entlang, die an die drei Meter hoch war und das komplette Grundstück einfasste. Auf der anderen Straßenseite reihten sich lange verblühte Holunderhecken aneinander. Die Getreidefelder dahinter, an deren Begrenzungsstreifen kaum eine Kornblume wuchs, geschweige denn grünes Gras, waren schon abgeerntet. Seit Anfang Mai hatte es keine drei Mal geregnet. Angesichts der monatelangen Dürre fühlte ich mich fast wie in meiner alten Heimat, wo zu dieser Zeit auch alles auf irgendeine Art braun war. Der Klimawandel machte eben auch vor dem beschaulichen Niederbayern nicht halt.
Vittorio Rossignolos Anwesen lag auf einer Anhöhe und zwei, drei Kilometer außerhalb von Straubing. Es gab nur wenige Nachbarhäuser, die meisten davon einsam gelegene, große Bauernhöfe, die typisch waren für den Gäuboden, wie man die im Donautal gelegene Gegend hier nannte. Das Wohnhaus hinter der schier endlosen Mauer, ein ultramoderner, zweistöckiger Flachbau riesigen Ausmaßes in sorgsam aufeinander abgestimmten Rottönen, war von der Straße aus nicht zu sehen.
Als ich am Fuß des Hügels angelangt war und auf die Stadt zuhielt, dachte ich über Manfred Billich und seine Agentur nach. Ich verstand nicht, warum er die drei Bilder an Vittorio Rossignolos Firma geschickt hatte, ein Immobilienunternehmen, wie ich im Internet gesehen hatte. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, sie direkt an die Privatadresse liefern zu lassen?
Vittorio Rossignolos Firma schien gut zu laufen. Vielleicht stammte er auch aus reichem Hause. Wie sonst hätte er sich eine zweihundert Stück umfassende Gemäldesammlung und ein so luxuriöses wie gut bewachtes Domizil leisten können?
Ich überlegte, wie ich weiter vorgehen sollte. Wenn der smarte Unternehmer mir nichts über die neue Eigentümerin der drei Bilder verraten wollte, würde ich mich wohl am besten in seiner Firma umhören, natürlich inkognito. Es war jedoch schon Viertel nach fünf und das Büro ohnehin längst geschlossen. Meine Ermittlungen hatten Zeit bis Montag, mein Privatleben nicht.
Ich hatte noch die Einkäufe zu erledigen, für die ich tagsüber wieder einmal keine Gelegenheit gehabt hatte, und zu Hause den üblichen Kleinkram. Anschließend würde ich mir einen entspannten Abend gönnen. Maximilian hatte versprochen, spätestens um acht zu Hause zu sein.
Benedetta fiel mir ein. Im Zuge der Aufregung im Dom und meiner anschließenden Nachforschungen hatte ich sie ganz vergessen. Ich musste dringend ein ernstes Wort mit ihr reden.
Seit bald vier Jahren bezog ich zwar mein Haupteinkommen aus meinem kleinen Büro für private Ermittlungen, aber dennoch war die Boutique nach wie vor ein wichtiges finanzielles Standbein für mich. Wenn Mona, meine einzige feste Angestellte, zu einem dringenden Termin musste und keine unserer Aushilfen verfügbar war, blieb mir nichts anderes übrig, als selbst einzuspringen. Und Benedetta wusste genau, was es für mich bedeutete, wenn sie sich nicht an ihren Dienstplan hielt.