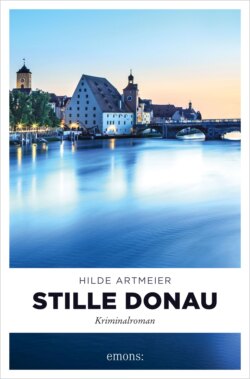Читать книгу Stille Donau - Hilde Artmeier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеIch sah auf den ersten Blick, dass ich nichts mehr für den an einem Vorsprung lehnenden Mann tun konnte. Einer alten Gewohnheit als ehemalige Polizistin folgend, beugte ich mich dennoch über ihn und fühlte seinen Puls. Nichts, natürlich. Sein Körper, registrierte ich, war noch warm.
Ich richtete mich auf, trat vorsichtig zurück, um keine Spuren zu verwischen, scannte in Sekundenschnelle die Umgebung ab. Schon in diesem Augenblick war mir klar, dass es sich hier um einen Tatort und nicht um einen bloßen Fundort handelte.
Der Tote saß mit dem Rücken zur Wand auf einer Steinbank am Ostende des südlichen Seitenschiffs, augenscheinlich von einem einzigen Schuss in die rechte Schläfe niedergestreckt. Mit dem Kopf und der linken Schulter lehnte er an dem Vorsprung, seine Augen blickten starr ins Nirgendwo, auf der linken Seite waren Hals, Schulter, Brust und Arm blutüberströmt.
Mir wurde flau im Magen. Dennoch nahm ich, wieder ganz automatisch, jedes Detail in mich auf. Die Eintrittsstelle des Projektils war kreisrund, mit einem Durchmesser von höchstens einem Zentimeter. Die Austrittsstelle musste umso größer sein und sich am Hinterkopf über dem linken Ohr befinden. Der Mörder hatte vermutlich direkt neben seinem Opfer gestanden.
Ich schätzte den Ermordeten auf Anfang dreißig. Die Hautfarbe verriet, dass er sich vor seinem plötzlichen Tod selten an der frischen Luft aufgehalten hatte. Das aschblonde Haar trug er kurz. Bekleidet war er mit orangefarbenen Jeans, einem T-Shirt und Sneakers einer gängigen Sportmarke. Keine Tasche, kein Rucksack, also offenbar kein Tourist. Oder sein Mörder hatte alles, was er nicht direkt am Leib trug, mitgenommen.
Ich trat noch weiter zurück und sah mich um. Ich stand in der Sailer-Kapelle, dem Aufbewahrungsort des Allerheiligsten. Trotz der Nähe zum Hochaltar, der links neben der Kapelle lag, verirrten sich nur wenige Besucher in diesen für das stille Gebet reservierten Bereich. Ein Gitter trennte ihn vom südlichen Seitenschiff. Zudem war der eigentliche Tatort durch den Vorsprung vor Blicken verborgen, was erklärte, dass bis auf die Frau, die vor dem Seiteneingang zusammengebrochen war, noch niemand die Leiche bemerkt hatte.
Um mich dröhnte Orgelmusik, machtvoll, düster und so laut, dass ich kaum etwas von den Schritten und dem Gemurmel der vielen Besucher hörte, die durch die gewaltige Kathedrale wanderten. Manche fotografierten auch oder saßen stumm in den Bänken. Im Gegensatz zur durch Lichtstrahler einigermaßen gut ausgeleuchteten Kapelle befand sich das restliche Bauwerk in dämmriger Dunkelheit. Das Sonnenlicht drang nur schwach durch die bunt bemalten, haushohen und uralten Fenster, da und dort flackerte Kerzenschein.
Es roch nach Weihrauch, den Hoffnungen und Tränen vergangener Jahrhunderte und in der Kapelle auch nach Tod. Was wohl Gott zu dem Frevel in seinem Haus sagte, an diesem würdevollen Ort, der schon während seiner Entstehung untrennbar mit dem Stolz und Leid so vieler Menschen verbunden gewesen war?
Ich zog das Handy aus der Tasche und verständigte die Rettungsleitstelle. Bis zum Eintreffen von Notarzt und Polizei, versprach ich der Beamtin am anderen Ende der Leitung, würde ich den Tatort gegen die Neugierigen abschirmen, die sich früher oder später zwangsläufig einfinden würden.
So leid es mir tat, aber Mona musste noch ein wenig länger warten.
***
»Ich kann hier nicht weg«, erklärte ich Mona eine halbe Stunde später, das Mobiltelefon erneut am Ohr. »Der Polizist, der meine Zeugenaussage aufgenommen hat, möchte mir noch ein, zwei Fragen stellen.«
Ein weiteres Mal stand ich draußen vor der Seitentür des Doms, wo jetzt ein fürchterliches Gedränge herrschte. Ich hatte Mühe, mich zu verständigen, berichtete Mona aber dennoch in ein paar knappen Sätzen, was seit unserem letzten Gespräch geschehen war. Eigentlich hatte ich erwartet, dass sie mich anrufen würde. Aber sie hatte sich nicht wieder gemeldet, um zu fragen, wo ich so lange blieb.
Zwei Rettungs- und drei Streifenwagen standen am Straßenrand, auch ein Team von der Kripo und die Spezialisten von der Spurensicherung waren eingetroffen. Mehrere Polizisten versuchten, die vielen Passanten und Schaulustigen im Zaum zu halten. Manche drängten durch die eilig errichteten Absperrungen, andere hielten ihre Smartphones in die Höhe, um Fotos zu schießen oder ein Video zu drehen. Viele fragten auch einfach nur, was geschehen war.
»Alles paletti, bin schon fast beim Amtsgericht.« Mona schien gar nicht richtig zugehört zu haben.
Ich drängte mich durch die Menge, um mir ein ruhigeres Plätzchen zu suchen, während sie jetzt ihrerseits mit den letzten Neuigkeiten lossprudelte. Vor etwa zwanzig Minuten war Benedetta im »BellaDonna« erschienen, meiner Boutique für hochwertige Secondhandmode und italienische Designerkleidung, und hatte schließlich doch noch ihre Schicht angetreten. Ein wenig atemlos zwar, aber immerhin. Mona hatte sich den fälligen Anpfiff verkniffen und sich auf den Weg zum Anwalt gemacht, der sie in einem Büro im Amtsgericht erwartete.
»Hab ich das eben richtig verstanden – jemand wurde erschossen?«, fragte sie. »Ja, wer denn?«
»Ein Journalist, wie du, aber bei der ›Süddeutschen Zeitung‹ in München. Er war noch keine zweiunddreißig, madonna.«
Das alles hatte ich von Armin Hellweg erfahren, der meine Aussage aufgenommen hatte. Ich kannte ihn von meinen Besuchen in Paolos Büro, meinem Ex-Mann und Vincenzos Vater.
Paolo selbst, Hellwegs Vorgesetzter und Hauptkommissar bei der Kripo Regensburg, war zurzeit in Urlaub, ein Umstand, den ich begrüßte. Sonst hätte ich mir gewiss wieder einmal anhören müssen, wie unfassbar es sei, dass er ausgerechnet seine geschiedene Frau an seinem Tatort antreffe.
»Bei der ›SZ‹?«, fragte Mona. Sie war nebenberuflich als freie Mitarbeiterin für die hiesige »Mittelbayerische Zeitung« tätig. »Da kenne ich jemanden, ziemlich gut sogar. Der Jakob, der hat nämlich mit mir studiert, und …«
»Jakob?«, unterbrach ich sie alarmiert. »Und wie noch?«
»Landauer.« Sie lachte. »Aber das wird ja wohl nicht der Tote im Dom sein, oder?«
»Doch. Genau so heißt er.«
Mona schnappte nach Luft. Dann murmelte sie etwas, offenbar stand sie vor der Tür des Anwalts, die gerade aufgegangen war. Sie versprach, sich später noch einmal bei mir zu melden, und legte auf.
»Sie können hier nicht durch«, quäkte eine aufgeregte Stimme neben mir. »Ich nehme die Personalien auf und … Oh, verzeihen Sie, Herr Pfarrer.«
Der Angesprochene, seiner Kleidung nach ein hochgestellter Würdenträger der Diözese, quetschte sich durch die Lücke, die sich gerade zwischen mir und einer jungen Streifenpolizistin auftat, einer mittelgroßen Blondine mit Pickeln auf dem Kinn. Ich beneidete sie und ihre Kollegen nicht um ihre Arbeit. Sie mussten den Tatort sichern, mögliche Zeugen ausfindig machen, die Neugierigen ringsum in ihre Grenzen weisen – immer bemüht um den richtigen Ton.
Die Frau, die die Leiche gefunden hatte, wusste ich mittlerweile, hieß Karin Haavestedt und war Anfang fünfzig. Der Schock stand ihr noch ins Gesicht geschrieben. Sie war umringt von aufgeregt durcheinandersprechenden Menschen, vermutlich ihre Reisegruppe, ein Kegelverein aus Mönchengladbach.
Inzwischen kannte ich den Ablauf: Karin Haavestedt, fasziniert von der Pracht und ehrfurchteinflößenden Architektur des Doms, hatte ihre Kegelgefährten aus den Augen verloren. Beim Anblick des Mannes hinter der Säule, der eine ähnliche Hose wie ihr Sitznachbar im Bus trug, eilte sie erleichtert auf ihn zu. Dann aber starrte sie auf sein blutverschmiertes Hemd und verlor fast schon an Ort und Stelle das Bewusstsein.
Bisher gab es keinen Hinweis auf den Täter. Niemand hatte etwas beobachtet, niemandem war etwas aufgefallen. Karin Haavestedt hatte zwar gemeint, einen leisen Knall gehört zu haben, in der Nähe des Hochaltars und kurz bevor sie den Toten entdeckte. Möglich, dass es sich dabei um einen Schuss handelte, aber die Orgelmusik habe das Geräusch fast übertönt. Auf meine Frage, ob jemand aus der Sailer-Kapelle gekommen sei, hatte sie nur mit den Schultern gezuckt.
Die junge Polizistin sprach nun auch mich an. Meine Aussage, wurde ich belehrt, solle ich so schnell wie möglich zu Protokoll geben, »am besten sofort, also gleich im Anschluss, jedes Detail ist für uns wichtig, das haben Sie schon verstanden, oder?« Es schien ihr erster Einsatz bei einem Kapitalverbrechen zu sein.
Wenn wirklich Benedetta die Frau mit Pferdeschwanz und Käppi vor dem Dom gewesen war, überlegte ich, als die Polizistin sich entfernte, hatte sie nur wenige Minuten Zeit gehabt, um in die Pfarrergasse zu meinem Laden zu sausen und Mona abzulösen. Das hätte sie mühelos geschafft. So unzuverlässig Benedetta in vielerlei Hinsicht war, so sportlich war sie doch. Wenn sie vielleicht sogar im Dom auf ihrer Kirchenbesichtigungstour gewesen war – die Frau, die ich gesehen hatte, musste aus Richtung der Seitentür gekommen sein –, hatte sie vielleicht etwas Verdächtiges bemerkt.
Ich nahm mir vor, sie später darauf anzusprechen. Ich wollte ohnehin ein ernstes Wörtchen mit meiner flatterhaften Praktikantin aus Rom wechseln.
***
Das Firmenschild, vor dem ich eine Stunde später stand, war so unauffällig, dass ich fast daran vorbeigelaufen wäre. »Manfred Billich, Agency«, las ich auf einem nicht einmal handtellergroßen silbernen Schildchen. Von meinen Auftraggebern wusste ich jedoch, dass sich hinter der nichtssagenden Bezeichnung ein Kunsthändler verbarg, der mit Gemälden aller Art und Preisklassen handelte, ein ungewöhnlicher Umstand. Die meisten Händler spezialisierten sich auf eine oder mehrere Epochen.
Ich läutete.
Das vierstöckige Bürogebäude in einer Seitenstraße nahe beim Stobäusplatz, in dessen oberster Etage die Agentur residierte, war schlicht. Hinter der sandgelben Fassade verbargen sich ein Übersetzungsbüro für slawische Sprachen, eine Investmentfirma und zwei Bürogemeinschaften.
Der Türöffner surrte. Ich drückte gegen die Milchglastür und ging zum Aufzug.
An einem steingrau lackierten Empfangstresen begrüßte mich kurz darauf eine unerträglich dünne Frau, die mich mit ihrem spitzen Näschen und dem kurzen Haar in Rotblond an eine Spitzmaus erinnerte. Ihr Mienenspiel passte allerdings nicht zu diesem Bild. Ihr Lächeln war so herzlich, dass ich dachte, sie würde mir jeden Moment um den Hals fallen.
Mit einer einladenden Bewegung deutete sie auf die mit hellgrauem Stoff bespannte Sitzecke gegenüber dem Tresen, doch ich blieb stehen. Sie trug ein Headset und telefonierte gerade. Ihr Gesprächspartner war offenbar der Mitarbeiter einer Spedition namens »Rapid Transports«. In fließendem Englisch informierte sie ihn über die baldige Abholung einer Sendung aus dem firmeneigenen Lager außerhalb der Stadt.
»Mona Weber«, stellte ich mich vor, als sie auflegte.
Wenn ich nicht als Privatermittlerin in Erscheinung treten wollte, benutzte ich meist Monas Namen. Ihren alten Presseausweis, den sie mir zuliebe vor einiger Zeit als verloren gemeldet hatte, ließ ich heute allerdings in meiner Handtasche. Nur kein Aufsehen erregen, lautete ja die Devise meiner Auftraggeber.
Ich erklärte, ich sei am Erwerb von Gemälden interessiert und wünsche, mit dem Inhaber der Agentur zu sprechen, was der Empfangsdame ein noch wärmeres Lächeln entlockte. Sie informierte ihren Chef telefonisch über mein Anliegen, führte mich in einen Besprechungsraum und bot mir Kaffee, Tee und Wasser an. Ich entschied mich für Letzteres.
Auch hier war die puristische Einrichtung vollständig in Grau gehalten, was wohl Exklusivität vermitteln sollte. Vier Stühle, ein runder Tisch, alles aus Designer-Plastik, dazu Flipchart und ein Sideboard mit Katalogen. An der Wand hingen moderne Drucke, die meisten mit kubistischen Darstellungen. Ein Geruch nach Orange lag in der Luft. Durch zwei gekippte Fenster drangen Verkehrsrauschen und das Geratter eines Presslufthammers herein. Der Ausblick auf die Jugendstilvillen mit ihren grünen Gärten und all dem architektonischen Charme, der typisch war für die Gegend am östlichen Rand der Innenstadt, entschädigte mich jedoch.
Die Mail, die Julius Kalterer mir versprochen hatte, war längst angekommen, inklusive Anhang. Die drei Gemälde, die ich für ihn und seine Frau ausfindig machen sollte, waren abstrakt und alle nach demselben Muster konzipiert: zwei Farbblöcke, die in der Mitte der Leinwand aufeinandertrafen, in Rot-Grün, Gelb-Blau, Lila-Orange. Die Farben waren frisch, die Konturen klar, die Gesamtwirkung ansprechend. Wenn mir jemand eines dieser jeweils einen auf anderthalb Meter großen Bilder geschenkt hätte, hätte ich es vielleicht sogar in meinem Zuhause aufgehängt. Das dafür nötige Kleingeld hatte ich allerdings nicht übrig. Meine Auftraggeber hatten mich ermächtigt, bis hunderttausend Euro zu bieten, ein Betrag, der mich nun, da ich die Fotos gesehen hatte, in Erstaunen versetzte.
Mein Honorar lag weit über meinem üblichen Satz. Dazu kamen die Spesen, die ich laut Julius Kalterers Worten gern großzügig berechnen durfte. Im Gegenzug hatte ich ihm und seiner Frau versprechen müssen, ihren Namen aus allen Verhandlungen und dem hoffentlich baldigen Kaufabschluss herauszuhalten. Die Sache war nämlich die: Ich sollte keine fremden Bilder für sie erwerben, sondern diejenigen, die ihnen bis vor Kurzem noch gehört hatten.
Vor wenigen Tagen hatten sie die drei Gemälde an den Kunsthändler verkauft, in dessen Agentur ich jetzt saß. Rosina Kalterer, der die Werke nie so richtig gefallen hatten, hatte den Stein ins Rollen gebracht. Inzwischen aber, hatte mein Auftraggeber mir erklärt, bereue auch sie die übereilte Transaktion. Er hatte versucht, den Kunsthändler zu einem Rückkauf zu bewegen. Dieser hatte sich jedoch nicht darauf eingelassen.
Ich war keine Kunstkennerin, und natürlich wusste ich, dass es in der Sammlerszene einige schräge Vögel gab. Dennoch war mir der Umstand, dass das ehemalige Architektenpaar ausgerechnet mich mit dem Rückkauf beauftragt hatte, im ersten Moment als rätselhaft erschienen. Schließlich gab es in zig deutschen Großstädten reihenweise Ermittlungsbüros, die auf den Erwerb von Kunstgegenständen spezialisiert waren. Meine Auftraggeber wollten aber jemanden aus der Gegend, hatten sie betont, mit gutem Leumund und Fingerspitzengefühl. Vermutlich war ihnen die Angelegenheit einfach nur peinlich.
Die Tür ging auf. Der Mann, der hereintrat, passte ins Ambiente. Alles an ihm war blass, sein exquisiter Anzug in mattem Grau ebenso wie das Aussehen. Blick und Händedruck waren allerdings so euphorisch wie bei seiner Empfangsdame. Manfred Billich begrüßte mich wie eine langjährige Kundin, mit ausgesuchter Eloquenz und für meinen Geschmack ein wenig zu aufdringlich. Dann setzte er sich mir gegenüber und legte sein übergroßes Smartphone und ein Tablet vor sich hin.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte er geschäftsmäßig. »Sind Sie an einer bestimmten Epoche interessiert?«
Ich gab vor, eine Freundin hätte mir kürzlich von drei außergewöhnlichen Gemälden vorgeschwärmt, die ein ihr bekanntes Ehepaar verkaufen wolle. Als ich den Namen der Malerin – Agnes Vienna – nannte und die Bilder beschrieb, runzelte er die Stirn.
»Tja, und heute rufe ich meine Freundin an und muss erfahren, dass die drei Werke nicht mehr zu haben sind.« Mit indignierter Miene zupfte ich an meiner eleganten Marlene-Hose herum, die mich zusammen mit der smaragdgrünen Seidenbluse – alles von Valentino und natürlich aus der Secondhandabteilung meiner Boutique – hoffentlich als zahlungskräftige Kundin erscheinen ließ. »Zum Glück wusste sie, wer den Zuschlag bekommen hat. Wie viel verlangen Sie dafür?«
»Sie kommen leider zu spät.« Er faltete die für einen so schmal gebauten Mann erstaunlich derben Hände, nur um damit im nächsten Moment über das Display seines Tablets zu wischen. Er sprach reinstes Hochdeutsch mit norddeutscher Färbung. »Die Bilder sind schon weiterverkauft.«
Ich verdrehte die Augen. »Aber, es ist doch noch keine halbe Woche her, dass …«
»Ja, tatsächlich, der Verkauf ist sehr schnell über die Bühne gegangen. Vor zwei Tagen, an einen guten Kunden.« Seine Finger glitten in schnellem Rhythmus über den Bildschirm. »Aber ich habe sicherlich etwas Ähnliches für Sie.«
»Das ist wirklich schade. Ich habe mich nämlich in die Bilder verliebt, buchstäblich, sie würden perfekt in das Entree unserer Villa passen. Wie heißt denn Ihr Kunde, wenn ich fragen darf?«
»Das dürfen Sie. Nur, eine Antwort dürfen Sie nicht erwarten. Diskretion ist einer der wichtigsten Grundsätze in meiner Firma.«
»Aber natürlich.« Ich nahm das Glas, das mir die Empfangsdame gebracht hatte, und trank einen Schluck. »Vielleicht kann ich Sie trotzdem noch erweichen? Glauben Sie mir, ich wäre genauso diskret wie Sie.«
Manfred Billich entgegnete nichts, sondern legte das Tablet vor mich hin. Dann lachte er verlegen, schnappte es sich wieder und stand auf. Es war so schnell gegangen, dass ich nur einen flüchtigen Blick auf die Abbildungen hatte werfen können, beide so abstrakt wie die Bilder von Agnes Vienna.
»Das ist jetzt dumm, die sind ja auch schon nicht mehr im Haus.« Mit kummervoller Stirn wiegte er den eckigen Kopf hin und her. »Hm … So auf die Schnelle ist das leider etwas schwierig.«
Er ging zum Sideboard, legte das Tablet ab und blätterte in einem Katalog, wobei er immer wieder seufzte. Ich strich mir eine meiner langen tizianroten Strähnen aus der Stirn und wartete.
Ein Piepston ertönte. Sein Seufzen wurde noch eine Spur intensiver. Er kam zum Tisch zurück und griff nach dem Mobiltelefon.
»Der nächste Termin«, sagte er. »Es ist mir wirklich peinlich, aber ohne Voranmeldung ist es bei uns leider immer ein wenig schwierig. Ich bringe Sie nach vorn und sage meiner Assistentin, sie möchte einen Termin für Sie vereinbaren. Dann nehme ich mir alle Zeit der Welt – in Ordnung, Frau Weber?«
Es blieb mir nichts anderes übrig, als mein Glas zu leeren und ihm zu folgen.
***
»Buongiorno, Sandra Perugi. Le chiamo a causa dell’ultima consegna«, sagte ich bald darauf mit verstellter Stimme in das Mikrofon meines Handys. Auf Deutsch, aber mit übertrieben italienischem Akzent fuhr ich fort: »Sandra Perugi, von ›Rapid Transports‹. I Sie rufe an wegen Abholung von die letzte Lieferung. Bin i dock ricktig bei die Agentur Billich?«
»Gerade noch, am Freitag machen wir immer früher Schluss«, antwortete Manfred Billichs Assistentin in scharfem Ton und zu meiner Überraschung in perfektem Italienisch. »Ich habe doch gerade mit einem Kollegen von Ihnen telefoniert – was gibt’s denn noch?«
Als ich vor zehn Minuten an ihr vorbeigegangen war, hatte sie in einer slawisch klingenden Sprache telefoniert, offenbar war sie ein Sprachenmultitalent. Und die guten Umgangsformen reservierte sie wohl nur für die Kunden.
»Perfetto«, sagte ich und fuhr auf Italienisch fort. »Das heißt, leider gar nicht gut, und eigentlich bin ich sowieso nicht zuständig. Ich rufe Sie nämlich aus Venezia an, unserer Filiale Italia-Nord.«
Sie schien etwas einwerfen zu wollen, aber ich ließ ihr keine Zeit und sprach in derselben Geschwindigkeit weiter wie eben.
»Gerade erhalte ich von einem unserer Fahrer nämlich die Info, dass er die falsche Ablieferadresse angefahren hat. Allora, und jetzt steht er vor dem Tor und weiß nicht weiter.«
»Aha. Und was wollen Sie jetzt von mir?«
»Die korrekte Zustelladresse.«
Für meine kleine Inszenierung hatte ich eigens meine italienische SIM-Karte ins Mobiltelefon eingelegt, die ich bei meinen Aufenthalten im Süden benutzte. Wenn ich von meiner deutschen Handynummer mit unterdrückter Nummer angerufen hätte, hätte ich gewiss ihren Argwohn geweckt.
»Das steht doch alles in den Frachtpapieren«, kam es genervt aus dem Hörer. »Kann Ihr Fahrer nicht lesen?«
»Kann er und hat er«, behauptete ich. »Aber nichts stimmt, weder der Empfängername noch die Adresse, assolutamente niente. Irgendjemand muss das falsch ausgefüllt haben. Außerdem, er ist Bulgare, tut sich schwer mit Deutsch, Italienisch geht gar nicht, und …«
Ungeduldiges Schnauben. »Um welche Sendung geht es denn?«
Ein Lkw dröhnte in meinem Rücken vorbei. Ich war auf dem Weg zu meinem Wagen, für den ich vor dem Bürogebäude keinen Parkplatz gefunden hatte.
»Einen Moment bitte.« Ich schirmte den Hörer gegen den Krach ab. »Die Abholung war vorgestern oder gestern. Wegen der Uhrzeit muss ich das Programm wechseln, das dauert leider immer ewig, aber …« Ich machte eine Kunstpause. »Aber gerade sehe ich den Namen des Vorbesitzers. Kalterer, Julius Kalterer.«
»Wer hat denn das da reingeschrieben?« Dieses Mal pustete sie ins Telefon, hörbar genervt. »Die Bilder sind an Vittorio Rossignolo gegangen, das heißt an seine Firma, die ›Rossi-Immo-Service GmbH‹ in Straubing.« Sie hielt kurz inne. »Sicherheitshalber gebe ich Ihnen noch seine Privatadresse, am Freitagnachmittag haben die vielleicht schon zu. Die Sendung muss nämlich unbedingt heute noch zugestellt werden, verstanden?«