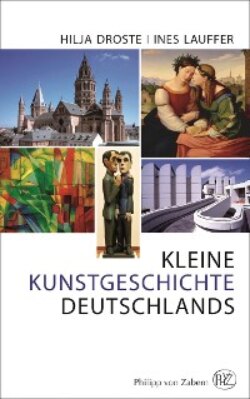Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE AACHENER PFALZANLAGE UND PALASTKAPELLE
ОглавлениеWahrscheinlich wurde die Aachener Pfalz seit den 780er-Jahren zu einer herrschaftlichen Residenz ausgebaut. Da Karl der Große seit 794 dort überwinterte, können wir davon ausgehen, dass die Anlage zu dieser Zeit soweit fertiggestellt war, dass er mit seinem Hof dort leben konnte. Von der gesamten Anlage ist heute hauptsächlich noch die Kapelle erhalten, die übrigen Bauten sind anhand weniger Überreste und archäologischer Grabungen identifizierbar, die eine bipolare Struktur offenbaren: Im Norden befand sich ein großer profaner Baukomplex mit repräsentativem Charakter, aus dem man durch Verbindungsgänge zu der im Süden liegenden Kapelle und deren Annexbauten gelangte. Über die genaue Funktion der einzelnen Bauteile und ihre Datierung herrscht Uneinigkeit und sogar der Status der Kirche als Pfalzkapelle ist infrage gestellt worden. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass sie neben ihrer Rolle als Pfalzkapelle auch als Stifts- und Pfarrkirche diente. Ihre Bedeutung resultiert aus ihrer mit Otto I. einsetzenden und über das gesamte Mittelalter hinweg währenden herausragenden Funktion als Ort der Königskrönung – zum Kaiser aber wurden die Könige (meist) in Rom erhoben.
Die als Zentralbau konzipierte Pfalzkapelle (vgl. Abb. 1) erhebt sich über einem im Innern achteckigen Grundriss (Oktogon), während sie außen mit doppelt so vielen Ecken als Sechzehneck erscheint. Der Innenraum teilt sich in zwei Stockwerke; die Maria geweihte Unterkirche ist deutlich niedriger und bildet durch die gedrungenen Rundbögen eine Art Sockelzone für die darüber liegende, dem Salvator geweihte Oberkirche, wo sich der Kaiser und sein Hof aufhielten. Diese besondere Bedeutung des Emporengeschosses wird durch eine prächtige Ausstattung hervorgehoben. In die sich zum Innenraum öffnenden Rundbogenarkaden sind in zwei Registern marmorne Säulen gestellt, für die teilweise Spolien aus Italien verwendet wurden; dazwischen befinden sich Bronzegitter, die mit kannelierten Pilastern und antikisierenden Kapitellen antike Architekturformen zitieren. Im westlichen Teil der Empore steht heute noch der Thron, der eventuell aus der Zeit Karls des Großen stammt. Von hier aus konnte der Herrscher die beiden Altäre im Osten, in der Ober- und Unterkirche, sehen, die sich im Umgang vor dem doppelgeschossigen Chor befanden. Der Chor ist ursprünglich wohl rechteckig gewesen und wurde Ende des 14. Jahrhunderts erneuert. Bis dahin sorgten einzig die Fenster im Umgang und im Tambour für Licht in der Kirche.
Über den Baumeister der Pfalzkapelle wissen wir nur, dass er ein Meister Odo aus Metz gewesen sein soll. So berichtete die durch die Aufzeichnungen Einhards übermittelte Bauinschrift. Sie selbst ist aber genauso wenig erhalten wie die originale Dekoration mit Mosaiken. Die heutige musivische Ausstattung ist im 19. Jahrhundert entstanden, soll aber ikonografisch den Originaldarstellungen folgen.
Die Vorbilder der Aachener Palastkapelle sind sowohl in Italien wie auch in Byzanz zu suchen. In ihrem Bautyp als Zentralbau dürfte sie von der Palastkapelle San Vitale in Ravenna (6. Jh.) beeinflusst gewesen sein, die von dem oströmischen Kaiserpaar Justinian und Theodora gestiftet wurde, aber ebenso auch von der Sergios- und Bacchus-Kirche in Konstantinopel selbst. Römische Vorbilder lagen dagegen der bronzenen Bauplastik und den Skulpturen zugrunde. Nicht nur die um 800 entstandenen Bronzegitter für die Empore zitieren antikes Formengut, sondern auch die acht Portalflügel mit Zungenfries, Eier- und Perlstab. Sie waren technisch eine Meisterleistung und sind eindrucksvolle Zeugnisse der karolingischen Renovatio.