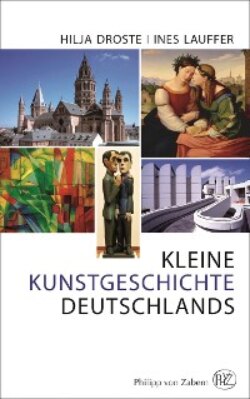Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BILDWERKE AM ALTAR
ОглавлениеDie Schriften, die noch zu Lebzeiten Karls des Großen um die Synode von Paris 824/25 entstanden sind, bestätigten die Argumentation der Libri Carolini im Großen und Ganzen, nahmen jedoch in einigen Punkten eine deutlich abweichende Position ein, die für die ottonische Kunst bedeutsam werden sollte. Da die Bilder an die res gestae (große Taten) zu erinnern halfen, konnten sie auch der memoria der Heiligen dienen. Während die Libri Carolini nur die Darstellung des Kreuzes akzeptierten, propagierten die Nachfolgeschriften den Kruzifixus (den Gekreuzigten), der nicht nur an die Passion erinnert, sondern auch direkt in die Liturgie, in die Eucharistiefeier eingebunden werden konnte. Auf der Grundlage dieser Argumentation entwickelte sich das vollplastische Bild des Gekreuzigten im 10. Jahrhundert (eventuell sogar schon im 9. Jh.) zum wichtigsten Ausstattungsstück einer Kirche, als ein Bildwerk, das seine Berechtigung erst in der Verbindung mit der Liturgie fand.
Von diesen frühen monumentalen Darstellungen des Gekreuzigten sind nur wenige erhalten, darunter das Gero-Kreuz im Kölner Dom, das noch vor 976 entstanden sein muss. Es ist wohl dieses Holzkreuz gewesen, das Erzbischof Gero von Köln (um 900–976) an seinem Grab vor dem Kreuzaltar aufstellen ließ. Ungewöhnlich für die Zeit ist, dass der Gekreuzigte hier nicht als über den Tod triumphierend, sondern als sterbender Mensch dargestellt ist: Sein Kopf mit dem leidenden Gesicht ist auf die Brust gesunken, die Augen sind geschlossen, der Körper mit vorgewölbtem Bauch hängt schwer am Kreuz. Die ursprünglich farbige Gestaltung ist komplexer gewesen, seine heutige Fassung mit dem eintönigen braunen Inkarnat bekam es erst im 20. Jahrhundert.
Aus der Zeit der Ottonen stammen auch die ersten thronenden Muttergottes-Skulpturen. Wie das Gero-Kreuz ist die Goldene Madonna (Abb. 6) aus der Essener Frauenstiftskirche, um 980 entstanden, eine der ältesten erhaltenen Skulpturen. Sie stand höchstwahrscheinlich auf dem Altar, wurde aber auch auf Prozessionen mitgeführt und war also mit der Liturgie verbunden. Trotz ihrer frontalen Ausrichtung ist die sitzende Figur auf Mehransichtigkeit angelegt. Mit ihrem durchdringenden Blick wirkt die Madonna ein wenig streng, doch gewinnt sie an Lebendigkeit durch das quer auf dem Schoß liegende Kind, das sie mit ihrer Linken umarmt, während sie in ihrer Rechten eine Kugel (oder einen Apfel) präsentiert. Obgleich Mutter und Kind einander zugewandt sind, blicken sie aneinander vorbei und wirken in ihrer Beziehung eher distanziert; ihr Verhältnis hat nicht jene spielerische oder liebevolle Note wie bisweilen spätere Muttergottes-Skulpturen. Die dünnen Goldbleche ummanteln den Holzkern der Essener Madonna vollständig; als einzige farbige Akzente sind die in Emailtechnik ausgeführten Augen der Gottesmutter und der Nimbus des Christuskindes sowie die verschiedenen Edelsteine an der Kugel und am Buch, das Jesus in Händen hält, hervorgehoben. Zu den wenigen weiteren Bildwerken, die noch heute die ursprüngliche goldene Gestaltung aufweisen, gehört die Goldene Madonna in Hildesheim (vor 1022?). Anders als die Essener Madonna ist sie, ebenso wie das Christuskind auf ihrem Schoß, starr nach vorne ausgerichtet. Damit repräsentiert sie den in der Zeit gängigen Madonnen-Typus der Sedes sapientiae (Thron der Weisheit), die thronende Muttergottes mit dem Jesuskind auf dem Schoß.
Beide Bildtypen, Kruzifix und Madonna mit dem Kind, beziehen sich auf die menschliche Natur Christi und zeigen den Anfang und das Ende seines irdischen Lebens. Im Ausdruck sind sie entgegengesetzt: der Gekreuzigte des Gero-Kreuzes ist von Leid und Tod gezeichnet, während die Muttergottesbilder ihn als wehrloses Kind zeigen, dessen Schutzbedürftigkeit durch seine Nacktheit gelegentlich noch unterstrichen wird. Die Rolle Marias in der Heilsgeschichte als Muttergottes gewinnt damit an Bedeutung und geht über ihre Darstellungen als Assistenzfigur weit hinaus.
Entgegen älterer Annahmen, die davon ausgingen, dass die frühen Skulpturen im Christentum immer Reliquien beherbergten – und auf diese Weise dem Vorwurf des Götzenbildes entgingen, da sie qua Reliquie legitimerweise im Kirchenraum aufgestellt werden konnten – finden sich für beide Praktiken Beispiele: Während bei der Hildesheimer Skulptur sowohl bei der Muttergottes wie auch beim Kind Reliquienöffnungen eingearbeitet sind, beherbergten das Gero-Kreuz und die Essener Madonna keine Reliquien.
6 Essen, Münster, Goldene Madonna
Eine weitere Neuerung bildlicher Kirchenausstattung stellt das sogenannte Antependium dar. Antependien bekleiden beziehungsweise verhängen (pendere) auf der Vorderseite (ante) den Unterbau des christlichen Altars (genannt Stipes). Diese Verkleidungen können aus Stoff, Leder, Holz oder aus Metall sein. Eines der berühmtesten ist das sogenannte Basler Antependium (Paris, Musée National du Moyen Âge, Thermes et Hôtel de Cluny), das aus getriebenem Goldblech auf Holzkern besteht. Es zeigt als Relief fünf Figuren aufgereiht unter Rundbogenarkaden, in der Mitte Christus, der streng frontal ausgerichtet ist. Seine rechte Hand ist segnend erhoben, in seiner linken hält er die Weltkugel, auf der das XP, das griechische Christusmonogramm, mit Alpha und Omega zu sehen ist. Die flankierenden Figuren sind im Dreiviertelprofil und der Mitte leicht zugewandt dargestellt. Zur rechten Seite Christi, vom Betrachter aus gesehen links, steht der Erzengel Michael, der damit den zweitwichtigsten Platz in der Bildhierarchie einnimmt. Sein Haupt ist, wie auch das der übrigen Figuren, von einem mit Edelsteinen besetzten Nimbus hinterfangen. In seiner Rechten hält er die Weltkugel und in der Linken eine Lanze, während die beiden Erzengel Gabriel und Raphael zur linken Seite Christi ein langes Zepter halten. Die fünfte Figur, ganz links in der Reihe, ist durch die Tonsur als Mönch gekennzeichnet. Anhand der Inschrift in der Arkade oberhalb der Figur ist er als hl. Benedikt von Nursia, als Ordensgründer der Benediktiner, zu identifizieren. Als Zeichen seines Amtes hält er den Abtsstab und das Buch mit den Ordensregeln in seinen Händen.
Zu Füßen Christi sind in Adorantenhaltung zwei deutlich kleinere Figuren abgebildet: Es sind die Stifter des Antependiums, das kaiserliche Ehepaar Heinrich II. und Kunigunde. Ob die Altarverkleidung tatsächlich für das 1019 neu geweihte Basler Münster oder vielleicht doch eher für die Kirche des Benediktinerklosters in Bamberg bestimmt war, ist nicht mehr eindeutig zu beantworten.
All diese Bildwerke – Gero-Kreuz, Goldene Madonna oder Basler Antependium – künden von einer neuen Phase bildlicher Kirchenausstattung, befanden sie sich doch alle direkt am oder in unmittelbarer Nähe zum Altar. Im Laufe des Mittelalters wurden die Altarausstattungen immer prächtiger und aufwendiger; ebenso nahm die Anzahl der Bildwerke stetig zu, sodass sie spätestens in der Gotik zur zentralen Aufgabe der Kunst wurden.