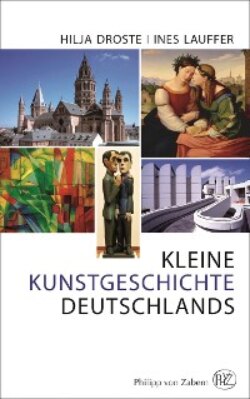Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
OTTONISCHE BUCHMALEREI
ОглавлениеÄhnlich wie schon zur Zeit der Karolinger hat von der ottonischen Wandmalerei kaum etwas die Jahrhunderte überdauert. Als eines der wenigen Zeugnisse sind auf der Bodenseeinsel Reichenau Fresken erhalten, wobei die Miniaturen, die von den Reichenauer Mönchen gemalt wurden, die Themen und den Stil vorgaben, der selbst in Frankreich und Italien nachgeahmt wurde. Dazu zählen etwa 50 Handschriften, deren prächtigste der Liuthard-Gruppe (980er–1030er-Jahre) zugerechnet werden, darunter die Bamberger Apokalypse (Bamberg, Staatsbibliothek), das Bamberger Perikopenbuch Heinrichs II. (München, Bayer. Staatsbibliothek; ein Perikopenbuch enthält ähnlich wie das Evangelistar nur jene Abschnitte der Bibel, die in der Messe zu lesen sind), das Hildesheimer Orationale (Hildesheimer Dombibliothek) und das Evangeliar Ottos III.
Noch immer gehören die Autorenporträts der Evangelisten zu den wichtigsten Miniaturen der Evangeliare, doch zeigen sie eine deutlich gewandelte Auffassung. Im Evangeliar Ottos III. sehen wir keine Evangelisten mehr, die schreibend oder innehaltend mit der Feder in der Hand vor dem Schreibpult sitzen, stattdessen wirken sie wie Seher, die frontal mit weit aufgerissenen Augen aus dem Bild blicken. In den erhobenen Armen halten sie Kreissegmente, die einander überlappen und Propheten und Engel umschließen. Sie selbst werden zwar noch von einer stilisierten Architektur eingefasst, aber wichtiger als die Arkaden werden die geometrischen Formen, denen die Figuren einbeschrieben sind, seien es Kreise, eine Mandorla oder ein auf die Spitze gestelltes Quadrat. Im Clipeus (Medaillon) über den Evangelisten ist ihr Symbol zu erkennen. Elemente einer Landschaft oder einer Architektur, die der Illusion räumlicher Tiefe dienen, werden hier eher zeichenhaft, meist aber äußerst spärlich eingesetzt; an ihre Stelle tritt eine leere Fläche, und zwar aus Gold! Das Aachener Liuthar-Evangeliar zeigt erstmals sogar sämtliche Darstellungen auf Goldgrund. Auf diese Weise gänzlich vom diesseitigen Raum in die Ewigkeit versetzt, erscheinen die Szenen beruhigt und wertvoll. Zugleich verdeutlichen sie ein Charakteristikum ottonischer Bildgestaltung: die leere Fläche, vor der die Gesten der Figuren sich so klar abheben, dass von der ottonische Malerei in der Forschung auch als Gebärdenmalerei gesprochen wurde (Abb. 5).
Auch die Maiestas Domini wurde rezipiert, während sich das Themenspektrum insgesamt erweiterte, darunter besonders auffallend die von einem neuen Selbstbewusstsein kündenden Herrscherbilder wie das berühmte doppelseitige aus dem Otto-Evangeliar (um 1000, München, Bayer. Staatsbibliothek; das Otto-Evangeliar beinhaltet eine doppelseitige und 34 ganzseitige Miniaturen). Otto III. thront zentral und frontal, größer als die ihn umgebenden und huldigenden Figuren, im Vordergrund. Der Bildaufbau ist, wie so häufig in ottonischer Buchmalerei, symmetrisch. In seiner Form als Diptychon bezieht sich das Herrscherbild auf antike Herrscher-Diptychen aus Elfenbein. Es gibt jedoch auch Formen des Widmungsbildes in der ottonischen Buchmalerei, in denen Christus den Herrscher krönt, ein Motiv, das sich aus byzantinischer Tradition speist und im Perikopenbuch Heinrichs II. zur Darstellung kommt: Hier thront nicht mehr der Kaiser frontal, sondern Christus ist ins Zentrum gerückt, flankiert von Petrus und Paulus als Stellvertreter der Kirche. Jeweils dazwischen stehen Heinrich II. und seine Frau Kunigunde, die in Dreiviertelansicht und aufgrund der Bedeutungsperspektive kleiner dargestellt sind. Wenn auch bescheidener im Anspruch, so konnte doch deutlicher die Theokratie kaum visualisiert werden. Solchermaßen speisten sich Christusdarstellungen aus den Herrscherbildern und umgekehrt: Die Formulierung eines Christusbildes im 4. und 5. Jahrhundert war ebenso beeinflusst vom kaiserlichen Triumphal- und Huldigungsbildnis, wie das Herrscherbild der ottonischen Handschriften von den Darstellungen Christi. Noch immer zählten solche Evangeliare zur wertvollsten Kirchenausstattung, doch neben sie gesellten sich auch andere Gegenstände und Bildwerke. Für die wortzentrierte Religion des Christentums bedurften diese Bildwerke allerdings einer Legitimation.
5 Perikopenbuch Heinrichs II., Verkündigung an die Hirten, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4452, fol. 8v