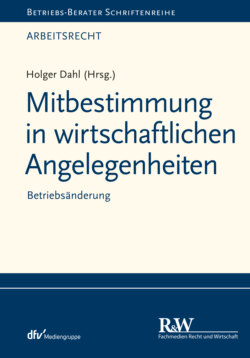Читать книгу Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten - Holger Dahl - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die betriebliche Dimension
Оглавление84
Zunächst bezieht sich ein Sozialplan auf den betriebsverfassungsrechtlich definierten Betriebsbegriff. Selbst wenn eine betriebsändernde Maßnahme gleichmäßig über verschiedene Betriebe eines Unternehmens umgesetzt wird und somit der Gesamtbetriebsrat ggf. für den Interessenausgleich zuständig ist, so ist doch weitgehend unbestritten, dass der örtliche Betriebsrat in der Frage des Sozialplanes in der überwiegenden Zahl der Fälle die originäre Zuständigkeit besitzt.4
85
Dies ist nicht zuletzt auf die Vorgabe des § 112 Abs. 5 BetrVG zur Bemessung des Sozialplanes in einer Einigungsstelle zurückzuführen, wonach die „sozialen Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen“ (§ 112 Abs. 5 Satz 1 BetrVG) sind. Darüber hinaus sind nach § 112 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BetrVG beim Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile Leistungen vorzusehen, die den Gegebenheiten des Einzelfalls Rechnung tragen.
86
Unmittelbar einleuchtend ist, dass der wirtschaftliche, in Euro zu bewertende Nachteil von Menschen, die ihren Arbeitsplatz im Umland von wirtschaftsstarken Metropolregionen verlieren, ein anderer ist als für diejenigen, denen dieses Schicksal in eher strukturschwachen Gegenden widerfährt. Wenn nun also ein Unternehmen jeweils einen Betrieb in den beiden genannten Regionen betreibt und an beiden Standorten eine vergleichbare Zahl von Menschen mit vergleichbaren Berufen entlässt, sind die sozialen Belange und wirtschaftlichen Nachteile der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die Gegebenheiten des Einzelfalls voraussichtlich alleine aufgrund der geographischen Lage und des damit zusammenhängenden sozioökonomischen Umfeldes deutlich unterschiedlich.
87
Im Lichte dieser grundsätzlichen Aussagen ist dann vom Betriebsrat zunächst der entstehende wirtschaftliche Nachteil für die Beschäftigten durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes zu bewerten. Dabei zugrunde zu legen ist das nach Auslaufen der Kündigungsfrist zu erwartende fehlende Entgelt aus dem Arbeitsvertrag inklusive sämtlicher erhaltener Einmalzahlungen und variabler Komponenten sowie zu erwartender Rentennachteile (inkl. Verluste aus nicht mehr bedienter betrieblicher Altersvorsorge). Gegengerechnet werden können diesem Entgeltverlust die möglichen Transferleistungen durch die Arbeitsagentur oder absehbare Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften (Transfergesellschaften). Zusätzlich sind die Aussichten auf eine vergleichbare Anschlussbeschäftigung in absehbarer Zeit ins Kalkül zu ziehen. Letzteres verdeutlicht durch seinen regionalen, räumlichen Bezug die Notwendigkeit der Fokussierung eines Sozialplanes auf die jeweilige betriebliche Perspektive.
88
Besonders dieser Aspekt ist häufiger Gegenstand von Auslegungsfragen und Diskussionen. Als Versuch der Objektivierung wird dabei meist die regionale, offizielle Arbeitslosenquote herangezogen, die durch die guten Arbeitsmarktdaten in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts dann unternehmensseitig als Argument für einen geringer zu bemessenden wirtschaftlichen Nachteil herangezogen wird. Dem kann betriebsratsseitig eine tiefergehende Analyse der Arbeitsmarktlage und der tatsächlich verfügbaren offenen Stellen entgegengestellt werden. Hierbei sollten die Qualifikationen der ausscheidenden Beschäftigten mit der Nachfrage am Arbeitsmarkt und den zu erwartenden Arbeitskonditionen abgeglichen werden. Insbesondere bei einem Abbau von un- bzw. angelernten Beschäftigten besteht trotz positiver Makro-Arbeitsmarktdaten ein erhebliches Risiko, in dauerhafte Arbeitslosigkeit oder prekäre Beschäftigungsformen abzugleiten. Diese oder ähnliche berufsgruppenspezifische oder sozioökonomisch konnotierte Ausgangssituationen bedürfen dementsprechend einer konkreteren Aufarbeitung, als dies lediglich mit einem Blick auf die allgemeine Arbeitslosenquote ermöglicht wird. Hierbei kann ein Blick in die reichhaltige – und leider ein wenig unübersichtliche gestaltete – Statistikseite der Arbeitsagentur helfen. So wird z.B. in einem dort zu findenden Analysetool ersichtlich, dass Menschen ohne Berufsabschluss ein signifikant höheres Risiko haben, in Langzeitarbeitslosigkeit abzugleiten, als dies für Menschen mit betrieblichem oder akademischem Ausbildungsabschluss der Fall ist.5 Die gleiche Aussage lässt sich in eben dieser Analyse für Menschen ab 55 Jahren validieren. Es kann sich daher betriebsratsseitig lohnen, tiefer in statistische Analysen und Berichte einzusteigen, um sich ein genaueres Bild des zu erwartenden wirtschaftlichen Nachteils von betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu machen. Neben der genannten Statistikseite der Bundesagentur für Arbeit sei hierzu als weitere mögliche Quellen zur Untermauerung von Argumentationslinien auch auf das Statistische Bundesamt6 sowie auf Daten der Hans-Böckler-Stiftung,7 der Gewerkschaften und entsprechender Branchenverbände verwiesen. Bei sämtlichen dargestellten Quellen ist zudem auch der branchenspezifische Aspekt zu hinterfragen. So ist beispielsweise für ausgebildete Fachkräfte in bestimmten Berufszweigen von höherem Arbeitsmarktrisiko auszugehen als für Fachkräfte in Branchen mit hoher arbeitgeberseitiger Nachfrage. Als Beispiel für erstere Branche ist in der zunehmend digitalisierten Welt der Ausbildungsberuf des Druckers zu nennen, hohe Nachfrage nach Fachkräften besteht zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Beitrags hingegen exemplarisch im Pflegebereich oder auch in Ingenieurberufen.
89
Weiterhin sollte bei drohenden Arbeitsplatzverlusten für Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben mitbedacht werden, dass eine neue Stelle oft nur in nicht tarifgebundenen Betrieben zu finden ist. Durchschnittlich sind hierbei meist signifikante wirtschaftliche Einbußen, z.B. in Form geringerer Arbeitsentgelte, schlechterer Sozialleistungen oder längerer Arbeitszeiten zu erwarten. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung der Thematik ist auch die Frage des höheren Jobverlustrisikos bei einem neuen Arbeitgeber durch Verlust von kündigungsschutzrechtlichem „Besitzstand“, durch Probezeit und Befristungsmöglichkeiten zu berücksichtigen und in die Betrachtung des wirtschaftlichen Nachteils „einzupreisen“.
90
Eine Orientierung für den Ansatz einer Sozialplanforderung seitens des Betriebsrats kann auch bei der durch die Maßnahme erfolgten Einsparsumme angesiedelt sein. So entschied das Bundesarbeitsgericht in seiner sog. „Rheuma-Klinik“-Entscheidung vom 6.5.2003, dass ein Sozialplan nicht deswegen zu hoch sei, weil das realisierte Einsparvolumen durch die Maßnahme um das doppelte überschritten wurde.8 Eine absolute Höchstgrenze ist jedoch auch damit nicht festgelegt. Vielmehr kann eine mögliche Einigungsstelle bei Betriebsänderungen, die auf langfristige Wirkungen angelegt sind, auch einen auf einen längeren Zeitraum bezogenen „Aufzehreffekt“ in Kauf nehmen, ohne dass aus diesem Grunde ihr Ermessensspielraum überschritten wäre.9
91
Als weitere Möglichkeit der Bemessung bzw. Beeinflussung der Höhe des wirtschaftlichen Nachteilsausgleichs ist die Ausarbeitung von Alternativmaßnahmen zu benennen. Der Betriebsrat kann im Rahmen der Beratungen zur Betriebsänderung ein Alternativkonzept ausarbeiten. Dieses könnte im Idealfall die gleichen wirtschaftlichen Effekte zur Folge haben wie das arbeitgeberseitig vorgelegte Programm, dabei jedoch deutlich geringere negative Auswirkungen für Beschäftigte enthalten. Wenn demzufolge nachweislich der gleiche wirtschaftliche Erfolg auch mit milderen personalseitigen Maßnahmen zu erreichen wäre und das Unternehmen aber an der ursprünglichen unternehmerischen Planung festhält, kann der wirtschaftliche Nachteilsausgleich auch höher bemessen werden. Denn in diesem Fall verzichtet der Unternehmer auf die Möglichkeit eines geringeren Sozialplanvolumens, um seine strategischen Überlegungen im Hinblick auf die weitere Unternehmensfortentwicklung zu realisieren. Demzufolge kann der wirtschaftliche Aspekt der Maßnahmenumsetzung nicht das drängendste Problem sein, und ein höherer Nachteilsausgleich ist argumentativ vertretbar.
92
Die zentralen Überlegungen bei der Betrachtung der betrieblichen Dimension einer Sozialplanforderung bzw. der zu betrachtenden wirtschaftlichen Nachteile sind aus Sicht des Betriebsrats immer betriebs-, branchen- und ortsindividuell vorzunehmen. Wichtige Kriterien hierfür sind:
– bisherige wirtschaftliche Leistungen des Arbeitgebers (inkl. sämtlicher, monetär zu bewertender Bestandteile) und Vergleich mit den zu erwartenden Nachteilen in Form von Einkommensminderung/-entfall, Wegfall von Sonderleistungen, weitere/längere Anfahrtswege, Wegfall von betrieblicher Altersvorsorge etc.;
– bei Stellenentfall: Aussichten auf dem Arbeitsmarkt im Hinblick auf die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Anschlussbeschäftigung:– im Hinblick auf die regionale Arbeitsmarktstruktur inkl. möglicher Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im Umland;– im Hinblick auf die Qualifikationen der ausscheidenden Beschäftigten (-gruppen) und der zugehörigen Angebotssituation auf dem Arbeitsmarkt;– im Hinblick auf die allgemeine Beschäftigungssituation in der Branche und Region;– im Hinblick auf das anzunehmende zukünftige Entgeltniveau bei evtl. neuen Arbeitgebern (z.B. auch im Zusammenhang mit möglicher Tarifbindung bzw. dem Entgeltniveau des bisherigen Arbeitgebers zu bewerten);
– Bewertung des erreichten sozialen und wirtschaftlichen Besitzstandes im Betrieb.
93
Diese sind gemeinsam mit den maßgeblichen Kriterien der unternehmerischen und individuellen Dimension in einer ganzheitlichen Analyse abzuwägen und dementsprechend einer Gesamtwürdigung zukommen zu lassen, die letztlich in die abschließend diskutierten Gestaltungsvarianten einfließt.