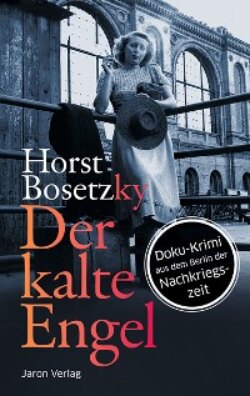Читать книгу Der kalte Engel - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 14
Kapitel 9
ОглавлениеAlbert Steinbock aus Cottbus, Witwer und gerade sechsundvierzig Jahre alt geworden, war mit Leib und Seele Polizist. Die Menschen brauchten eine Ordnung, wenn sie überleben wollten, und sie brauchten Männer, die darauf achteten, dass diese Ordnung auch eingehalten wurde. Leute wie ihn, Polizisten. Die waren genauso wichtig wie Ärzte. Die einen bekämpften die Krankheiten, die anderen das Verbrechen. Und Verbrechen waren nichts anderes als Krankheiten, Krankheiten des Volkskörpers. Sie gehörten ausgerottet. Also, ob Arzt oder Polizeiwachtmeister – ohne sie beide ging es nicht, und folglich sah sich Albert Steinbock als außerordentlich wichtiges und unentbehrliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft.
Umso schmerzlicher hatte es ihn getroffen, als er zu Beginn des Jahres 1949 in seiner Heimatstadt entlassen worden war. Man hatte in der Sowjetisch besetzten Zone (SBZ) beziehungsweise DDR mit der Reorganisation der Polizei begonnen, in deren Folge alle die Polizisten ihren Dienst quittieren mussten, die nahe Angehörige in den Westzonen hatten oder während des Krieges zufällig in amerikanische, britische oder französische Kriegsgefangenschaft geraten waren. Und Steinbock hatte Sohn und Schwiegertochter im Westen, in Berlin-Charlottenburg. Außerdem war er altes SPD-Mitglied und hatte sich geweigert, die Zwangsvereinigung mit den Kommunisten mitzumachen. »In die SED – nur über meine Leiche.« Bei den Machthabern in der Zone war er aber auch auf die Abschussliste geraten, weil er sich im Frühsommer 1948 geweigert hatte, das sogenannte Volksbegehren der SED »Für Einheit und gerechten Frieden« zu unterstützen. Aber dass sie einen so verdienten und sachkundigen Mann wie ihn einfach auf die Straße setzen würden, hatte er trotz allem nicht erwartet. Was nun? Wenn er nicht mehr Polizist sein durfte …
»Dann nehme ich mir das Leben.« Sein Sohn hatte ihn angeschrien: »Vater, das ist doch ganz einfach: Dann packst du eben deine Sachen und kommst zu uns.« Was Albert Steinbock dann auch getan hatte. Obwohl man ja eigentlich alte Bäume nicht verpflanzen sollte. Über verschiedene Kontakte war er als Wachtmeister bei der West-Berliner Polizei untergekommen. Und da wollte und musste er sich nun beweisen. Was gar nicht so einfach war …
Seit 1948 war ein heftiger Machtkampf um den Einfluss in der Berliner Polizei entbrannt. Während die Westmächte demokratische Strukturen anstrebten und das Modell von 1932 wiederbeleben wollten, war die Polizei in der DDR als Machtinstrument der SED gedacht und sollte daher in stalinistischer Art und Weise organisiert werden, also straff zentralistisch und mit militärischen Befehlsstrukturen. Im Berliner Alltag wurden die beiden so unterschiedlichen Prinzipien sehr schnell an den Namen zweier Männer festgemacht: Paul Markgraf stand für den Osten, Dr. Johannes Stumm für den Westen. Die Polizei Ost residierte in der Dircksenstraße nahe Alexanderplatz, die Polizei West in der Friesenstraße am Zentralflughafen Tempelhof. Und es war durchweg so, wie es Der Morgen, in Ost-Berlin erscheinend, am 19. August 1948 in seiner Überschrift zum Ausdruck brachte: Gespaltenes Berlin – günstig für Verbrecher. Im Text hieß es dazu: Erschwert wird die Verfolgung der Verbrecher auch dadurch, dass einige westliche Kriminalkommissariate sich grundsätzlich weigern, Festgenommene der Dircksenstraße vorzuführen. Im Westen witterte man fast immer eine kommunistische Schurkerei, gab es doch eine Reihe spektakulärer Entführungen, und waren immer wieder politisch unliebsame Zeitgenossen plötzlich spurlos verschwunden. Die jeweils andere Polizei wurde für unrechtmäßig erklärt, und wer im fremden Sektor eine Amtshandlung begehen wollte, war auf der Stelle festzunehmen. Es herrschte Kleinkrieg zwischen den beiden Polizeipräsidien, und das Reizklima war schließlich derart ausgeprägt, dass der Ost-Berliner Kripochef prompt von der Stumm-Polizei verhaftet wurde, als er privat eine Boxveranstaltung in der Waldbühne besucht hatte.
Während also die Zuständigkeit der Polizei an den Sektorengrenzen endete, konnten die Gesetzesbrecher weiterhin in beiden Stadthälften agieren und sich darauf verlassen, dass sich die verfeindeten Polizeien auch noch Sand ins Getriebe streuten, zumindest aber die nötige Kooperation erschwerten oder verweigerten. Der Morgen kommentierte das so: Wenn sich früher ein schwerer Junge dem strafenden Arm entziehen wollte, musste er schon über den Ozean fliehen, und selbst dann war er nicht völlig in Sicherheit. Heute begibt er sich in den anderen Sektor, um das behagliche Gefühl des Geborgenseins auszukosten.
»Vater, musst du denn andauernd Überstunden machen?« Sein Sohn sah es gar nicht gern, wenn Steinbock noch spätabends durch die Trümmerlandschaft streifte, die sich zwischen Zoo und Knie erstreckte, um nach Männern zu suchen, die Buntmetalle klauten.
»Ich muss die Burschen haben, das bin ich mir selber schuldig.«
»Pass bloß auf.« Ortwin Steinbock war Journalist und wusste, dass es in der Stadt Menschen gab, die vor nichts zurückschreckten. Es war man gerade ein halbes Jahr her, dass man Werner Gladow und seine Bande nach einem Schusswechsel à la Al Capone im Ost-Berliner Bezirk Friedrichshain festgenommen hatte. Es galt als sicher, dass der Oberstaatsanwalt am Ende des Prozesses für Werner Gladow wegen zweifachen Mordes und einer Reihe anderer schwerer Straftaten die mehrfache Todesstrafe beantragen würde. Trotzdem – oder gerade deswegen – wurde Gladow in beiden Teilen Berlins zum heimlichen Helden. Es gab kaum Jungs in der Stadt, die nicht Gladow-Bande spielten.
Albert Steinbock lachte und spielte die Sache herunter. »Ich versteh’ immer Gladow … Heißt das nicht Kladow da unten an der Havel?«
»Immer deine Kalauer. Du hast doch gelesen, was ich über den Leichenfund am Stettiner Bahnhof geschrieben habe. Da ist wieder einer am Werke, der …«
Sein Vater winkte ab. »Einen Tod kann man nur sterben.« Damit machte er sich auf den Weg. Buntmetalldiebstähle waren an der Tagesordnung, denn an Blei, Kupfer und Messing ließ sich eine Menge verdienen. Besonders wenn man es im Osten klaute und im Westen verscheuerte. Aber auch hier in Charlottenburg war man nicht untätig. Überall, insbesondere in alten Kellern und auf leer geräumten Grundstücken, warteten Schrotthändler auf fette Beute. Steinbock hielt sie allesamt für Hehler. Und wenn sich in den Ruinen keine Bleirohre, keine Wasserhähne und Türklinken aus Messing und keine Fensterbretter aus Zinkblech mehr finden ließen, dann schlich man sich eben in die Häuser, die stehengeblieben waren, und machte sich dort mit Säge, Zange und Schraubenzieher zu schaffen. Dadurch hatten sie gestern in der Carmerstraße ein Haus unter Wasser gesetzt. Und wer bekam dann die Schuld für alles? Die Polizei. Er, Albert Steinbock also. Darum war er so verbissen darauf aus, sich die Burschen zu schnappen.
Und so drehte er auch am Abend des 9. Dezember 1949 wieder seine Runde. Hardenberg-, Schiller-, Schlüterstraße und so weiter. Gewissenhaft hatte er sich aufgeschrieben, welche Häuser in der Hardenbergstraße zerstört waren: 1 bis 5, 13 bis 15, 20 bis 21, 23 bis 24, 27 und 37 bis 42. Die Nummern 1 bis 5 waren die Häuser auf der südlichen Straßenseite zwischen Knie beziehungsweise Bismarckstraße und dem Renaissance-Theater an der Knesebeckstraße, das nur vergleichsweise geringe Schäden aufwies. Albert Steinbock war das egal, ob sie schon wieder und was sie dort spielten, er würde sowieso nie hineingehen. »Ich hab’ schon so genügend Theater.«
Er vermutete, dass die Buntmetalldiebe zu dritt unterwegs waren. Einer stand Schmiere, während die anderen beiden am Sägen oder Abschrauben waren. Es war auch günstig, wenn einer die Taschenlampe hielt oder, war man in Ruinen an der Arbeit, darauf achtete, dass einem nicht alles auf den Kopf fiel. War da eben ein Pfiff gewesen? Er war sich nicht ganz sicher, denn eine Straßenbahn rumpelte vorüber. Wenn, dann musste der Pfiff vom Eckgrundstück Schillerstraße 3 / Hardenbergstraße gekommen sein. Steinbock machte ein paar Schritte und blieb dann stehen, um das Objekt zu mustern. Der ganze Block war zerstört, doch die Trümmer des Vorderhauses waren bereits weggeräumt worden. Seitenflügel und Quergebäude standen aber noch – als Ruinen. Und die Parterrefenster und Kellereingänge waren immer noch nicht zugemauert worden, so dass jeder dort einsteigen konnte. Am Tage die Kinder und nachts das zwielichtige Gesindel, dem Steinbock Kontra bieten wollte. Wieder ein Pfiff? Schwer zu sagen, woher er, wenn überhaupt, gekommen war. Vielleicht von einem Studenten drüben an der Technischen Hochschule.
Oder doch vom Ruinengrundstück an der Ecke? In Albert Steinbock kämpften Jagdeifer und Eigensicherung miteinander. Der erste Antrieb war stärker. Also betrat er das Grundstück und ging mit vorsichtigen Schritten über die rissige Betonplatte wie über dünnes Eis. Jeden Augenblick konnte er einbrechen. Nein, natürlich nicht. Ein Blick nach oben. Die rußgeschwärzten leeren Fensterhöhlen. Ein schauriger Anblick. Er wartete nur darauf, dass die Geister in ihren weißen und wallenden Gewändern erschienen. Das Licht der ohnehin nur matten Laternen vorne auf der Hardenbergstraße reichte schon lange nicht mehr, und er knipste seine Taschenlampe an. Deren Strahl traf den Eingang zum Keller. Von dort her war ein schleifendes Geräusch gekommen. Eine Ratte? Ein Liebespaar, das sich davonschleichen wollte? Ein Landstreicher, der hier auf seiner Decke schlief? Oder aber »seine« Buntmetalldiebe. Alles war möglich.
Die Kellertreppe. Er wagte sich ein paar Schritte hinunter. Angst, ja, die hatte er, aber wer die Ardennen-Offensive überlebt hatte, der … Und dennoch schrie er jetzt auf. Denn vor ihm lag ein Toter. Nein, kein Toter, das hätte ihn nicht so zusammenfahren lassen, denn Tote hatte er viel gesehen, sondern nur der Rumpf eines Menschen. Mit einem Stückchen Hals. Kein Kopf mehr dran, keine Arme, keine Beine. Das war das Entsetzliche.