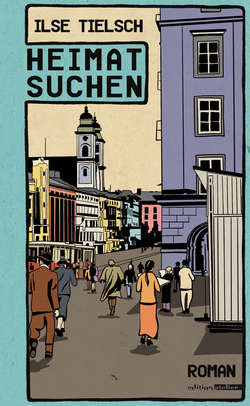Читать книгу Heimatsuchen - Ilse Tielsch - Страница 5
1
ОглавлениеNeben dem Bahndamm hielt Wundraschek sein Pferd an. Prrr, das hieß: bleib stehen. Alle Pferde Mährens verstanden diesen Zuruf, auch dieser magere Ackergaul, unter dessen schäbigem Fell sich die Rippen deutlich abzeichneten.
Wundraschek wußte natürlich, daß er mit diesem elenden Roß an keiner Schönheitskonkurrenz teilnehmen konnte, aber das lag ja auch nicht in seiner Absicht. Ein Pferd war Gold wert in diesen Zeiten, und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Es hatte ihn viel Mühe und Schlauheit gekostet, dieses hier über die letzten Monate des Krieges und dann noch über das Kriegsende mit allen seinen Folgen hinüberzuretten. Jetzt machte sich diese Mühe bezahlt. Für die Fahrt, die er eben, durch Anhalten seines klapprigen Wägelchens, beendet hatte, war er mit einer goldenen Armbanduhr, einem tadellosen Sonntagsanzug und noch mehreren anderen nützlichen und wertvollen Gegenständen belohnt worden, und es war nicht die erste derartige Fahrt gewesen und würde auch die letzte nicht sein. Die Deutschen mußten aus dem Land, das stand fest, das hatte er, Wundraschek, schon lange vor dem Ende dieses Krieges gewußt, alle Tschechen hatten es gewußt, nur die Deutschen hatten es, auch wenn man heimlich darüber geredet hatte, nicht geglaubt. Einige von denen, die zuletzt noch von den abziehenden Soldaten in ihren Militärautos mitgenommen worden waren, oder von jenen, die, noch ehe die Russen gekommen waren, mit Pferd und Wagen oder in überfüllten Zügen die Flucht ergriffen hatten, waren sogar, als sich die Lage einigermaßen beruhigt hatte, zurückgekommen und hatten ihr gesamtes Fluchtgepäck wieder mitgebracht. Er, Wundraschek, hatte nur den Kopf schütteln können über soviel Dummheit oder Naivität, das konnte man nennen, wie man wollte, er jedenfalls hatte es nicht verstanden.
Die meisten waren ohnedies dageblieben, in der Meinung, es würde schon nicht so schlimm werden, man würde die Besetzung durch die Russen in Kellern oder anderen Schlupfwinkeln abwarten, in den verzweigten unterirdischen Gängen etwa, die sich von der Kirche weg weit unter den Feldern und Weingärten hinzogen, man würde schon irgendwie überleben, und nachher würde alles wieder weitergehen, Tschechen und Deutsche in einem Land, wie das seit undenklichen Zeiten der Fall gewesen war.
Da haben sie sich getäuscht, dachte Wundraschek, das ist vorbei. Überall waren sie jetzt wohl unterwegs, der Grenze entgegen, jene jedenfalls, die man nicht in Lager gesperrt hatte, Frauen, Kinder, alte Leute, Mütter mit ihren Kleinkindern auf dem Rücken, die größeren an der Hand, von den jüngeren Männern waren die meisten gefallen, und jene, die noch lebten, waren wahrscheinlich irgendwo in Sibirien oder vielleicht auf dem Weg dorthin. Auf allen Straßen zogen die Deutschen dahin, einzeln oder in kleinen Gruppen oder in langen Zügen, man hatte ihm davon berichtet, aber Genaues wußte er nicht, wollte es auch nicht wissen. Was ging ihn das alles an? Er brachte diese hier zur Grenze, sie hatten ihn gut bezahlt, und er hatte dabei auch noch das Gefühl, ein gutes Werk zu tun. Wenn er sie nicht mit seinem Wagen bis hierher gebracht hätte, dann hätten sie immerhin etwa fünfundzwanzig Kilometer weit ihre Rucksäcke und Koffer selbst schleppen müssen, und das wäre ihnen, schon der Kinder wegen, nicht leichtgefallen. Die Kinder wenigstens hatten hin und wieder, wenn es nicht gerade steil bergauf gegangen war, auf dem Wagen sitzen dürfen. Wenn er dafür ein paar Wertgegenstände als Bezahlung genommen hatte, war das nur recht und billig. In außergewöhnlichen Zeiten waren für außergewöhnliche Leistungen immer noch besondere Preise berechnet worden. Er kannte die Leute von Kind an, vor allem die eine der beiden Frauen. Sein Vater hatte als Taglöhner auf dem Hof ihrer Eltern gearbeitet, später hatte sie den Doktor geheiratet und ein gutes Leben gehabt. Der Doktor war gekommen, wenn eines der Kinder krank gewesen war, auch nachts war er gekommen, wenn man ihn gerufen hatte, aber das war ja schließlich seine Pflicht gewesen, und es spielte jetzt keine Rolle mehr. Eine neue Zeit war angebrochen, nicht nur die Herrschaft der Deutschen war vorüber, auch die Herrschaft der Reichen, es würde keine Reichen und keine Armen mehr geben, keine Taglöhner und keine Knechte, keine Großbauern und keine Dienstboten, die für die Gnädigen die Wäsche wuschen. Von nun an würden alle gleich sein, gleich wohlhabend selbstverständlich, niemand würde mehr dienen müssen, niemand würde mehr arm sein. So jedenfalls stellte er, Wundraschek, sich die Zukunft vor. Wenn er jetzt, als Lohn für seine Fahrten, noch ein wenig zusätzlichen Reichtum sammelte, ein paar goldene Uhren, ein paar Ringe, Sonntagsanzüge, Halsketten für seine Frau, wen ging das schließlich etwas an?
(So oder ähnlich mag Wundraschek an jenem Vormittag im Juni 1945 gedacht haben. Viel später sollten jene Leute, die er nach und nach mit seinem klapprigen Wagen an die Grenze gebracht hatte, einander bei verschiedenen Anlässen wieder begegnen und erzählen, daß sich damals einer, der noch ein Pferd besessen habe, dazu bereit erklärt hätte, sie zur Grenze zu bringen. Sein Name würde genannt werden, und man würde auch den Fuhrlohn erwähnen. Er, Wundraschek, würde dadurch zu einer Art trauriger Berühmtheit gelangen, die er nicht beabsichtigt hatte.)
Prrrr, machte Wundraschek, und sein Pferd blieb stehen, im gleichen Augenblick von Fliegen umtanzt, die es durch Schlagen mit dem Schweif und durch unruhiges Stampfen mit den Beinen abzuwehren versuchte. Sein Herr klopfte ihm den mageren Hals, dann griff er nach den Gepäckstücken, die auf dem Wagen lagen, mehreren Rucksäcken und Koffern, und warf sie nacheinander auf den Grasstreifen neben der Straße. Er wußte, daß die fünf Erwachsenen, die dastanden und ihm zusahen, gehofft hatten, er würde sie vielleicht doch noch ein Stück weiter, bis zur nächsten, jenseits der Grenze gelegenen Ortschaft bringen, aber das wagte er nicht. Wer konnte schon sagen, ob nicht drüben, im Österreichischen, irgendein Posten lauerte, der nur darauf aus war, ihm sein Pferd wegzunehmen? Er hatte sie bis hierher gebracht, nun sollten sie sehen, wie sie weiterkamen, nach Österreich hinein oder weiter nach Deutschland, irgendwohin jedenfalls, von wo sie nicht mehr zurückkommen würden.
Dort, hinter dem Bahndamm, sagte er schließlich, sei der Bach, und dieser Bach bilde die Grenze, über ihn müßten sie hinüber, dann seien sie auf österreichischem Gebiet. Er müsse jetzt wieder fahren.
Ob er noch etwas von dem Sliwowitz bekommen könnte aus der kleinen Flasche, die er bei der Frau des Doktors gesehen habe?
Die Frau nahm die Flasche aus ihrer Handtasche, er setzte sie an die Lippen und trank, dann gab er sie wieder zurück, kletterte auf den Wagen und griff nach den Zügeln.
Hü! rief Wundraschek, und der Gaul, der diesen Zuruf verstand, wie ihn alle Pferde Mährens verstehen, zog an, das Gefährt entfernte sich auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren.
Die fünf Erwachsenen und die beiden Kinder standen noch ein paar Augenblicke lang wie verloren auf der Straße, dann bückten sie sich nach den Gepäckstücken, halfen einander in die Schulterriemen der Rucksäcke, griffen nach den Koffern und setzten sich in Bewegung. Sie kletterten über den Bahndamm, erblickten den Bach, der sich zwischen Weidengestrüpp und Schilfbüscheln schlängelte, und gingen darauf zu.
Es scheint einfach, sich vorzustellen, wie damals alles gewesen ist, wenn man die Landschaft kennt, in der sich dies zugetragen hat, wenn man sich Wundraschek, sein mageres Roß, den kleinen hölzernen Wagen (STREIFWAGERL HAT MAN SO EIN FAHRZEUG GENANNT) bis in die kleinsten Einzelheiten ins Gedächtnis zurückrufen kann, wenn einem ähnliches immer wieder berichtet worden ist, wenn man weiß, daß es ein sonniger Junivormittag gewesen ist, das Getreide zu beiden Seiten der Straße noch grün, aber schon hoch. Die dunkelgrünen Blattbüschel der Zuckerrüben sind ebenso vorstellbar wie die langen Reihen der Maispflanzen auf den Feldern, der Weinstöcke auf den Hügeln, die eigene Erinnerung hat den Geruch von der Sonne beschienenen Unkrauts anzubieten, Wegerich, Zinnkraut, Kamille, Sauerampfer, auch gelber Steinklee ist dabei, Taubnesseln, Brennesseln, Löwenzahn, andere Kräuter, deren Namen nie genannt worden sind, das Rumpeln der eisenbeschlagenen Holzräder von Wundrascheks Wagen, das Schnauben des Pferdes, das Klatschen der Roßäpfel, das Rauschen des Pferdeurins, das Klappern der beschlagenen Hufe auf den Granitsteinen der schmalen Straßen, Bilder, Gerüche, Farben, die man sehr früh schon aufgenommen hat. Man sieht die Menschen vor dem Hintergrund dieser Bilder, man sieht die Landschaft, die Konturen der Hügel, die Farben der Felder, man weiß, was sich in jenen Wochen und Monaten zugetragen hat, es ist beinahe so, als wäre man selbst dabeigewesen.
Das mit dem Bahndamm stimmt nicht, sagt die altgewordene Mutter, da ist kein Bahndamm gewesen, der Wundraschek hat uns mit seinem Wagen bis an den Grenzbach gebracht. Dort hat er unsere Sachen ins Gras geworfen. Wir waren sehr müde und voll Staub von dem langen Weg, die Kinder haben vor Müdigkeit geweint.
Ich habe mir nicht vorstellen können, noch einen einzigen Schritt zu tun.
Ich habe den Rucksack fast nicht mehr heben können. R. hat die Kinder nacheinander über den Bach getragen, dann alle unsere Rucksäcke und Koffer, dann sind auch wir anderen durch den Bach und durch das Schilf gewatet. Dann haben wir uns unter den Weiden ins Gras gesetzt.
Man muß sich vorzustellen versuchen, wie sie auf dem Grasfleck sitzen, kauern, stumpf vor Müdigkeit, vor Erschöpfung, Schmerz, Trauer, Verzweiflung, all das wird erst später wiederkommen, das Bewußtwerden des Elends, in das sie nach all den durchlebten und überstandenen Schrecken gestürzt sind, wird nicht von einem Tag auf den anderen vor sich gehen, das Ausmaß des Verlustes und vor allem die Endgültigkeit dieses Verlustes werden sie nur nach und nach erfassen können, der Schmerz wird erst einmal zunehmen, anschwellen müssen, ehe er abklingen kann.
Wenn die altgewordene Mutter heute sagt, sie sei MÜDE gewesen, dann schließt dieses Wort beinahe alles ein, was sie damals, auf dem Grasfleck zwischen den Weidenbüschen kauernd, empfunden hat.
Ergänzend fügt sie hinzu, sie seien ALLE GLÜCKLICH GEWESEN, endlich auf österreichischem Gebiet zu sein.
(Von den rund 3 295 000 Deutschen Böhmens, Mährens und dem zum Gebiet der Tschechoslowakei gehörenden Teil Schlesiens sind nach einer später anhand statistischen Materials durchgeführten Berechnung 2 814 000 lebend über die Grenzen gekommen. Nach Abzug der 235 000 nach 1945 in den genannten Ländern verbliebenen Deutschen und etwa 5 000 Vermißten gelangt eine 1959 erstellte Statistik zu dem Ergebnis, daß im Jahr 1945 unter der deutschen Bevölkerung dieser Länder 241 000 Todesopfer zu beklagen sind.)
Dokumentationen, Berichte von Augenzeugen, halten fest, wie es gewesen ist. Wie man sie aus ihren Häusern und Wohnungen trieb, ihnen sagte: Ihr müßt fort. Packt eure Sachen, was ihr tragen könnt, dürft ihr mitnehmen (keinen Schmuck, keine Sparbücher, keine Grundbesitzbogen, keine Wertgegenstände), alles andere bleibt zurück.
Sie liefen, rannten, packten die unsinnigsten Dinge zusammen, rafften Wäsche aus Schubladen, schnürten sie zu Bündeln, ließen Wichtiges liegen, steckten Unwichtiges in Rucksäcke, Koffer, Handtaschen, dachten nicht daran, daß sie ein zweites Paar Schuhe, eine wärmere Jacke, ein Kopfkissen für die Kinder brauchen würden, waren verwirrt, fassungslos, zu Tode erschrokken, stopften Kochtöpfe in Kinderwagen, konnten es nicht fassen, nicht glauben, nicht begreifen, dachten, sie gingen nur für kurze Zeit, würden zurückkehren, einen Teil des Zurückgelassenen wiederfinden, versteckten Schmuckstücke hinter Dachsparren, wickelten Kleinkinder in Decken, banden ihnen Kopftücher um die kleinen Köpfe, fanden keine Zeit zu trösten, Tränen zu trocknen, standen auf der Straße, liefen wieder zurück, doch noch ein Schmuckstück, ein Dokument, ein Fläschchen Milch für das kleinste Kind zu holen, steckten ein Stück Brot in die Tasche, sperrten Häuser und Wohnungen ab oder ließen die Türen offenstehen. Manche von ihnen fing man auf der Straße ein, jagte sie zu den anderen, die man schon zusammengetrieben hatte, erlaubte ihnen nicht, noch einen Mantel, ein Tuch, eine warme Decke zu holen, nach ihren Angehörigen zu suchen.
Man trieb sie wie Vieh über die Straßen, der Grenze entgegen, die Alten und Schwachen brachen unterwegs zusammen, krepierten wie Tiere, wurden später verscharrt oder auf Haufen geworfen, mit Benzin übergossen, angezündet und verbrannt.
In den Dörfern setzte man Fremde in die Bauernhöfe, ließ die ehemaligen Besitzer die Arbeit von Knechten verrichten, solange man sie brauchte, steckte sie dann in Lager, pferchte sie in Ställe, man schleppte sie in Keller, folterte sie, quälte und erniedrigte sie auf jede nur denkbare Weise, man ließ sie auf den Knien über Glasscherben kriechen, man schlug sie wie Ungeziefer tot, ertränkte sie in Löschteichen, kennzeichnete jene, die am Leben bleiben durften, mit weißen Armbinden, auf die ein schwarzes N gedruckt war, N, das hieß NEMEC, also Deutscher, es war das Letzte, das Niedrigste, was man sein konnte.
Manchen gelang die Flucht aus Lagern, Gefängnissen, sie krochen wie Tiere über die Grenzen, manche nahmen sich das Leben, manche banden Alte und Kinder an sich fest und sprangen in Flüsse, das Wasser riß die Menschenbündel mit sich fort, spülte sie irgendwo an Land, wo sie liegenblieben, bis sich einer erbarmte und sie begrub. Andere brachte man später zu Bahnhöfen, stopfte sie in Güterwaggons oder in offene Kohlenwaggons, in denen sie aneinandergepfercht standen, schob sie über die Grenzen nach Österreich oder gleich nach Deutschland ab, HEIM INS REICH, sagte man ihnen, das hätten sie immer gewollt, dort gehörten sie hin.
Aber auch einzeln, in kleinen, elenden Gruppen, zogen sie über die Straßen, winzige Reste ihrer Habe in Bündeln, Rucksäcken, Koffern tragend, auf klapprigen Wägelchen hinter sich herziehend, in Kinderwagen gestopft. Manchen von ihnen hatte ein barmherziger Nachbar, ein Freund, zu gehen geraten, ehe die anderen, die vielen gingen, zum Gehen gezwungen würden. Oft war es eine gute Tat, ein Freundesdienst, eine Hilfe in der Not gewesen, die jetzt durch einen Rat, durch die heimliche Aufforderung zum raschen Weggehen vergolten wurde. Sie schleppten sich über die Grenzen, hockten, lagerten auf den Feldern, wußten nicht, wohin sie sich wenden sollten, sahen von weitem aus wie traurige Riesenvögel, zogen dann weiter, bettelten um Unterkünfte, um ein Nachtlager im Stroh, in einer Scheune, in einem leerstehenden Stall, in irgendwelchen Winkeln, die vor dem Regen, vor der Kälte der Nächte schützen konnten. Sie arbeiteten für einige Kartoffeln auf fremden Feldern, viele trugen ihre unterwegs verstorbenen Säuglinge, Kleinkinder mit, um sie auf fremden Dorffriedhöfen zu begraben, wo man ihre Namen auf kleinen Grabsteinen lesen kann, viele brachten ihre alten, halbtoten Eltern nur noch zum Sterben jenseits der Grenzen mit. Unzählige verreckten an Typhus, an der Ruhr, die sie dann auch in die Grenzgebiete einschleppten. Tragödien, wie sie sich im Lauf der Jahrhunderte immer wieder, in vielen grausamen Varianten, ereignet haben? Diesmal war es anders, diesmal war es mehr. Zwei Völker verschiedener Muttersprache hatten sehr lange Zeit hindurch in einem Land gelebt, das beiden HEIMAT gewesen war. Nun hatte ein Volk das andere aus dieser gemeinsamen Heimat verjagt, entschlossen, es für immer daraus zu verstoßen.
Diesmal bestand keine Möglichkeit mehr, nach überstandenen Kriegsgreueln, nach überwundenen Schrekken, gemeinsam mit- oder wenigstens nebeneinander das verwüstete Land in Ordnung zu bringen, die Häuser neu aufzubauen, die Toten zu begraben, eine neue Ordnung zu schaffen. Nur in wenigen Fällen wurde der Versuch unternommen, jene, die schuldig waren, von den Unschuldigen zu trennen, es wurden beinahe ausnahmslos alle bestraft. Aufschreibend, wie es gewesen ist, gedenke ich, Anna, jener Ungenannten, die damals nicht billigten, was geschah. Jener Bäuerin gedenke ich, die heimlich ein Stückchen Brot, wenigstens einen Schluck Wasser reichte, jenes Bauern, der nur eine einzige Kuh besaß, diese vor einen Wagen spannte, eine Familie mit kleinen Kindern zur Grenze brachte, dafür nur geringen Lohn verlangte, weil er wußte, wie wenig denen, die er da fuhr, geblieben war.
Jenes Unbekannten gedenke ich, der das im Prager Stadion unter freiem Himmel und unter kaum zu schildernden Umständen geborene Kind einer Mutter aus B. in ein Krankenhaus brachte, wo es gepflegt wurde und überlebte. Aller jener, die Hilfe und Schutz gewährten, die im entscheidenden Augenblick rieten, das Land zu verlassen, wie das im Fall Heinrichs und Valeries gewesen ist.
(Die Statistik gibt die Zahl der EINZELWANDERER, also jener Deutschen aus den Ländern Böhmen, Mähren und Schlesien, die einzeln oder in kleinen Gruppen über die Grenze gekommen sind, allein für das Land Bayern bis zum April 1946 mit 18 000 an. Jene, die einzeln die österreichische Grenze überschritten haben, zu denen Heinrich und seine Frau Valerie gehört haben, wurden nicht gezählt.)
Wir sind mit der Mutter zur Grenze gefahren, Bernhard und ich, wir wollten der Vergangenheit begegnen und uns selbst in dieser Vergangenheit, wir wollten die Zeit zurückdrehen, wiederfinden, was sich damals begeben hat.
Die Mutter erinnert sich an Einzelheiten, und doch ist alles schon so weit weg, als ob es in einem früheren Leben gewesen wäre. So lange ist es schon her, daß wir das Haus, in dem Vater und Mutter, Heinrich und Valerie, damals, als sie über die Grenze gekommen waren, die ersten Tage verbringen durften, erst nach längerem Suchen wiederfinden. Ein alter Mann, der im Schatten eines Nußbaums auf einer Bank sitzt, weist uns den Weg, trotzdem stehen wir erst einmal längere Zeit vor einem anderen Haus, das die Mutter wiederzuerkennen glaubt. Sie beschreibt das Zimmer, in dem sie geschlafen hat, zeigt auf ein Fenster, sagt, hier sei es gewesen, bis sich herausstellt, daß sie sich irrt, daß es sich um das viel kleinere, niedrigere Nachbarhaus gehandelt hat.
Das sind gute Menschen gewesen, sagt die Mutter.
Aber ein ganz bestimmter Feldweg existiert noch, hellbraun, mit einem Stich ins Graue, er verläuft zwischen Weizen- und Rübenfeldern, zwei Fahrspuren, rechts und links, zeichnen sich ab, in der Mitte eine weichere, mit Erdstaub bedeckte Rinne. Damals waren es Spuren von eisenbeschlagenen hölzernen Wagenrädern, jetzt sind es Traktorenräder, von denen die Erde festgefahren worden ist, man merkt den Unterschied kaum, frühsommerliche Hitze hat den Boden ausgetrocknet, die harte Kruste ist von Rissen und Sprüngen wie von einem Netz überzogen. Der Weg läuft ein langes Stück geradeaus, schlängelt sich gegen den Grenzbach hin, verliert sich dann zwischen Weidenbüschen, das jedenfalls nehmen wir anfangs an, erst als wir später näher an den Bach herankommen, merken wir, daß er knapp vor dem mit Schilfbüscheln bewachsenen Ufer scharf nach links abbiegt, den Bach entlang weiterverläuft.
Ja, sagt die Mutter, hier sind wir gegangen. Sie erinnert sich, ein Irrtum ist ausgeschlossen, damals hat es genauso ausgesehen, hier hat sich nichts verändert, nur man selbst ist älter geworden, man hat seither so vieles erlebt, man ist über so viele Wege gefahren und gegangen, jetzt sieht man alles mit anderen Augen. Die Mutter streicht mit der flachen Hand über die noch grünen Weizenähren, eine fast zärtliche Bewegung, sie berührt mit ihren Fingern die Rinde eines kleinen, ruppigen Apfelbaums am Rand eines alten Straßenstücks, in das, von der Seite her, schon das Gras wuchert und das sich schließlich in einem Kartoffelfeld verliert.
Ich hab’ es so gern, wenn die Lerchen singen, sagt sie, aber jetzt, in der Hitze des Junimittags, sind keine Lerchen zu hören, kein Mensch ist weit und breit zu sehen, kein Tier, kein Ackergerät.
Damals ist es auch so heiß gewesen wie jetzt, sagt die Mutter.
Es ist keine Bitterkeit in ihrer Stimme, obwohl ihr alles wieder gegenwärtig sein muß, was sie vor nun schon mehr als fünfunddreißig Jahren erlebt hat. Der Schmerz ist abgeklungen, das Leben ist weitergegangen. Damals, im Juni 1945, ist sie zweiundvierzig Jahre alt gewesen, jetzt wird sie bald achtundsiebzig sein, der Grenzbach mit den verschilften Ufern, den Weidenbüschen hat ihr Leben in zwei beinahe gleich große Hälften geteilt, auch die zweite Hälfte hat, nach Überwindung der ersten schwierigen Jahre, ihre erfreulichen Augenblicke, ihre Lichtpunkte gehabt. Dort drüben, jenseits der Grenze, liegen Kindheit, Jugend, liegen die ersten zwanzig Jahre ihrer Ehe mit Heinrich, dem Arzt, der aus Nordmähren in die kleine Landstadt im Süden gekommen war. Sie hat glückliche Jahre erlebt, Freude, aber auch Sorgen genug, zwei Weltkriege, Hungerjahre, zuletzt noch Schrecken und Todesangst. Nein, nicht nur freundlich sind die Erinnerungen an die erste Hälfte ihres Lebens, die mit dem Durchwaten des Grenzbachs im Juni fünfundvierzig abgeschlossen war, sie ist nüchtern genug, das zuzugeben, wehrt sich überhaupt gegen die Verzeichnung der Wirklichkeit, sieht Licht und Schatten in annähernd richtigem Verhältnis zueinander, ist dankbar für die guten Jahre, die sie, nach Überwindung der ersten Not, in der zweiten Hälfte ihres Lebens noch hatte.
Wie sie da steht, auf dem Weg zwischen Weizen und jungen Rüben, sieht die Mutter nicht so aus, als ob sie von furchtbaren Erinnerungen gequält würde. Man hat den Eindruck, daß sie diesen frühen Sommertag genießt, die Sonne, die warm auf die Haut scheint, den Geruch der Kräuter am Wegrand. Erst als Bernhard sich anschickt, auf dem Weg weiter bis zu der Tafel zu gehen, deren Schrift er aus der Entfernung nicht lesen kann, die jedoch offenbar anzeigt, daß hier die Staatsgrenze verläuft, wird sie unruhig, ruft ihm zu, er möge doch stehenbleiben, umkehren, zurückkommen. Ihre Stimme klingt ängstlich, schließlich fast böse, sie beruhigt sich erst wieder, als Bernhard tatsächlich umkehrt und wieder auf uns zukommt. Der Schmerz ist abgeklungen, Schrecken und Angst jedoch blieben unvergessen.
Auf der gefalteten, an der Unterseite mit Leinengewebe beklebten Landkarte, die mir ein alter Mann vererbt hat und auf der die deutschen Ortsnamen noch verzeichnet sind, finde ich, Anna F., die kleine Landstadt südlich von Brünn, die ich mit dem Buchstaben B. bezeichnet habe, um Abstand zum Schauplatz der Kindheit zu gewinnen, zu dem Ort, der auf diese Weise jedoch nicht verschiebbar, austauschbar wird, Distanz auch zu den Bewohnern und ihren Schicksalen.
Nur in diesem scheinbar imaginären Raum ist es mir möglich, mich frei zu bewegen, mich nicht an der Realität zu stoßen, zu verletzen. Ich muß mich, was diesen Ort betrifft, abheben können von der Realität, von der Trauer, von der verletzenden und verletzbaren Wirklichkeit.
B. also, dieser in früher Geschriebenem schon geschilderte Ort, noch einmal, ehe ich ihn für immer verlasse.
B., wie es damals, in jenem früheren Leben des Paares Heinrich und Valerie, gewesen ist, wie es heute nicht mehr existiert, wie es niemals mehr sein wird. B., das Valerie, ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern HEIMAT gewesen ist, das auch Heinrich, der aus dem nördlichen Teil des Landes Zugewanderte, in sein Heimatbild einbezieht, das er später EINE VERTRÄUMTE KLEINE LANDSTADT nennen wird. B., wo die einzige Tochter des Paares, Anni, geboren worden ist.
Auf alten Postkarten schieben sich Hausdächer zu einem in einen Talkessel gedrängten Häuflein zusammen, Baumkronen füllen vorhandene Zwischenräume, ein spitzer, kupfergedeckter Kirchturm mit Turmknauf und Kreuz, gotisch gewölbten Fenstern und überdachtem Laubengang ragt hoch über dem gotischen Presbyterium und dem darangeschobenen niedrigeren Dach des Kirchenschiffes, das mit glasierten Ziegeln in bunter Musterung gedeckt ist, die hellen römischen Zahlen auf den schwarzen Zifferblättern der Uhr sind deutlich erkennbar. Gegen diesen Kirchturm wirkt der ihm gegenüberliegende Turm des neugotischen Rathauses zierlich und klein.
(Auf älteren Ansichten fehlt dieser Rathausturm, die Kirchturmspitze ragt hoch über ein zwiebelförmiges Dach empor.)
B., in einem nach Südosten geöffneten Tal, nur 193 Meter über dem Meer, von Hügeln mäßiger Höhe umgeben, freundliches Schachbrettmuster vielfarbiger Felder, Weingärten, Obstbaumkronen.
Die Erinnerung nennt einige der Hügel mit Namen, Sonnberg, Altenberg, Stroßberg, Wechselberg, Kreuzberg, fügt die seltsamen Namen BETTLER UND LAUSER hinzu, läßt die Hügel wellig auslaufen, hat noch einen Namen für das niedrige Gebirge bewahrt, das hier in sanften Erhebungen und Mulden endet, nennt diesen Namen: DER STEINITZER WALD. Der Steinitzer Wald gehört zum Massiv des Marsgebirges, das Marsgebirge zieht sich westlich der mährischen Karpaten hin und ist durch die Furche der March von diesem getrennt.
Ein träge strömender Bach durchfließt das Tal, die Stadt, schlängelt sich zwischen Getreide-, Mais- und Rübenfeldern dem bräunlichen Gewässer des Flusses Thaya entgegen, der sich wiederum, nachdem er bei dem Dorf Muschau die vereinigten Flüsse Schwarzach oder Schwarzawa, Zwittach oder Zwittawa, Česava und Iglawa oder Igel aufgenommen hat, in Höhe des österreichischen Städtchens Hohenau in die March ergießt. Es kommt vor, daß der unscheinbare, sonst kaum beachtete Bach, nach starken Gewittern oder Wolkenbrüchen, die in der Gegend häufig sind, anschwillt, den Graben, zwischen dessen Böschungen er an heißen Sommertagen beinahe gänzlich versickert, plötzlich ausfüllt, aus seinen Ufern tritt, die Stadt überschwemmt, Brücken vernichtet, geschichtetes Holz und Ackergerät wegspült, Schweine, Rinder, Pferde, ja sogar Menschen mitreißt, die dann in seinen Fluten umkommen, ertrinken, Keller unbenützbar macht, Weinfässer wegschwemmt, Haus- und Stallmauern unterwäscht und zum Einsturz bringt. Es ist vorgekommen, daß sich die Bewohner von B. vor den Wassermassen auf Hausdächer retten mußten, daß sie gezwungen waren, ihre hölzernen Waschtröge als Fortbewegungsmittel zu benutzen. 1935 ist der Bach zum letztenmal aus den Ufern getreten, Heinrichs Tochter Anni, damals sechs Jahre alt, hat es erlebt.
Nach Brünn, nach Göding, nach Lundenburg, weiter nach Wien führten die Straßen, die B. mit der restlichen Welt verbanden, nicht immer zum Vorteil der Bewohner, die sich vor Schweden, Türken, Ungarn, vor Mongolen und Tataren, vor Preußen und vor den Söldnern der eigenen Kaiser, Könige, Herzoge, aber auch vor furchtbar hausenden Räuberbanden innerhalb ihrer Stadtmauern verstecken mußten. Sie beschossen die verschiedensten Feinde aus den Schießscharten ihrer Wehrmauern, mußten dann aber doch in den meisten Fällen nachgeben und die Tore öffnen, wurden ausgeraubt, geplündert, vergewaltigt, in Sklaverei abgeführt, Männer, Frauen, Kinder, gleich welchen Alters und welchen Geschlechts, mußten zusehen, wie ihre Häuser niedergebrannt, ihre Felder zertrampelt, ihr Hab und Gut gestohlen, ihre Ställe und Scheunen geplündert wurden, konnten sich nur selten und unter größten Opfern loskaufen, vor dem Allerärgsten retten.
Prokop der Kahle mit seinen taboritischen Horden, ungarische Kumanen nach der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen, die Anhänger des gegen Rudolf den Zweiten rebellierenden Stephan Boczkay unter einem Fürsten namens Patschowsky, die Truppen Kaiser Rudolfs und seines Nachfolgers Matthias, Bethlen von Gabors plündernde, mordende, brandschatzende Haufen, Kaiser Ferdinands spanische Söldner, nach deren Abzug es hieß, in Mähren sei »an etlichen Orten weder Hund noch Katz zu finden, es sei alles aufgefressen«, sie alle sind diese Straßen entlanggezogen. Dreimal überfielen die Schweden unter Torstenson die kleine Stadt B., nach ihnen die Türken unter ihrem Großwesir Achmed Kiuprili. Auch jener Postmeister von Brünn, Johann Georg von Metzburg, der sich, weil er der türkischen Sprache mächtig war, als Türke verkleidet, durch die feindlichen Lager schlich, um in Wien Hilfe für seine bedrängte Stadt zu erbitten, wird durch B. gekommen sein, auch die den Türken folgenden kaiserlichen Generäle mit ihren Truppen, die einen so üblen Ruf hatten, daß sich die Einwohner der Dörfer und Städte bei ihrem Herannahen in die Wälder verkrochen, aus denen sie sich lange nicht wieder hervorwagten und von wo aus sie jenen Kometen beobachten konnten, der zu Beginn des Jahres 1664 am Himmel erschien, »in Gestalt eines gehörnten Mondes, einen langen, dreygespitzten Schweif gegen Mitternacht, zwei kleinere gegen Mittag ausstrahlend«, worauf sie das Nahen des Antichrist und den Untergang der Welt erwarteten.
Wer hat behauptet, die Schrecken vergangener Jahrhunderte seien mit jenen unserer Zeit nicht zu vergleichen? In der sehr kleinen Stadt B. erschlugen allein die Soldaten des türkischen Großwesirs mit ihren Krummsäbeln zweihundertvierundsechzig Menschen. Dreihundert Männer, Frauen und Kinder wurden als Sklaven mitgenommen, unter ihnen sollen der Bürgermeister, der Richter, mehrere Ratsherren gewesen sein. Preußische Dragoner unter Friedrich dem Zweiten, österreichische Kürassiere, Spanier, Franzosen, Napoleon. Rote Husaren während der österreichisch-preußischen Kriege, von den 1866 in B. stationierten sechstausend Soldaten der preußischen Armee sollen die Rheinländer und die Westfalen die humansten, bescheidensten und freundlichsten gewesen sein, vor den Brandenburgern, den Pommern und den Schlesiern dagegen habe man sich, wie berichtet wird, zu hüten gehabt.
(Ein von der Obrigkeit ausgesandter Zeichner ist, wie der Chronist festhält, dem Zorn der Bürger von B. nur mit knapper Not entkommen. Er hatte seine Bitte, die Stadt ABREISSEN zu dürfen, auftragsgemäß vorgebracht und war in seiner Absicht mißverstanden worden. Die dennoch im Jahre 1727 angefertigte Zeichnung dürfte von einem der Hügel aus heimlich und ohne Zustimmung des Stadtrates entstanden sein. Sie stellt die von Mauern und Friedhof umgebene Pfarrkirche mit von einer großen und einer darübergesetzten kleineren Zwiebel gekröntem Turm, die große Zwiebel von vier Türmchen gesäumt, in den weiten, von Bürgerhäusern umrandeten Marktplatz hinein, umgibt den Kranz der Häuser mit Mauern, Türmen und Toren, setzt kleinere Häusergruppen vor die Mauern der Stadt in die Felder, zieht zwei Häuserreihen einen steil ansteigenden Hügel aufwärts, weist mit zierlicher Schrift darauf hin, man habe diese, außerhalb der Mauern gelegene Siedlung DAS BÖHMENDORF genannt.
Der Schluß liegt nahe, daß die Stadt selbst zu jener Zeit ausschließlich von Deutschen bewohnt gewesen ist.)
B., ein Ort, zu dem die Gedanken immer wieder zurückkehren, den sie umkreisen. Früher als in anderen Gegenden erntete man das Getreide, die Obstbäume blühten schon im April, auf den Südhängen reifte die Mandel, die Nachtigall schlug IN TAUSEND AKKORDEN.
Der Zwang, diesen Ort nachzuzeichnen, sein sich im Lauf der Jahrhunderte änderndes Bild anhand der Aufzeichnungen von Chronisten zu verfolgen, sich mit seiner Geschichte vertraut zu machen. Lange Vergangenes mit erlebter Gegenwart, die ebenfalls schon längst Vergangenheit geworden ist, in Verbindung zu bringen, ein Ganzes entstehen zu lassen, ein möglichst vollständiges Bild des Ortes zu malen, den man schon einmal verlassen hat, dem man sich noch einmal nähern will, um sich dann endlich für immer von ihm zu entfernen.
DIESE STADT IST ALT, DENN SIE WAR SCHON IM JAHR 893 EIN HALTBARER ORT, schreibt Franz Joseph Schwoy in seiner 1793 publizierten Topographie vom Markgrafthum Mähren, das VOR DEN HUNGARN FLÜCHTIGE HEER DES MÄHRISCHEN KÖNIGS SWATOPLUK habe sich in ihre Mauern gerettet.
Die Chronik hält die erste urkundliche Erwähnung in einem von König Wenzel I. 1240 gefertigten Schreiben fest, die Erhebung zur Stadt durch Kaiser Maximilian II. 1572, erwähnt in Verbindung mit diesem Ereignis das verliehene Recht, MIT ROTEM WACHS ZU SIEGELN, was anderen Städten gegenüber, denen nur MIT GRÜNEM WACHS ZU SIEGELN erlaubt war, eine Erhöhung des Ansehens bedeutet hat. Sie beschreibt, nach Kriegs- und Notzeiten, nach Pest und Cholera, einen aufblühenden, durch große Jahr- und Wochenmärkte, vor allem durch Viehmärkte weithin berühmten Ort, Umschlagplatz für allerlei in Gewerbe und schließlich sich entwickelnder Industrie gefertigte Waren, nennt als wesentlichsten Fehler, der weiterer günstiger Aufwärtsentwicklung hinderlich gewesen sei, den Beschluß, die 1839 von Wien nach Brünn gelegte Bahnlinie nicht durch die Stadt zu führen. Man habe, heißt es, eine Beeinträchtigung der Fuhrwerksunternehmen gefürchtet, kurzsichtig auf die Chance, einen Bahnhof an der Hauptbahnlinie zu besitzen, verzichtet, ein Schaden, der durch die später gebaute Lokalbahn nicht zu beheben gewesen ist.
Denkbar, daß damals, durch diesen Mangel an Weitblick, das Schicksal von B., zur VERTRÄUMTEN KLEINEN LANDSTADT abzusinken, besiegelt worden ist, denn obwohl es noch Höhepunkte in der Entwicklung gab, Zeiten, die zur Hoffnung berechtigten, obwohl B. zum Beispiel frühzeitig eine Poststation erhielt, vorübergehend Sitz eines Divisionskommandos war, sich sogar zur Bezirksstadt emporschwang, war der Abstieg zur Bedeutungslosigkeit der verschlafenen Kleinstadt nicht aufzuhalten. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im Herbst 1938 und dem darauf folgenden Anschluß an Deutschland wurden alle wichtigen Ämter in eine Stadt verlegt, die einen Bahnhof im Stadtgebiet besaß.
Ich rufe mir schon Gesagtes ins Gedächtnis zurück, hole es herüber in diese von mir weiterzuerzählende Geschichte, erinnere an die Enttäuschung, die Heinrich, damals neunundzwanzigjährig, erfaßte, als er, aus Wien kommend, an einem vor Hitze flirrenden Junimittag des Jahres 1924, den vor dem gelb gestrichenen, einsam zwischen Mais-, Rüben- und Getreidefeldern träumenden Bahnhofsgebäude haltenden Zug verließ, endlich, nach längerem Zögern, den Wunsch, auf den aus Brünn kommenden Gegenzug zu warten und in die Großstadt zurückzukehren, unterdrückte, sein altes, im Gepäckwagen des Zuges mitgebrachtes Fahrrad bestieg, schließlich in B. eintraf. Ich erinnere daran, daß er, der von einem Leben in Wien geträumt hatte, sich unter dem Zwang der Not, dieser Hungerzeit zwischen den Kriegen, entschlossen hatte, die freigewordene Stelle eines Landarztes anzunehmen, daß ihn, als er auf seinem Fahrrad in die Stadt B. einfuhr, beinahe der Mut verließ, ja daß ihn, angesichts der sich dehnenden, vor allem der mit Rüben bewachsenen Felder, der menschenleeren Gassen, des ebenso leeren Marktplatzes mit Dreifaltigkeitssäule, Sparkasse, Pfarrkirche und neugotischem Rathaus, den gegen die Sonne mit Tüchern verhängten Schaufenstern einer Bata-Filiale eine in Worten schwer zu beschreibende Melancholie überkam. Der Ausspruch eines Mannes, der von ihm damals nach dem Weg gefragt worden ist, wurde von ihm später häufig wiederholt: HIER WERDEN SIE ES NICHT AUSHALTEN, HIER IST DAS ENDE DER WELT.
(Die Erinnerung hält jedoch fest, daß Heinrich in der zweiten Hälfte seines Lebens, die mit dem Durchwaten des Grenzbaches im Juni 1945 begann, der kleinen, in die Hügel gedrängten Stadt B. immer mit Zärtlichkeit, ja mit HEIMWEH gedachte.)
Eine große Anzahl von Fotografien, im Lauf der Jahrzehnte gesammelt, von Freunden, Verwandten, Bekannten geschenkt, überlassen, in Kopien zugeschickt, zeigen, nebeneinandergelegt, die kleine Landstadt B. mit allen wichtigen Gassen, Gebäuden, Wegen, Wegkreuzen, Kapellen, mit Pfarrkirche, Rathaus, Dreifaltigkeitssäule, mit dem Trinkwasserbrunnen im unteren Teil des großen, annähernd quadratischen Platzes. Ein steinerner Poseidon hält eine Amphore auf den Schultern, Wasser plätschert in dünnem Strahl in das steingefaßte Becken, Lindenbäume umgeben ein Steinkreuz neben der Kirche, Johannes von Nepomuk steht auf seinem Postament, die Sparkasse leuchtet mit blinkenden Scheiben, hohe Baumkronen umgeben die alte Schule, Brücken überwölben den Bach, zum kleinen Lokalbahnhof führt eine von hohen Akazien und Kastanienbäumen gesäumte Allee.
Zwischen den schönen Bürgerhäusern, auf den weißen Kopfsteinen aus den Pollauer Bergen, läuft das Kind Anni hin und her, es lehnt sich aus einem Fenster, sieht die Kette der Pollauer Berge sich bläulich vom Himmel abzeichnen, das Gipfelkreuz ist deutlich erkennbar, das Kind drängt sich auf dem in eine Budenstadt verwandelten Stadtplatz zwischen feilschenden Hausfrauen und Händlern durch, steht staunend, mit offenem Mund, vor den Buden mit den Puppen, Stofftieren, Trompeten, sieht ein Äffchen an der Leine tanzen, läuft eine lange Straße entlang, die zum Böhmendorf führt, betritt den Hof der Großeltern Josef und Anna durch ein breites hölzernes Tor. Schneeweiße Gänse schnattern, Milchkannen klappern, Pferde wiehern, die Großmutter, zierlich und klein, rührt im blau gekachelten Herd in großen Kasserollen, der Großvater putzt sein Jagdgewehr, hantiert beim Bienenhaus, das Kind sitzt auf seinem Lieblingsplatz unter dem Maulbeerbaum, hält ein Stückchen blaues Glas vor sein rechtes Auge, kneift das linke Auge zu, träumt, was Kinder aus wasserarmen Gegenden manchmal träumen: DAS MEER. Nur wenig von jenen immer stärker werdenden Spannungen, die damals sogar in der stillen kleinen Landstadt B. zwischen den Einwohnern verschiedener Muttersprache bestanden haben, ist dem Kind Anni zu Bewußtsein gekommen.
(Der Chronist berichtet, daß die vorwiegend deutsche Bevölkerung zu Anfang des Jahrhunderts mit einer tschechischen Minderheit so lange in Frieden zusammenlebte, bis EINIGE HITZKÖPFE PROVOZIEREND DAS FRIEDLICHE ZUSAMMENLEBEN STÖRTEN.
Es habe für die wenigen tschechischen Familien einen Volksrat, eine Sparkasse, ein Vereinshaus gegeben. Erst anläßlich der Eröffnung einer tschechischen Schule im Jahre 1909 sei es zu Reibereien gekommen. Die Regierung habe der Minderheit Schutz gewährt, den Ausnahmezustand verhängt und verstärkten Polizeischutz geboten. Fünfunddreißig Gendarmen hätten eine Art Besatzung gebildet. Die Lage habe sich jedoch in den folgenden Jahren IMMER MEHR ANGESPANNT. Im November 1918 sei B. von einer slowakischen Brigade mit zwei Maschinengewehren besetzt worden, die Besetzung habe sich jedoch IN ALLER RUHE vollzogen. Die Bezirkshauptmannschaft, die Post, die Eisenbahnstation und das Rathaus seien besetzt, das Verbot, andere Farben als die tschechischen zu tragen, sei erlassen worden. Zum erstenmal in der Geschichte der Stadt habe es nacheinander zwei tschechische Bürgermeister gegeben. Zahlreiche tschechische Beamte und Lehrer seien in die Stadt gekommen, die Zahl der Tschechen in der Stadt habe ständig zugenommen. Die deutschen Beamten seien ihrer Posten enthoben, durch tschechische Beamte ersetzt worden.
Wirtschaftlich habe sich die Abtrennung von den ehemaligen Absatzgebieten für landwirtschaftliche Produkte, aber auch für im Gewerbe und in der Industrie hergestellte Waren, bemerkbar gemacht. Die Ziegelwerke seien geschlossen worden. Die drei Mühlen hätten mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Die kleinen Handwerksbetriebe hätten sich zwar als Bedarfsträger des dichtbesiedelten bäuerlichen Umlandes schlecht und recht durchbringen können, die Konkurrenz sei jedoch groß und ungesund gewesen. Die für landwirtschaftliche Produkte gezahlten Preise hätten kaum noch das Notwendigste eingebracht. Ganz besonders hätte der Weinbau unter den herrschenden Verhältnissen gelitten, die Zahl der Weingärten habe sich ständig verringert. Allerdings hätten nicht nur die deutschen, sondern auch die tschechischen Bauern unter der herrschenden Not zu leiden gehabt, unter der furchtbaren Arbeitslosigkeit hätten in südmährischen Industriestädten tschechische und deutsche Einwohner in gleichem Maß gelitten.
Wegen der hohen Kosten habe man erst spät mit der Elektrifizierung der Stadt beginnen können, der Bau einer Wasserleitung stellte sich als finanziell untragbar heraus, an eine Kanalisation war nicht zu denken. Einzig das Baugewerbe blühte, Schulen und Häuser für die neuen tschechischen Beamten wurden gebaut. Für das neu errichtete tschechische Gymnasium habe es zu wenige Schüler gegeben, man habe die Schüler von weither holen müssen.
Die nationalen Spannungen hätten SIEDEHITZE erreicht. Die deutschen Truppen im Herbst 1938 seien deshalb mit Jubel empfangen worden.
Sei bis dahin, seit 1918, von tschechischer Seite eine falsche, die Deutschen benachteiligende Politik betrieben worden, habe in der folgenden Zeit Hitlers Politik, die IN JEDEM SLAWEN EINEN MENSCHEN ZWEITER KLASSE gesehen habe, alle Hoffnungen zunichte gemacht.)
Heinrich, der von einem Leben in der Musik- und Theaterstadt Wien geträumt hatte, blieb in B., eröffnete eine Praxis, nahm zwei Jahre später die Bauerntochter Valerie zur Frau. Er versah seinen Dienst als praktischer Arzt mit immer gleichbleibender Geduld, machte bei seinen Patienten keinen Unterschied, was Sprache oder Religion betraf. Über die Geburt der Tochter soll er sich gefreut haben. Söhne, soll er gesagt haben, seien immer und zu allen Zeiten KANONENFUTTER gewesen.
Am 15. April 1945 wurde die kleine, in die südmährischen Hügel gedrängte Stadt B. vom Krieg überrollt.
SEI FROH, DASS DU ES NICHT ERLEBT HAST, sagt die heute alt gewordene Mutter Valerie.
Sei froh, daß du nicht dabeigewesen bist, sagen Schulfreundinnen der Tochter Anni, die es erlebt haben. ES, DAS FURCHTBARE, DAS UNBESCHREIBLICHE, das auch heute, nach dreieinhalb Jahrzehnten, immer noch nicht erzählbar geworden ist.
Diesmal war die Not mit dem Ende des Krieges nicht vorüber, wie dies in früheren Jahrhunderten meist der Fall gewesen war.
Ich möchte den Weg genau kennen, den Heinrich und Valerie, Vater und Mutter, damals am 16. Juni 1945 hinter Wundrascheks klapprigem Wägelchen gegangen sind, bitte die Mutter, ihn mir zu beschreiben, lege die alte Landkarte auf den Tisch. Auf dieser Karte sind nicht nur die Straßen, es sind auch die allerkleinsten Wege, Feldwege, Hohlwege eingezeichnet, auch die Namen der Hügel, die Bäche, die Wegkreuze, die Obstbaumalleen. Es ist eine Karte, wie man sie heute nicht mehr bekommen kann.
Die Mutter hat eine alte Freundin eingeladen, weil sie nicht sicher ist, ob sie sich noch an Einzelheiten erinnert. Zwei Stunden nach Mitternacht sind sie damals aufgebrochen, der Vater und sie, im Hof ihres Elternhauses haben noch jene drei Erwachsenen und die zwei Kinder gewartet, von denen in diesem Zusammenhang schon die Rede gewesen ist, auf Wundrascheks Wagen sind schon Gepäckstücke gelegen, sie haben ihre beiden Rucksäcke und den Koffer dazugelegt.
(Mehr haben wir nicht mehr gehabt, sagt die Mutter, mehr hat uns nicht mehr gehört.)
Sie haben sich von Valeries Eltern, Josef und Anna, und von Hedwig verabschiedet, sie haben ABSCHIED GENOMMEN, es ist ihnen sehr schwer gefallen, denn, sagt die Mutter, sie haben ja nicht gewußt, ob sie einander noch einmal wiedersehen würden.
Dann sind sie losgezogen, auf jener Straße, über die Heinrich zwanzig Jahre vorher auf seinem alten Fahrrad gekommen war.
Ein Stück vor dem Bahnhof sind sie rechts auf die Straße, die nach dem Ort Tracht führt, abgebogen.
Ja, sagt die Freundin, das stimmt, nur so könnt ihr gegangen sein, verfolgt mit dem Finger den Weg auf der Landkarte, nennt weitere Ortsnamen: Unter-Wisternitz, Ober-Wisternitz, Bergen. Nein, sagt die Mutter, wir sind ÜBER DIE FELDER gegangen. IN TRACHT IST EIN POSTEN GEWESEN. (Vor diesem Posten hätten sie Angst gehabt.) Sei seien nicht bei Unter-Wisternitz über die Thaya gegangen, sie könne sich, sagt die Mutter, überhaupt nicht daran erinnern, die Thaya überquert zu haben.
Man muss über die Thaya, sagt die Freundin, ein längerer Wortwechsel folgt. IHR KÖNNT JA NICHT ÜBER DIE THAYA GESPRUNGEN SEIN! (Auf der Landkarte ist deutlich zu sehen, daß man den Fluß überqueren muß, wenn man zur Grenze will.)
DAS NEUE WIRTSHAUS haben wir nicht gesehen.
(Auch der Feldweg, der nach dem Dorf Unter-Tannowitz führt, ist auf der alten Karte eingezeichnet.)
Von dort weg ist Gertrud, die Arzttochter, die mit Anni das Gymnasium besucht hat, mit ihnen gegangen und hat ihnen den Weg zur Grenze gezeigt.
(Ob sie Angst gehabt hat? Nein, sagt Gertrud heute, damals sei so etwas selbstverständlich gewesen. Sie habe diesen Weg sehr gut gekannt, mehrfach Leute zur Grenze gebracht, auch Soldaten, die sich versteckt hatten. Sie habe Heinrich, Valerie und die anderen, so weit es nötig gewesen sei, begleitet, ihnen dann gezeigt, wo sie den Bahndamm zu überqueren hätten, sei dann wieder umgekehrt. HINTER DEM BAHNDAMM IST DER GRENZBACH GEWESEN.)