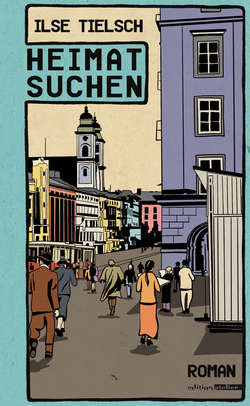Читать книгу Heimatsuchen - Ilse Tielsch - Страница 6
2
ОглавлениеHü! rief Wundraschek, und sein Pferd setzte sich in Bewegung.
Die fünf Erwachsenen und die beiden Kinder standen wie verloren neben den Gepäckstücken und blickten dem Wagen nach, der, eine Staubwolke hinter sich herziehend, langsam davonrumpelte, dann bückten sie sich nach ihren Rucksäcken und Koffern und kletterten über den Bahndamm und die Eisenbahnschienen.
Bis zum Bach waren es nur wenige Schritte. Sie durchwateten ihn, die Rucksäcke auf dem Rücken, einer der Männer, der von Valerie R. genannt worden ist, trug die Kinder und das restliche Gepäck ans andere Ufer, sie fanden eine trockene schattige Stelle zwischen den Weidenbüschen, fielen müde ins Gras, redeten nicht, die Kinder weinten leise vor sich hin.
Valerie war es, die sich schließlich bewegte, die Hand ausstreckte, nach Heinrichs Hand griff, nicht nur, weil sie das Gefühl seiner Nähe brauchte, das Gefühl, nicht allein zu sein mit all diesem Jammer, sondern auch, um ihm dieses Gefühl zu vermitteln. Wir leben, wollte sie ihm auf diese Weise sagen, wir sind davongekommen, wir sind nicht verlassen, solange wir einander haben.
Heinrich wandte ihr sein Gesicht zu, nickte zum Zeichen, daß er sie verstanden habe, und sagte leise: Ich habe heute Geburtstag.
Er war an diesem Tag genau fünfzig Jahre alt geworden.
Der Schmerz war beinahe erstickt gewesen von der Müdigkeit des Körpers, jetzt erwachte er, Valerie fühlte, wie er in ihr hochkroch, sie würgte, sie hatte das Gefühl, erbrechen zu müssen, aber es war ihr nicht möglich, aufzustehen, sich aufzuraffen, von diesem Krampf, der ihr den Hals zuschnürte, zu befreien. Sie ließ Heinrichs Hand los, drückte das Gesicht ins Gras, wartete auf das Nachlassen des Krampfes, auf das Abklingen der durch den wiedererwachten Schmerz hervorgerufenen Übelkeit, wartete auf Tränen, die nicht kamen. So muß sie längere Zeit gelegen sein, beinahe bewußtlos vor Erschöpfung, vielleicht sind es die Stimmen der Kinder gewesen, die sie schließlich zurückholten, vielleicht war es auch nur der Durst, den sie beim Nachlassen der Verkrampfung, des Ekels, zu spüren begann, der sie dazu brachte, sich aufzurichten. Sie griff nach ihrer Handtasche, holte die kleine Sliwowitzflasche hervor, die Wundraschek zur Hälfte leergetrunken hatte (sogar das bißchen Sliwowitz hat er uns weggetrunken), wandte sich an Heinrich und sagte leise: Gib mir den Becher.
Heinrich hatte seit seiner Gymnasialzeit eine Vorliebe für Becher gehabt, die man in der Tasche tragen konnte. Er griff in seine Rocktasche, holte eine kleine, flache Aluminiumschachtel hervor, Valerie öffnete sie, faßte von den darin konzentrisch ineinandergelegten Ringen aus dünnem Aluminium den größten, hob ihn aus der Schachtel, die übrigen, ineinanderpassenden Teile und der in der Mitte liegende kleine Boden formten sich zum Trinkgefäß. Sie ging damit zum Bach, füllte es zu zwei Dritteln mit Wasser, goß etwas von dem Schnaps hinein und trank. Dann füllte sie den Becher wieder, kam damit zu den auf dem Grasplatz Liegenden, reichte ihn der Frau.
Sie tranken alle von dem mit dem Schnaps gemischten Bachwasser, auch die Kinder tranken davon. (Wir sind nicht krank davon geworden, sagt die Mutter, es ist ein sehr starker Schnaps gewesen, er hat das Wasser wahrscheinlich desinfiziert.)
Nachdem sie getrunken hatten, kramten sie hervor, was sie an Eßbarem hatten. Ein Stück Brot, ein Stückchen Speck, dann suchte jeder für sich eine Stelle am Bach, wo er sich, ungesehen von den anderen seiner Kleidung entledigen und waschen konnte.
Dann saßen sie wieder unschlüssig im Gras, konnten sich nicht dazu aufraffen, aufzustehen und weiterzugehen. Während des ganzen, mehr als zwanzig Kilometer langen Fußmarsches hatten sie Angst gehabt. Es war eine Folge dieser Angst gewesen, daß sie, trotzdem sie Papiere mit der amtlichen Bewilligung zum Grenzübertritt in der Tasche trugen, nicht den offiziellen Grenzübergang gewählt, sondern heimlich den Grenzbach und seine sumpfigen Ufer durchwatet hatten. Jetzt, da sie die Landesgrenze im Rücken wußten, hätte es eigentlich keinen Grund mehr zur Furcht gegeben. Trotz dieser Gewißheit jedoch, trotz des befreienden Gefühls, ENDLICH AUF ÖSTERREICHISCHEM GEBIET zu sein, wurden sie diese Angst nicht los, sie hatten sich zu sehr an sie gewöhnt.
Dazu, sagt die Mutter, sei dieses schreckliche Gefühl gekommen, ZUM BETTLER geworden zu sein, von Haus zu Haus gehen, um ein vorübergehendes Obdach, um etwas Nahrung bitten zu müssen. Ihr Ziel sei ja Wien gewesen, dort hätte jeder von ihnen Verwandte, wenigstens Bekannte aus besseren Tagen gehabt.
Aber bis Wien sei es noch weit gewesen.
Schließlich habe sich ein Bauernwagen auf sie zubewegt, ein Bauer aus dem nächstgelegenen Dorf sei unterwegs gewesen, um Klee zu holen. Heinrich hat die Begegnung mit dem Bauern in einem Notizbuch beschrieben: ER ERKLÄRTE SICH DAZU BEREIT, UNS BEI SICH AUFZUNEHMEN, VORSICHT SEI ABER GEBOTEN, DA IM DORF DIE RUSSEN SEIEN. ER WÜRDE JETZT NACH HAUSE FAHREN, DEN KLEE ABLADEN UND NOCHMALS ZURÜCKKOMMEN. DANN SOLLTEN WIR UNSER GEPÄCK AUF DEN WAGEN GEBEN, ER WÜRDE KLEE DARÜBER BREITEN UND ZU SEINEM HOF FAHREN. WIR SOLLTEN IHM IN GRÖSSEREM ABSTAND FOLGEN. SO GESCHAH ES DANN AUCH.
Heinrich, an Wundrascheks Entlohnung denkend, bot dem Bauern das einzige Stück von einigem Wert an, das Valerie gewagt hatte, in ihrer Handtasche mitzunehmen, eine silberne Puderdose. Der Bauer wies die angebotene Gabe zurück, er wollte für seine Hilfe keinen Lohn. (Das werde ich nie vergessen, sagt die Mutter.)
Sie trotteten hinter dem Kleewagen nach, jenen Feldweg entlang, der sich, hellbraun, mit einem Stich ins Graue, zwei Fahrspuren, in der Mitte eine mit Erdstaub bedeckte Rinne, vom Grenzbach weg, zwischen Weizen- und Rübenfeldern, in Richtung des Dorfes Ottenthal im niederösterreichischen Weinviertel hinzog. (Es ist der gleiche Feldweg gewesen, den ich, Anna, auf der im Juni des Jahres 1981 entstandenen Farbfotografie wiederfinde.)
ES SIND GUTE LEUTE GEWESEN, sagt die Mutter.
Die Bäuerin schlug Eier in eine Pfanne, gab ihnen ein Stück Brot dazu. Die Männer durften in der Scheune schlafen, Frauen und Kindern wurden zwei aneinandergeschobene Betten als Nachtlager angewiesen. Ob es ihnen etwas ausmache, daß in dem Bettzeug die Russen geschlafen hätten? Nein, es machte ihnen nichts aus.
Sie blieben mehrere Tage, arbeiteten auf den Feldern, wurden dafür, soweit dies möglich war, mit Nahrung belohnt.
Heinrich operierte eine Frau, die einen Abszeß im Hals hatte, mit seinem Taschenmesser. Der für den Ort zuständige Arzt war vor der heranrückenden Front in den Westen geflüchtet.
Vielleicht hätten sie bleiben können, da der Ort ohne ärztliche Versorgung war, aber sie entschlossen sich weiterzuziehen. Ihr Gepäck ließen sie zurück. Sie gingen nach Mistelbach, übernachteten in einem Zimmer des Krankenhauses, wurden von dem für das Gebiet verantwortlichen ärztlichen Leiter nach Stronsdorf verwiesen.
Auf der Landkarte, die vor mir auf dem Schreibtisch liegt, sind die Entfernungen zwischen den an der Hauptstraße gelegenen Orten angegeben. Auch wenn ich die Möglichkeit von Abkürzungen über Feldwege in Erwägung ziehe, ist für den Weg von Ottenthal nach dem Städtchen Mistelbach eine Entfernung von rund dreißig Kilometern anzunehmen, von dort über Eichenbrunn nach Stronsdorf werden es wieder etwa fünfundzwanzig Kilometer gewesen sein. DAS ALLES ZU FUSS, sagt die Mutter.
Sie gingen hügelauf, hügelab, zwischen Feldern, an kleinen Wäldchen vorbei, an Obstbäumen, die vom Wind alle in die gleiche Richtung gezaust waren.
In Stronsdorf sei DER GANZE PLATZ VOLLER RUSSEN gewesen. Hier bleibe ich nicht, sagte Valerie.
(Der Marktplatz von Stronsdorf, auf dem die vielen russischen Soldaten gelagert haben, ist auf mehreren, im Juni 1981 entstandenen Fotografien zu sehen. Es ist ein großer, kahl wirkender, heute beinahe zur Gänze asphaltierter oder betonierter Platz, von niedrigen Häusern gesäumt, die eine Seite abgeschlossen durch einen Gasthof mit glatt verputzter Fassade, auf der anderen Seite eine Mariensäule, umgeben von Grün. Schwierig, sich vorzustellen, wie dieser heute friedlich wirkende Platz damals ausgesehen hat, nicht schwierig, die Angst nachzuempfinden, die Valerie beim Anblick der vielen russischen Soldaten überkam, ihre entschiedene Weigerung, in das heute noch unveränderte Arzthaus einzuziehen, obwohl ihr das angeboten worden ist.
Auch dieser Arzt war geflüchtet, auch die Bewohner von Stronsdorf waren ohne ärztliche Betreuung geblieben. Zwei alte Frauen, auf dem Weg zur Andacht in die wuchtige Pfarrkirche, zu der mehrere Steinstufen hinaufführen, erinnern sich: Ja, damals sei es furchtbar gewesen. Sie seien mit ihren Kindern alle UNTER DER KIRCHE gewesen. Nein, nicht möglich, das zu vergessen. Aber man habe es ja überstanden. Gott sei Dank.)
Heinrich und Valerie waren von dem ärztlichen Leiter des Mistelbacher Krankenhauses an eine bestimmte Adresse verwiesen worden, hatten das Haus gefunden, an die Tür geklopft, warteten. Endlich wurde die Tür einen Spaltbreit geöffnet, sie wurden nach ihren Wünschen gefragt. Heinrich nannte den Namen des Arztes in Mistelbach. Längeres Zögern, schließlich schob eine Hand die Sicherheitskette zurück, eine alte Frau öffnete die Tür, bat einzutreten, schloß sofort wieder ab, legte die Kette vor. (Man habe erkennen können, daß die Bewohner des Ortes in ständiger Angst gewesen seien.)
Sie wurden in ein Zimmer mit alten Möbeln geführt, mit Tee bewirtet, durften sich ausruhen, ein wenig schlafen, wurden dann an den Bürgermeister verwiesen, dort freundlich aufgenommen, zum Haus des Arztes gebracht. Obwohl das Haus zur Gänze eingerichtet, alles Notwendige vorhanden war, obwohl sie von der Frau des geflüchteten Arztes gebeten wurden, zu bleiben, beharrte Valerie auf ihrer Weigerung.
Hier bleibe sie nicht einen Tag länger, sagte sie.
Zurück nach Mistelbach, sagt die Mutter, sie seien an einer Schlucht vorbeigekommen, seien so erschöpft, so mutlos, traurig gewesen, daß sie nahe daran gewesen seien, in die Schlucht zu springen.
SPRINGEN WIR, soll der Vater gesagt haben. Da habe ihn Valerie an die Tochter Anni erinnert, die vielleicht noch am Leben sei. Daraufhin hätten sie einander an der Hand genommen und seien weitergegangen. Unterwegs habe ein russisches Lastauto angehalten, der Fahrer habe sie bis knapp vor Mistelbach mitgenommen. Das Lastauto habe junge Zwiebeln geladen gehabt, ihr Kleid und ihre Unterwäsche, sagt die Mutter, seien ganz grün von den Zwiebeln gewesen.
In Mistelbach habe man ihnen einen anderen Ort genannt, dessen Arzt ebenfalls geflüchtet war, sie gingen weiter bis dorthin, es waren nur wenige Kilometer, sie seien es schon so gewöhnt gewesen, zu gehen und zu gehen, im Traum, sagt die Mutter, habe sie noch ihre Füße bewegt.
Ich, Anna, suche das Dorf W. südlich von Mistelbach auf der Landkarte, in dem sie schließlich für längere Zeit geblieben sind. Die Frau eines Schusters nahm sie auf, sie lebte mit ihrer Schwiegermutter, Frau O., im gemeinsamen Haushalt, der Schuster war noch nicht wieder heimgekehrt, man hatte keine Nachricht von ihm, sein letzter Feldpostbrief war aus Rußland gekommen.
Man wies ihnen ein Zimmer zu, zwei Betten, ein kleiner Tisch, zwei Stühle, ein Heiligenbild.
Heinrich hatte sechs, mehrere Kilometer voneinander entfernt liegende Dörfer zu betreuen, er hat die Namen in seinem Notizbuch notiert.
Ich stelle mir vor, wie er, mager, mittelgroß und schwächlich, mit ständig schmerzenden Magengeschwüren, bei Tag und Nacht zu seinen Kranken unterwegs gewesen ist. Nicht einmal ein altes Fahrrad hatte er, wie er es damals am Anfang in B. besessen hatte, nur wenige Medikamente, die er aus dem Mistelbacher Krankenhaus bezog, kaum Instrumente. Mit unzureichenden Mitteln kämpfte er ununterbrochen gegen Seuchen, Infektionskrankheiten, Geschlechtskrankheiten an. STÄNDIG WAREN FLÜCHTLINGE, VERTRIEBENE AUF DEN STRASSEN UNTERWEGS!
(Flüchtlinge, Vertriebene überall, an den Straßenrändern kauernd, auf den Feldern liegend, ein Mann, der zu dieser Zeit nach Wien gegangen ist, beschreibt sie, WIE SCHAFE zusammengedrängt, oder WIE KRÄHEN auf abgemähten Getreidefeldern hockend, Hunderte, TAUSENDE Menschen, vor allem Frauen, alte Leute, Kinder, Tausende auch auf dem Überschwemmungsgebiet an der Donau bei Wien, schon im Stadtgebiet. Alte Frauen hätten sich, auf diesen Feldern und Wiesenflächen sitzend, ihre Röcke gegen den Regen über den Kopf gezogen, als wollten sie nichts mehr von all dem sehen, was um sie herum vorging, was sich ereignete. In Wien übernachteten sie in Hausfluren, irgendwo unter freiem Himmel, neunhundert Vertriebene aus der Gegend von Pilsen lagerten, nachdem sie über drei Wochen von Preßburg nach Wien zu Fuß gegangen waren, einen Tag und eine Nacht lang auf dem Wiener Heldenplatz.)
Im leerstehenden Haus des aus W. geflüchteten Arztes hatte man Vertriebene untergebracht, die an Ruhr erkrankt waren.
DU KANNST DIR DAS NICHT VORSTELLEN, sagt die Mutter, wie das ausgesehen hat, wie fürchterlich das gewesen ist. Die Kranken sind in den Zimmern auf dem Fußboden gelegen, der Kot ist über die Treppe heruntergeronnen. Viele sind gestorben. EIN WUNDER, DASS WIR NICHT KRANK GEWORDEN SIND.
An einem einzigen Tag dreißig an Typhus Erkrankte in den umliegenden Dörfern, Heinrich hat es in seinem Notizbuch aufgeschrieben. Er eilte, unterernährt, geschwächt, selbst von Schmerzen geplagt, ununterbrochen auf den Feldwegen zwischen den Dörfern hin und her. Man bezahlte ihn mit einem Löffel Schmalz, mit einem Mittagessen am Familientisch, mit einigen Kartoffeln, einem Ei.
Bilder: Ein russischer Lastwagen hält vor dem Haus des Schusters, der Lastwagen hat geschlachtete Kühe geladen, der Fahrer, ein Russe, steigt aus, klopft an die Haustür. Valerie will nicht öffnen, der Russe gibt nicht nach, klopft immer wieder, will den Doktor sprechen, verlangt ein bestimmtes Medikament.
Schließlich öffnet Valerie, sieht das Fleisch auf dem Lastwagen. Sie habe, sagt die Mutter, EINE IDEE GEHABT. Als der Russe seine Forderung nach dem Medikament wiederholt, zeigt Valerie auf den Wagen, erklärt, sie würde das Medikament geben, wenn sie dafür Fleisch bekäme.
Der Russe verlangt ein Beil, Valerie holt die große Holzhacke der Frau O., der Russe steigt auf den Wagen, hackt die Hälfte einer halben Kuh ab, wirft sie vom Wagen herunter, steigt ab, schleppt das Fleisch an Valerie vorbei in den Hausflur hinein, Valerie bezahlt mit dem gewünschten Medikament.
Sie hat Mut gehabt, immer schon, sie hat es mehrfach bewiesen.
Die alte Frau O. allerdings, sagt die Mutter, die eben, als dieser Handel vollzogen wurde, aus der Kirche kam, aus dem SEGEN, habe ihr Vorwürfe gemacht. MIT EINEM RUSSEN, habe sie gesagt, das Wort RUSSEN dabei betont, sie bringe ja das ganze Dorf in Verruf.
ABER DAS FLEISCH UND DIE SUPPE HABEN IHR GESCHMECKT, sagt die Mutter. Das Beil allerdings habe von dem Zerhacken der Knochen Scharten bekommen.
Ein andermal habe sie einem russischen Soldaten die Hand verbunden, ja, sie habe Angst gehabt, sie sei allein im Haus gewesen. Der Soldat habe sich bedankt, sei nach etwa einer Stunde wiedergekommen, habe ein seidenes, an den Enden zusammengeknotetes Tuch in der Hand getragen, ihr überreicht, das Tuch sei mit Kristallzucker gefüllt gewesen.
Die Russen im Weingebiet, sagt die Mutter, ein Kapitel, das noch niemand geschrieben hat, das von jemandem geschrieben werden muß, der es selbst erlebt hat, der dabeigewesen ist. Die Wahrheit wird in den Geschichtsbüchern zu nüchternen Zahlen schrumpfen, NIEMAND WIRD SICH DIE WAHRHEIT, WIE SIE GEWESEN IST, VORSTELLEN KÖNNEN.
Hin und wieder kann man davon erzählen hören, von den Einheimischen, die sich daran erinnern. Wie die Soldaten zum Beispiel in die Weinkeller eingedrungen sind, in die Fässer geschossen haben, dann bis zu den Knöcheln im Wein gestanden sind. Wie sie, berauscht von diesem Wein, alles, was Röcke getragen hat, aus Häusern, Kellern, Verstecken gezerrt haben. Wie sie nachts an die Haustore geschlagen, nach Frauen gerufen haben, wie die Frauen aus den Betten gesprungen, über die Höfe geschlichen, durch Zaunlücken geschlüpft sind, wie sie tagelang hinter Dachbalken gehockt sind, vor die man altes Gerümpel geschoben hatte, oder in leeren Selchkammern oder in Heuhaufen, manche sind von ihren Angehörigen sogar in Misthaufen vergraben worden, wie sie nicht zu atmen gewagt haben, wenn sie fremde Stimmen hörten, wenn sich etwas in ihrer Nähe bewegt hat. Wie nachts, heimlich, jemand von den Verwandten gekommen ist, Essen und Getränk gebracht, den Kübel ausgeleert hat. Das erzählen die Frauen manchmal, in kurzen, abgerissenen Sätzen, sie wollen nicht daran erinnert werden, nicht daran, wie sie zu den Ärzten und in die Spitäler gegangen sind, weil sie sich gefürchtet haben, angesteckt zu sein, was auch viele gewesen sind, wie sie ungewünschte Kinder abgetrieben haben, vor denen sie sich ekelten, die sie nicht zur Welt bringen wollten, wie sie NICHT MEHR WEITERLEBEN wollten, dann doch weitergelebt haben.
Wenn sie erzählen, schildern sie ihre Verstecke, berichten, was ihnen selbst widerfahren ist, in der dritten Person, versichern meist ungefragt, sie selbst seien von all dem nicht betroffen gewesen, ihnen sei nichts geschehen.
Uhren hätten sie gesammelt, die Russen, GANZ WILD seien sie auf Uhren gewesen. Manche hätten den ganzen Arm voller Uhren gehabt, vom Handgelenk bis zum Ellenbogen hinauf.
Zum Beispiel seien Russen einmal in ein Spital eingedrungen, hätten den Leuten die Uhren weggenommen, der letzte, ein ganz junger Bursche, der keine Uhr mehr erbeutet hatte, habe vor Zorn und Enttäuschung geweint. (Uhrenwitze werden erzählt: Wie ein Russe mit einem Wecker zu einem Uhrmacher kommt, ihn bittet, aus dem Wecker zwei kleinere Uhren zu machen.)
Und die Fahrräder, ja, wenn ein Russe jemanden mit einem Fahrrad auf der Straße gesehen habe, dann habe er es ihm sofort weggenommen. Obwohl sie angeblich meist gar nicht radfahren konnten. Defekte Räder hätten sie einfach weggeworfen. Überall an den Straßenrändern seien kaputte Fahrräder gelegen.
Man kann aber auch anderes hören, zum Beispiel, wie Russen plötzlich in einer Küche standen, der zitternden Hausfrau Hühner überreichten, sie aufforderten, Suppe zu kochen. Wie sie dann, wenn die Suppe fertig war, die Hausbewohner zum Mitessen aufforderten, die Hausfrau MAMA oder Mamitschka nannten, Kinder streichelten, von ihren eigenen Frauen, Müttern, Kindern erzählten, jedenfalls zu erzählen versuchten. Wie sie, wenn man ihnen einen kleinen Dienst erwies, etwa einen im Straßenkot festgefahrenen Wagen anschob, bereitwillig in die Hosentasche griffen, in Zeitungspapier gewickelten Tabak hervorholten, davon an die Männer verteilten. Wie sie ihre Lastwagen anhielten, wenn Fußgänger auf der Straße winkten, diese Fußgänger auf ihre Wagen aufsteigen ließen, dafür keinerlei Lohn verlangten, während die österreichischen Chauffeure meist Lebensmittel, Brot, Speck oder hohe Geldbeträge forderten. (Beschwerden dieser Art sind in Lokalblättern nachzulesen. So beklagt sich zum Beispiel ein Leser in einer Waldviertler Zeitung darüber, daß er IN DIESER ZEIT DER ZUGSBESCHRÄNKUNGEN gezwungen gewesen sei, auf der Landstraße Autos anzuhalten, um zu einer dringenden Konferenz nach Wien zu kommen. In St. Pölten sei ein russischer Posten gestanden, mit dem Auftrag, DEN VERKEHR DAHIN ZU REGELN, DASS AUTOS, DIE WENIGER BELADEN SIND, PASSAGIERE MITNEHMEN MÜSSEN.
Die Autofahrer, die sich auf diese Weise um den schon üblichen Fuhrlohn geprellt sahen, debattierten lange mit diesem Posten, dieser ließ sich jedoch nicht überreden, auch in seinem Fall, schreibt der Mann, sei es so gewesen, der Posten habe den Chauffeur eines Wagens gezwungen, ihn und noch andere Wartende auf seinen Lastwagen aufsteigen zu lassen. KURZ WAR ABER DIE FREUDE, DENN DER MANN SCHÜTTELTE UNS ALLE BEI KAPELLN AUF OFFENER LANDSTRASSE WIEDER AB. Er sei mit den anderen auf der Landstraße gestanden, auch Kinder seien dabeigewesen, ein Russenauto habe sie schließlich mitgenommen.)
Der Dechant von Poysdorf erzählt, wie in einer stürmischen Nacht im Spätfrühling 1945 an das Tor des Pfarrhauses geschlagen worden sei, wie er erschrokken gelaufen sei, um zu öffnen. (Poysdorf, der an der Grenze gelegene Weinort, sei mit Flüchtlingen überfüllt gewesen. Keine Kammer, kein Winkel, keine Scheune, die nicht mit Flüchtlingen VOLLGESTOPFT gewesen wären.) Draußen sei ein Russe gestanden, eine greise Frau auf dem Rücken. Etwa eine Stunde später sei er noch einmal gekommen, habe eine zweite alte Frau gebracht. Keuchend unter der Last sei er vor dem Tor des Pfarrhauses gestanden, habe nur abgewinkt, als man ihm danken wollte.
ER WAR EIN EINFACHER MANN, schreibt der Pfarrer, ER VERSTAND NICHT, DASS MAN IHM FÜR DIE HILFE DANKEN WOLLTE.
MAN MUSS IMMER DEN EINZELNEN MENSCHEN SEHEN, sagt die Mutter, immer und überall kommt es auf den einzelnen Menschen an.
Ein Eßlöffel Schmalz, ein paar Deka Mehl, ein seidenes Trachtentuch, das mit Zucker gefüllt war, einige Kartoffeln, die Heinrich heimbrachte. Wenn Valerie, nach langem Anstellen, jene Lebensmittel, die in den Zeitungen aufgerufen worden waren, ihre fünf Deka Kaffee-Ersatz, ihr Viertelkilo Brot, ihr winziges Stückchen Butter oder Fett in der Tasche hatte, wenn diese Butter nicht durch KERNFETT ersetzt worden war, dann bedeutete dies einen Anlaß zur Freude. Neunhundert Kalorien pro Tag und Normalverbraucher, das war zum Leben zuwenig, zum Sterben in manchen Fällen nicht zuviel. Kinder und alte Leute fielen auf den Straßen vor Schwäche um, eine ungewöhnlich starke Fliegenplage trug zur Verbreitung der Seuchen bei, in den Spitälern gab es zu wenige Betten, auch die als Notspitäler eingerichteten Baracken und Schulen reichten nicht aus, es gab zu wenige Krankenwagen, einige standen ohne Reifen in Schuppen, die Reifen waren gestohlen worden, neue Reifen waren nicht aufzutreiben. Am 22. August wurde die UNRRA-Hilfe für Österreich beschlossen. Untertänig und herzlich bedankte sich die österreichische Regierung. Schon in normalen Friedenszeiten, schrieben die Zeitungen, sei Österreich außerstande gewesen, sich selbst zu ernähren, geschweige denn nach den Zerstörungen und Verwüstungen des Krieges.
(Fast ein Jahr später, am 23. Juni 1946, würde sich der Bürgermeister der Stadt Wien trotzdem mit dem Hilferuf WIR KÖNNEN NICHT WEITER! an die UNRRA wenden müssen.)
Die Erinnerung hat festgehalten, daß in der kleinen Stadt B., die von Heinrich wiederholt EINE VERTRÄUMTE KLEINE LANDSTADT genannt worden ist, das trotz der vorgeschriebenen Ablieferung in großen Mengen vorhandene Obst, Kirschen, Marillen, Pfirsiche, an Besucher aus der nahen Stadt Wien verschenkt, in vielen Fällen jedoch auch verkauft worden ist. Was den Verkauf von Gänsen angeht, die es, vor allem in den umliegenden Dörfern, immer noch gab, hat die Erinnerung sogar Zahlen anzubieten: hundert bis hundertfünfzig Reichsmark für eine Gans, es kann auch mehr gewesen sein.
Jetzt galten andere Preise.
Ein paar Eier und ein halber Sack Kartoffeln für ein Klavier, sagt Bernhard, in einem burgenländischen Dorf, er sei selbst dabeigewesen, als der Handel vollzogen wurde. Ein STINGL-FLÜGEL, sagt er, und in der Familie des Bauern, der ihn eingehandelt hatte, hätte kein Familienmitglied jemals vorher die Tasten eines Klaviers AUCH NUR VON WEITEM gesehen.
Pelzmäntel für einen Sack Kartoffeln, glücklich, wer Stoffe, Pullover, Strickwesten anzubieten hatte, wem die Bomben während der allerletzten Kriegsmonate nicht noch die Kristallschüssel, die Teekanne aus Meißen, das kostbare Speiseservice zertrümmert hatten. Glücklich, wer noch besaß, was von einigem Wert war, Kleider, Schuhe, Seidenstrümpfe, den Sonntagsanzug des gefallenen Bruders, Ehemannes, die goldene Taschenuhr des Vaters, die eigene Firmungsuhr.
Strafandrohungen, Aufrufe an die Bevölkerung, sich diszipliniert zu verhalten, der Beschluß, Schieber und Schwarzhändler mit astronomischen Geldstrafen, sogar mit Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren zu ahnden, ihre Namen öffentlich in den Zeitungen zu nennen, anzuprangern, Straßenkontrollen. Gegen den furchtbaren, Gesundheit und Leben bedrohenden Hunger nützte dies alles nichts.
Bernhard erzählt Geschichten: Wie sie immer wieder ins Burgenland gefahren sind, der Vater und er, wie sie alles eintauschten, was tauschbar gewesen sei. Einmal sei auch seine Tante Gusti mitgefahren, sie hätten alles mitgenommen, was daheim an entbehrlichen Wollsachen zu finden gewesen sei, sie hätten dafür einen Korb Marillen, Kartoffeln, sogar zwei Gänse eingehandelt. Wie die Tante Gusti auf der Rückfahrt (hundert Kilometer hin, noch einmal hundert zurück!) vor Müdigkeit beinahe vom Fahrrad gefallen sei, wie sie, knapp vor der Stadtgrenze, von einer Polizeistreife angehalten worden seien, wie man ihnen alles wieder weggenommen habe. Die Tante habe nicht aufhören können, vor Zorn und Enttäuschung zu weinen.
Was man für Feuersteine alles bekommen hat.
Wie kostbar eine einzige Rasierklinge gewesen ist.
Und Salz habe es auch keines gegeben.
DER GOLDENE WESTEN, sagten die Leute, wenn sie von den amerikanisch besetzten Bundesländern, vor allem von Oberösterreich, sprachen. Dort gab es zum Beispiel Salz genug, lange Verhandlungen mit den Besatzungsmächten waren nötig, um die Bewilligung zu erhalten, in gewissen Abständen einen SALZZUG nach Wien bringen zu dürfen. Immer wieder wurden die Bauern ermahnt, die landwirtschaftlichen Produkte ordnungsgemäß abzuliefern.
JEDER LITER MILCH MUSS IN DIE MOLKEREI.
Selbst die Kaiserin Maria Theresia wurde zitiert: IN DER PFLICHTERFÜLLUNG LIEGT DAS GLÜCK!
SCHÖNE STARKE EICHEN SIND GEGEN SCHWEINDL EINZUTAUSCHEN, las Valerie in der Lokalzeitung, einem dünnen Blättchen, das in der Hauptsache aus Tauschanzeigen bestand, sie hoffte, unter den eingeschobenen Suchmeldungen den Namen eines ihrer vermißten Angehörigen zu entdecken. GEBE EHEBETTEN FÜR GUTE HERRENSTOFFHOSE, TAUSCHE SPRUNGEBER GEGEN STEIRERWAGERL.
Man bot Wein für Kleeheu, Kinderwagen für Hobelbänke, eine Melkkuh für ein Ackerpferd, das den Pflug über die verwüsteten Felder ziehen konnte. Die Gemeinde Pullendorf suchte ihre während der Kriegshandlungen abhanden gekommene Feuerspritze.
Valerie hatte nichts, was eintauschbar gewesen wäre, in zwei Rucksäcken und einem Koffer hat nichts Überflüssiges Platz, sie besaß keine Schweine oder Ackerpferde, sie brauchte kein Eichenholz. Aber wäre es nicht möglich gewesen, daß jemand, der über den Aufenthaltsort ihrer Tochter, ihres verschollenen Schwagers Richard, über den Fluchtweg anderer naher Verwandter, Bekannter, Freunde Bescheid geben konnte, auf dem Weg über den Annoncenteil einer Zeitung nach ihr und Heinrich suchte? In solchen Zeiten klammert man sich an Strohhalme, sagt die Mutter.
Zur Pflichterfüllung im Sinne Maria Theresias mußte Heinrich nicht ermahnt werden, er tat in jenen Monaten mehr, als seine Pflicht gewesen wäre. Ob das den Leuten, die er betreute, wenn sie ihn brauchten, aufgefallen ist?
Eines Tages gab es für die Bewohner von W. Sonderrationen an Zucker, irgendwo war ein Lagerraum entdeckt worden, man brach ihn auf, der Zucker wurde verteilt. Als Valerie sich auch etwas davon holen wollte, schickte man sie mit der Bemerkung weg, für Flüchtlinge gäbe es nichts. Valerie kam weinend nach Hause.
Ein andermal, als in einer Nachbargemeinde Kirtag gefeiert wurde, lud ein Patient den Doktor und seine Frau zum Essen ein, bewirtete sie und blies zum Dank für sie auf seiner Trompete. Heinrich schrieb in sein Notizbuch: DER HAUSHERR GAB FÜR UNS EIN TROMPETENKONZERT! Auch damals hat Valerie geweint.
Schwere Zeiten für alle, die es nicht verstanden, Kapital aus der Not zu schlagen. Sehr schwere Zeiten für Heinrich und Valerie.
IRGENDWIE HABEN WIR UNS DURCHGEBRACHT.
Ihr größter Kummer sei es gewesen, daß sie nicht wußten, ob ihr einziges Kind, die Tochter Anni, am Leben geblieben sei.