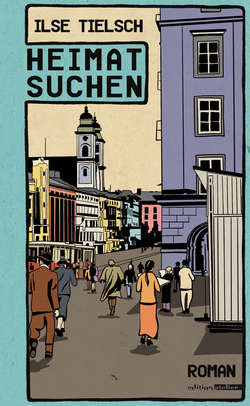Читать книгу Heimatsuchen - Ilse Tielsch - Страница 8
4
ОглавлениеMAN DARF NICHT DARÜBER NACHDENKEN, sagt Valeries jüngere Schwester Hedwig. Lange bevor die Front B. überrollte, war ein Fluchtwagen bereitgestanden, Heinrich hatte Eisenstangen halbrund biegen lassen, man hatte diese Eisenstangen auf beiden Seiten des Wagens befestigt, mit PLACHEN überspannt, auf diese Weise eine Art Dach gebildet, das vor Wind und Regen schützen würde. Unter diesem Dach sollte die alte Großmutter mit den Kindern sitzen, Hedwig und ihr Vater würden abwechselnd auf dem Kutschbock sitzen oder neben den Pferden hergehen, der Wagen sollte die Familie in den Westen bringen. Im letzten Augenblick hatte sich Josef, der Großvater, geweigert wegzufahren.
ICH VERLASSE MEINE HEIMAT NICHT, sagte er.
Sie waren geblieben, Hedwig hatte Anfang April noch Zwillinge geboren, einer der Säuglinge war während der letzten Kriegstage gestorben, sie hatten ihn in dem an den Hof angrenzenden Obstgarten begraben müssen, ein Begräbnis auf dem Friedhof war nicht mehr möglich gewesen. Die beiden größeren Kinder waren fünf und sieben Jahre alt.
Sie blieben auch dann noch, als Heinrich und Valerie die Stadt verließen, so lange, bis eine tschechische Familie mit neun Kindern aus dem Inneren Böhmens kam, um Haus und Hof zu übernehmen. (GOLDGRÄBER HAT MAN DIESE LEUTE GENANNT!)
Die Leute, sagt Hedwig, seien allerdings erschrocken gewesen, die Besitzer des Hofes noch vorzufinden, man hatte ihnen gesagt, sie würden ein von seinen Bewohnern verlassenes Anwesen übernehmen. Die Frau habe sogar gefürchtet, es würde ihr UNGLÜCK BRINGEN, in diesem Haus zu leben. Trotzdem sind sie natürlich geblieben, sagt Hedwig. Da endlich sah Josef, der Bauer, ein, daß ein Bleiben nicht mehr möglich war. Er war zu diesem Zeitpunkt zweiundsiebzig, seine Frau Anna war siebenundsechzig Jahre alt, sie hatten fast ein halbes Jahrhundert auf diesem Hof gelebt, ihn durch ihre Arbeit und ihren Fleiß schuldenfrei gemacht, für Politik war in ihrem Leben kein Platz gewesen. Danach aber fragte jetzt niemand, es wurde nur nach ihrer Sprache gefragt.
WAS GESCHIEHT JETZT MIT UNS, sagte Josef zu dem Mann, der mit den Fremden gekommen war, um sie in das Haus einzuweisen, WOHIN SOLLEN WIR DENN GEHEN?
Ganz einfach, sagte der Mann, Sie gehen nach Bayern. DORT GEHÖREN SIE HIN.
Wiederum war es Wundraschek, der mit seinem mageren Roß und dem klapprigen Wägelchen kam, um diese Deutschen zur Grenze zu bringen, der eigene Fluchtwagen mußte Zurückbleiben, er wurde auf dem Hof zur Arbeit gebraucht und durfte nicht mitgenommen werden.
Diesmal wurde auch nicht mit einem Sonntagsanzug oder mit einer goldenen Uhr bezahlt, Josef hatte vier Doppelzentner Kleesamen auf einem Schüttboden, die Russen hatten diesen Schüttboden nicht aufgebrochen, Josef gab Wundraschek die Schlüssel mit der Bemerkung, wenn er von der Fahrt zur Grenze zurückkäme, solle er sich den Kleesamen holen.
DER WUNDRASCHEK HAT SICH ABER GLEICH, NOCH VOR DEM WEGFAHREN, DEN KLEESAMEN GEHOLT.
Sie packten einiges von dem, was sie unterwegs brauchen würden, auf den Wagen. Hatten sie die Hoffnung gehabt, wieder zurückkehren zu dürfen? Sie hätten zum Beispiel, sagt Hedwig, schöne neue Federpolster gehabt, die neuen Hausbewohner hätten ihnen auch erlaubt, diese mitzunehmen, aber ihre Mutter habe darauf bestanden, nur die alten, schon recht schäbigen Polster und Tuchenten einzupacken. (Sie hat sich dabei ähnlich verhalten wie Heinrich, der, als er wegging, seinen neuen Filzhut an den Haken zurückhängte und mit seinem alten, schon schäbigen Hut auf dem Kopf weggegangen ist.) Was sie noch mitgenommen hätten? Heidi, damals sieben Jahre alt, erinnert sich an ihre kleine Puppennähmaschine, die sie zu Weihnachten bekommen hatte und die ihr sehr lieb gewesen ist. Josef seien die Federbetten wichtig gewesen. Hedwig nahm vor allem mit, was für die Kinder unterwegs nötig sein würde, Anna brachte eine kleine Schmalztonne, sie hatte über das Schmalz gekochte Bohnen gegeben, das Schmalz auf diese Weise unter den Bohnen versteckt. (Auch einen Topf und eine große Kasserolle, EIN KASTROLL, sagt Hedwig heute noch, wie man damals in B. gesagt hat, hätten sie auf die gleiche Weise mit Schmalz und darübergegossenen Bohnen gefüllt.) Wäsche hatten sie nicht mehr viel, die hätten schon die Russen aus den Schränken genommen.
Der Wagen (es sei ja nur ein kleines STEIRERWAGERL gewesen) war mit den Federn, den Töpfen, dem bißchen Kleidung und mit den Kindern ohnedies schon fast überladen.
Hedwig zog Valeries Mantel mit dem Innenfell an, ihre Schwester hatte ihn bei ihr zurückgelassen und sie gebeten, ihn, wenn sie über die Grenze gingen, mitzubringen. In die eine Manteltasche steckte sie, was ihr heute merkwürdig erscheint, einen Wecker, in die andere das bißchen Schmuck, das ihr geblieben war. Dann gingen sie, wie schon viele vor ihnen gegangen waren, wie noch viele nach ihnen gehen sollten, die Straße entlang, von ihrem Hof weg, in die Richtung, in welcher der Bahnhof lag, passierten jedoch nicht heimlich den Grenzbach, wie Heinrich und Valerie es getan hatten, sondern gingen auf den offiziellen Grenzübergang in der Nähe der Stadt Nikolsburg zu. Es war Nacht gewesen, als sie weggingen, früh, als es schon hell war, kamen sie bei diesem Grenzübergang an.
Eigentlich, sagt Hedwig heute, haben sie uns nicht durchsucht, sie haben mir nur in die Manteltasche gegriffen und den Wecker herausgenommen, den Schmuck habe ich vorher in den Kleiderausschnitt gesteckt. Dann haben sie gefragt, was wir mit den vielen Bohnen wollen. Wir würden unterwegs nichts zu essen haben, sagte ich, deshalb hätten wir diese Bohnen mitgenommen. (Das Schmalz hätten sie nicht finden dürfen, sagt Hedwig, das hätten sie uns sicher weggenommen.) Dann, sagt Heidi, sei die Geschichte mit der Puppennähmaschine passiert.
Einer der Posten sei auf sie, die Siebenjährige, zugekommen und habe ihr die kleine Puppennähmaschine, die sie so gern gehabt habe, weggenommen.
Das werde ich nie vergessen, sagt Heidi. Ich sehe den Mann noch auf einer Treppe stehen, er ist mir dadurch noch schrecklicher vorgekommen, als er ohnehin gewesen ist, mit meiner kleinen Nähmaschine in der Hand.
Kleesamen war in jenen Tagen beinahe noch kostbarer, als es goldene Armbanduhren und Sonntagsanzüge gewesen sind. Wundraschek brachte die Familie bis auf die andere Seite der Grenze, wo die österreichischen Posten standen, half ihnen beim Abladen ihrer Bündel, warf ihr Gepäck ins Gras neben der Straße, wendete und entfernte sich auf dem gleichen Wege, auf dem sie gekommen waren. Die Kinder blieben mit Josef und Anna, den Großeltern, bei dem Gepäck zurück, Anna hockte auf einem der Bündel, eine in ihrer Traurigkeit, in ihrer Verlassenheit noch kleiner, noch zerbrechlicher wirkende Gestalt, hielt den Säugling im Arm und sah ihrer Tochter nach, die auf der Straße davonging, um eine Unterkunft für die Nacht zu suchen.
Als Hedwig an den ersten Häusern des nächstgelegenen Dorfes vorbeiging (nein, es sei nicht Ottenthal gewesen, wo Heinrich und Valerie die ersten Tage und Nächte verbrachten, das Dorf habe anders geheißen), kam ihr ein Mann entgegen.
Der Mann sei dick gewesen, der Typ eines Schiebers, sagt Hedwig, MAN HAT GLEICH GESEHEN, WAS DAS FÜR EINER GEWESEN IST. Die goldene Armbanduhr, die sie noch gehabt und ihm angeboten habe, als Lohn dafür, daß er vielleicht bereit sein würde, die Eltern und Kinder mit ihrem Gepäck mit einem Wagen abzuholen, ins Dorf zu bringen, untersuchte er gründlich, schüttelte sie, hielt sie ans Ohr. GEHT SIE? soll er gefragt haben.
Ja, sagte Hedwig bitter, sie geht.
Erst nachdem sich der Mann davon überzeugt hatte, daß die Uhr tatsächlich in Ordnung war, erklärte er sich dazu bereit, seinen Wagen zu holen.
Sie klopften an die Tür eines Hauses, in dem eine Familie lebte, die sie von früher her gut kannten, und baten um Aufnahme für eine einzige Nacht, wurden jedoch abgewiesen. Schließlich erlaubte ihnen ein Bauer, in seiner Scheune zu übernachten. Es war Herbst, und die Nächte waren schon kalt, durch die Fugen zwischen den Scheunenbrettern pfiff der Wind, Hedwig drückte das Kleine an sich, aber sie konnte es nicht gut genug vor der Zugluft schützen. Vor allem nachts, als sie selbst eingeschlafen war, wird das nicht der Fall gewesen sein.
Dort in der Scheune, sagt Hedwig heute, hat sich das Kind erkältet, dort hat es sich den Tod geholt.
(Auch dieses Kind, ein kleiner Junge, ist wenige Tage später gestorben, es wurde auf dem Friedhof des Dorfes W. begraben.)
Wer ihr gesagt habe, daß ihre Schwester und deren Mann sich in W. aufgehalten hätten?
Ich weiß es nicht mehr, sagt Hedwig. Sie haben jemandem, der auf dem Weg zur Grenze gewesen ist oder in die Nähe der Grenze gehen wollte, eine Nachricht für uns mitgegeben, dieser Mann oder diese Frau hat es jemand anderem gesagt, der hat es wieder weitergesagt, bis sich dann schließlich jemand gefunden hat, der nach B. gegangen ist, über die Grenze hinüber, der uns dann mitgeteilt hat, sie seien in diesem kleinen Ort in der Nähe von Mistelbach untergekommen und würden versuchen, für uns eine Unterkunft zu finden, wenn auch wir herüberkämen.
Das sind ja oft fast WUNDER gewesen, wie sich die Menschen wiedergefunden haben.
Man ist auf der Straße gegangen, auf einmal hat man jemanden getroffen, von dem man schon lange nichts mehr gewußt hat oder den man gesucht hat.
Man hat an jemanden gedacht, der verschwunden gewesen ist, plötzlich hat man aus dem Fenster eines Hauses geschaut, da ist er auf der Straße vorbeigegangen.
Das ist wahrscheinlich so gewesen, weil damals ALLE unterwegs gewesen sind, weil alle ohne dauernde Unterkunft waren, weil jeder irgendwelche Angehörige oder Freunde gesucht und vermißt hat.
Es war, sagt Hedwig, eine furchtbare Zeit, aber es haben sich gerade in dieser Zeit wirkliche Wunder ereignet. Manches jedenfalls hat man sich nicht anders erklären können. Ich weiß nicht, wer uns die Nachricht damals gebracht hat, sagt Hedwig heute, aber wir haben es jedenfalls gewußt, und der Mann, dem ich die Armbanduhr gegeben habe, hat uns am nächsten Tag noch mit seinem Wagen nach W. gebracht.
(Heinrichs Notizbuch: EINES TAGES STANDEN HEDWIG UND DIE SCHWIEGERELTERN MIT DEN KINDERN VOR UNSERER TÜR.)
Es gelang, sie im mittlerweile leerstehenden Arzthaus unterzubringen, jenem Haus, in welchem während des Sommers die an Ruhr erkrankten Flüchtlinge einquartiert waren.
Aus einem Fenster dieses Hauses blickend, habe sie, sagte Hedwig, eine ihr bekannte Familie aus B. mit ihren sieben Kindern vorbeiziehen sehen. Der Mann und die Frau hätten einen Handwagen gezogen, auf dem Handwagen seien die kleinsten der Kinder gesessen, die größeren hätten angeschoben. So seien diese armen Leute den ganzen Weg von zu Hause weg über die Grenze zu Fuß gegangen.
Sie, Hedwig, habe sie ins Haus geholt, sie seien aber nur über Nacht geblieben, am nächsten Tag wieder weitergezogen.
Niemand hat damals ein Ziel gehabt, sagt Hedwig, aber alle haben gedacht, weitergehen zu müssen, immer weiter, selbst im Elend, aber an allem anderen Elend vorbei, mit der Sehnsucht, irgendwo anzukommen, eine Unterkunft für längere Zeit zu finden, wenigstens vorübergehend, auf irgendeine Weise wieder zu Hause zu sein.
Und beinahe alle hätten die Hoffnung gehabt, daß sie nach nicht allzu langer Zeit wieder dorthin zurückkehren würden, woher sie gekommen waren.
NIEMAND HAT SICH VORSTELLEN KÖNNEN, DASS DIESES WEGGEHEN AUS DER HEIMAT EIN WEGGEHEN FÜR IMMER GEWESEN SEI.
Diesmal ist es Hedwigs Film, der abläuft, kleine Teilstücke eines Films, Erinnerungssplitter, die dazwischen fehlenden Teile sind nicht ergänzbar, Heidi ist damals zu klein gewesen, sie erinnert sich nur ungenau, ihr sind nur wenige Bilder und Eindrücke geblieben.
Sie hätten viel Hunger gehabt, ja, und dann hätte sie einmal das kleine Brüderchen, das im Bett des Großvaters lag, streicheln wollen, aber der Großvater habe ihre Hand zurückgezogen und gesagt, das Brüderchen könne sie nicht mehr streicheln, es sei schon tot.
An ihre erste Kommunion erinnert sie sich, die anderen Kinder seien alle Einheimische gewesen, sie die einzige, von der man wußte, daß daheim nichts, wirklich gar nichts zu diesem Fest an Besonderem auf den Tisch kommen konnte, da hätten die Mütter beschlossen, eine gemeinsame Tafel für alle Kinder in einem Gasthaus zu machen, so sei auch sie zu ihrem Stück Kuchen gekommen. Das hat sie nicht vergessen, sie ist dankbar dafür gewesen, ist es heute noch, sie wäre es damals auch gewesen, wenn ihre Mutter ihr nicht immer wieder gesagt hätte, sie seien jetzt so arm, daß niemand sie haben wolle, sie müßten für jede Freundlichkeit besonders dankbar sein.
Hedwigs Film zeigt den Umzug in das kleine Häuschen, das unbewohnt in einem der Nachbarorte stand. Die Tür hing schief in den Angeln, aber die Mauern waren trokken, es hatte ein Dach, einen Bretterboden.
Der Pfarrer, ein GROSSARTIGER MANN, sagt Hedwig, ein Mensch, der tatkräftige Hilfe geleistet hat, wo er nur konnte, besorgte Feldbetten, sie hatten eine Unterkunft für die nächste Zeit.
Dann der Besuch von Richards Schwester, die durch einen Brief Heinrichs über ihre Ankunft in W. informiert worden war und sich sofort auf den Weg machte, die Schwägerin aufzusuchen.
Sie sei, schreibt Richards Schwester in ihrem Tagebuch, zu Fuß mit einem Rucksack über Stammersdorf, Eibesbrunn, Wolkersdorf gegangen, am ersten Tag bis Gaweinstal, also etwa fünfunddreißig Kilometer weit. Unterwegs sei sie von Russenautos überholt worden, die Kartoffeln, Zucker, Mehl, aber auch Fahrräder und Einrichtungsgegenstände geladen hatten. Viele Menschen seien mit Rucksäcken, Handwagen, Kinderwagen unterwegs aus der Stadt zu den Bauern gewesen.
(Von Wolkersdorf bis Gaweinstal ging ich mit einem Wiener Arbeiter und seinem zehnjährigen Buben. Er geht alle vierzehn Tage, Samstag, Sonntag, Montag, hinaus und zurück, damit seine vier Kinder Erdäpfel haben.)
Die Felder zu beiden Seiten der Straße seien ausgedörrt und verwahrlost gewesen, von Bomben zerwühlt, überall seien verrostete Geschützteile und zertrümmerte Autos herumgelegen.
(Schützengräben entlang der Straße durch die Felder, die Obstbäume an den Straßenrändern mit abgebrochenen Ästen, umgefahren oder zerschossen. Von den Feldern in Straßennähe wird kein Bauer ernten. Die Russen lassen dort das Vieh weiden.)
Der Wirt in Gaweinstal habe sie nicht beherbergen wollen, er habe ihr nicht einmal erlaubt, auf einer Bank im Gastzimmer zu schlafen, er habe Russen im Haus gehabt und sich gefürchtet, eine Frau aufzunehmen, seine eigene Frau und seine Schwester, habe er ihr gesagt, müßten abends das Haus verlassen und sich verstecken.
Eine fremde Frau habe sie dann bei sich aufgenommen, ihr ein Nachtquartier gegeben.
(Als ich mich mit Dank verabschiedete, winkte sie nur ab und forderte mich auf, wiederzukommen. Ausgeruht wanderte ich bis Schrick, zusammen mit einem alten Mann, unterwegs begegnete mir ein Trupp vertriebener Landsleute aus Muschau, denen man an der Grenze alles, sogar die Kopfpolster und Tuchenten für die Kinder, weggenommen hat. In einem Handpäckchen und auf einem Schubkarren war ihr ganzer Besitz. Ich weinte mit ihnen.)
Bei Schrick sei ihr ein Treck begegnet, oder vielleicht der Rest eines Trecks, dreißig oder vierzig mit Schilf gedeckte Plachenwagen, es seien Siebenbürger Sachsen gewesen. (Ich sprach mit ihnen, sie waren elend, abgezehrt, viele traurig bis zum Stumpfsinn. Sie sagten, sie seien daheim freie Bauern gewesen, nun würden sie hier als Knechte arbeiten müssen. Sie seien schon lange unterwegs, zuletzt sind sie in Oberösterreich gewesen.)
An diesem zweiten Tag, schreibt Richards Schwester, sei sie von Gaweinstal etwa vierzehn Kilometer weit nach W. gegangen, habe dort Valerie daheim angetroffen, diese habe sie dann nach K. zu Hedwig und den Eltern begleitet. (Das erste Wiedersehen nach schwerer, banger Zeit war für uns alle voll Schmerz und doch voll Freude, da wir bis auf die beiden Kleinen leben und gesund sind.)
Hedwig sei sehr traurig gewesen, die beiden Kinder scheu, die alten Eltern gefaßt.
Ja, es seien gute, hilfsbereite Menschen im Dorf, vor allem der Pfarrer, der den anderen ein Beispiel gebe.
(In anderen Orten sieht man die Flüchtlinge nicht gerne, es sind zu viele für das ausgeraubte Land.)
Hedwigs Gedächtnis hat diesen ersten, unerwarteten Besuch ihrer Schwägerin als große Freude registriert.
Dann der Festtag, an dem es DAS GULASCH gegeben hat. Die Frau, die für Hedwig ein Stück Fleisch von einem Pferd schneidet, ihr das große Stück Pferdefleisch überreicht.
Josef, der Großvater, ging auf die Felder hinaus, in der Hoffnung, irgendwo ein paar von einem Wagen heruntergefallene Zwiebeln zu finden, er kam an ein Lauchfeld, begann, Lauch abzuschneiden, fand bei diesem Gang über das Feld einen schon halb verwesten toten Soldaten neben seinem ebenfalls schon verwesenden Pferd. (Damals, sagt Hedwig, sind überall die toten Soldaten und die toten Pferde gelegen, NICHTS WAR EINGEGRABEN.)
Josef erschrak, wendete sich ab, kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an, zwang sich dazu, in anderer Richtung weiterzugehen, trotzdem noch etwas von dem Lauch abzuschneiden, brachte den Lauch nach Hause, erzählte nichts von seinem grausigen Fund, ging erst später ins Dorf, um die Stelle anzugeben, an der er den Toten und sein verendetes Pferd gefunden hatte. Irgendwann, später, hat man den Mann und das Tier dann begraben.
Aus dem Lauch und dem Fleisch kochte Hedwig das Gulasch, an das sie sich, weil es ein so besonderes, seltenes Festmahl gewesen ist, heute noch erinnert.
Sie seien alle um den Tisch gesessen, hätten gegessen. Es habe ihr so geschmeckt, daß sie vor Übermut mit den Füßen gescharrt und das Wiehern eines Pferdes nachgeahmt hätte. Ihr Vater habe sie zornig angeschaut, dann nur noch in den Teller geblickt. Die Mutter sei aufgestanden, hinausgegangen, habe sich vor Ekel übergeben müssen. Daheim auf dem Hof waren die Pferde nicht nur Helfer bei der Feldarbeit, nicht nur Zugtiere für Wagen, Schlitten, Kutschen gewesen, man hatte sie wie Freunde, wie nahestehende Menschen geliebt. Nie hätte man sich vorstellen können, von ihrem Fleisch zu essen. Jetzt war es anders, die Not und der Hunger waren zu groß, aber selbst jetzt konnte Annas Magen dieses Fleisch nicht behalten.
Nie mehr hat sie Pferdefleisch gegessen, außer dann, wenn es gelang, sie zu täuschen, ein Gericht, das aus Pferdefleisch gekocht war, so zuzubereiten, daß sie nicht am Geschmack erkannte, was sie da aß. Sie hätten, sagt Hedwig, einmal von einer Tante aus Wien zwei Dosen mit HORSE-FLEISCH bekommen, es hätte ihnen herrlich geschmeckt, aber die Mutter habe keinen Bissen davon angenommen.
Bilder, die man aneinanderreiht, die man aus der Vergangenheit heraufholt, die es möglich machen, einen Teil dieser Vergangenheit zu beschwören.
Hedwig, mit ihren beiden Kindern, den alten Eltern, dem Kindergrab auf dem Dorffriedhof, keine Nachricht von Richard, ihrem seit dem Winter in Rußland verschollenen Mann, mußte Arbeit finden, um bleiben zu dürfen, um nicht wieder weiterziehen zu müssen. Der Winter stand vor der Tür, es hieß, es würde ein strenger Winter werden, ihre Kinder brauchten ein Dach, das sie vor der Kälte schützen würde, sie brauchten die beiden winzigen Kammern, in denen sie nun hausten, auch wenn sie noch so elend waren, sie brauchten den eisernen Ofen, den man ihnen geschenkt hatte, um nicht zu erfrieren oder krank zu werden. Vor allem aber brauchten sie Lebensmittelkarten, wenn auch selten alles, was gegen Vorweis dieser Karten hätte zu bekommen sein müssen, wirklich zu bekommen war.
Wer im Besitz von Lebensmittelkarten war, bekam beinahe nichts, wer keine hatte, bekam überhaupt nichts, das war zwar kein sehr großer, aber doch ein wesentlicher Unterschied. Lebensmittelkarten bekam nur, wer im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung war, eine Aufenthaltsbewilligung erteilte man nur demjenigen, der Arbeit hatte. Es war ein Kreis, der sich in vielen Fällen nicht schließen ließ. In Hedwigs Fall, der kompliziert genug gewesen ist, hat er sich schließlich geschlossen, und daß dies geschah, verdankte sie jenen Soldaten der Roten Armee, die in den turbulenten Tagen rund um das Ende des Krieges nicht nur in Wohnhäusern und privaten Räumen Schranktüren eintraten, Schubladen aus Kommoden rissen, ihren Inhalt, soweit sie ihn nicht brauchen konnten, auf den Dorfstraßen verstreuten, sondern die dies auch in Fabriken, Bürohäusern und Werkstätten taten. In einem Bohrbetrieb jedenfalls, der drei Kilometer entfernt von Hedwigs neuem Wohnort lag, waren es unzählige Schrauben gewesen, HUNDERTTAUSENDE SCHRAUBEN, sagt Hedwig, die durcheinandergekommen und die nun wieder der Größe und Stärke nach zu sortieren waren, und man hatte ihr und noch einigen anderen Frauen erlaubt, diese Arbeit als bezahlte Hilfskräfte, dadurch zum Bezug von Lebensmittelkarten berechtigte Personen, zu verrichten.
Hedwig sortierte also Schrauben, bis in den Winter hinein, sie legte täglich zweimal den Weg von drei Kilometern zu Fuß zurück. (Wenn ich abends nach Hause kam, sagt sie, habe ich überall Schrauben gesehen, am Himmel, an den Häuserwänden, an der Zimmerdecke, wenn ich im Bett gelegen bin, sogar nachts habe ich von Schrauben geträumt.)
Josef und Anna hatten, solange auf den Feldern gearbeitet worden war, mitgeholfen, dafür immer wieder einige Kartoffeln, manchmal etwas Mehl oder sogar ein Stückchen Fleisch bekommen, Josef hatte in den umliegenden Wäldchen Klaubholz gesammelt, so daß ein kleiner Vorrat für den Winter zusammengekommen war. Verhungern, erfrieren würde man nicht.
Hedwig sah sich, nachdem alle Schrauben sortiert waren, nach einer neuen Beschäftigung um, hatte wiederum Glück, im Bohrbetrieb suchte man eine Köchin für die Werkskantine.
Was es bedeutet habe, für neunzig Männer zu kochen, wenn nichts zu kochen da war als zum Beispiel Wasser und Roggenmehl. Oder das Fleisch einer alten Kuh. Oder ein Haufen Knochen, die schon gestunken hätten. Oder ein Berg Krautköpfe, halb verfault.
Einmal habe sie so GENUG VON ALLEM gehabt, daß sie kündigen wollte. Aber die Männer hätten sie nicht gehen lassen, sie hätten keine andere Köchin gewollt.
Damals schien es, als würden sie bleiben, bis zu jenem Zeitpunkt jedenfalls, zu dem man ihnen erlauben würde, IN DIE HEIMAT zurückzukehren. Daß dies eines Tages der Fall sein würde, davon waren alle, vor allem die Eltern, fest überzeugt.
Wie sollten die da drüben jenseits der Grenze denn auf die Dauer ohne die Deutschen zurechtkommen, wer würde die Felder bebauen, die ihnen gehört hatten, wie würde man denn jene Dörfer besiedeln, in denen nur Deutsche gelebt hatten? Nein, eines Tages würde sich alles ändern, man würde zurückkehren, wieder miteinander leben, miteinander auskommen, sich wieder vertragen. Der amerikanische Präsident Truman hatte in einer Rede gesagt, man gehe EINER NEUEN UND BESSEREN WELT DES FRIEDENS UND DES INTERNATIONALEN GUTEN WILLENS ENTGEGEN.
Nur gut, daß man es, wenn zur Rückkehr aufgerufen würde, nicht so weit haben würde, NACH HAUSE. Gut, daß man in der Nähe der Grenze geblieben war.
Man lebte von einem Tag auf den anderen, man wartete auf ein Lebenszeichen derer, die verschollen waren. Richard zum Beispiel hatte im Sommer 1944 zum letztenmal Urlaub gehabt, war dann zu seiner Einheit zurückgekehrt, seither war kein Lebenszeichen von ihm gekommen. Er war VERMISST gemeldet, aber was hieß das schon. Er konnte in Gefangenschaft geraten, irgendwohin gebracht worden sein, wo eine Möglichkeit, sich zu melden, für ihn nicht bestand. Er konnte geflüchtet sein, desertiert, irgendwo untergetaucht, ein Versteck gefunden haben, die abenteuerlichsten Geschichten wurden erzählt. Er konnte verwundet worden sein, in einem Lazarett oder Krankenhaus, das von jeder Nachrichtenübermittlung abgeschlossen. abgeschnitten war, seiner Genesung entgegensehen. Es gab viele Möglichkeiten, die man sich ausmalte, vorstellte, einzureden versuchte. IN SOLCHEN ZEITEN KLAMMERT MAN SICH AN STROHHALME, sagt die Mutter. WENN RICHARD KOMMT, sagte Hedwig, und sie meinte damit: Dann würde es besser werden, dann würden sich die Verhältnisse normalisieren, dann würde jemand dasein, der in schwierigen Situationen Rat wußte, der sich zu helfen wußte, der ihnen allen helfen würde, dann würde das einen neuen Anfang bedeuten.
Um die Rückführung der Kriegsgefangenen zu beschleunigen oder zu ermöglichen, wurden Suchdienste eingerichtet. Hedwig schrieb ein Ansuchen, eine Suchmeldung nach der anderen. Richards Namen, sein Geburtsdatum, seinen Geburtsort, seinen militärischen Dienstgrad, seine letzte Anschrift und Feldpostnummer, das Datum des letzten Briefes, ihren eigenen Namen, ihren jetzigen Aufenthaltsort.
Sie schrieb an die Suchdienste der neu gegründeten Rundfunkanstalten, an das Rote Kreuz, sie bezahlte Einschaltungen in den Zeitungen: WER KANN AUSKUNFT GEBEN ÜBER MEINEN MANN, RICHARD S. …
Sie ging sogar mehrere Male nach Wien, immerhin eine Strecke von etwa vierzig Kilometern, um bei Suchstellen nachzufragen, bei dieser Gelegenheit Verwandte und Freunde aufzusuchen. Auf Briefe allein konnte und wollte sie sich nicht verlassen. Während das britische Postministerium erwog, Düsenflugzeuge zur Postbeförderung über den Atlantik einzusetzen, die bei einer Stundengeschwindigkeit von 740 Kilometern zwei Tonnen Postsendungen über eine Strekke von dreitausend Kilometern transportieren würden (diese Post würde New York in sechs, Kalkutta in zwölf, Johannesburg in vierzehn, Australien in vierundzwanzig Stunden erreichen), brauchte ein Brief von Mistelbach nach Wien im besten Falle zwei Wochen. Wenn so ein Brief dann auch tatsächlich ankam, trug er den runden Stempel der Zensurstelle. Man durfte nicht alles schreiben, was man gerne geschrieben hätte, man durfte nicht alles berichten, was man gerne berichtet hätte, man durfte nicht alles fragen, was man gerne gefragt hätte.
Vor allem teilte Hedwig allen Bekannten, Verwandten, allen, die Richard gekannt hatte und die ihn gekannt hatten, die Anschrift ihres neuen Aufenthaltsortes mit. WENN RICHARD KAM, mußte er, gleichgültig an wen er sich um Auskunft wandte, erfahren, wo seine Familie zu finden sei.
Richard kam nicht, aber andere kamen, standen plötzlich vor Haustüren, umarmten Frauen, die ihnen fremd geworden waren, küßten Kinder, die sie noch nie gesehen hatten. Die Kinder drückten sich verlegen in Zimmerecken, hielten sich ängstlich an den Röcken der Mütter fest. Die fremden Väter waren nach Hause gekommen, aber sie waren noch lange nicht zu Hause. Sie gingen wie verloren herum, nannten, wenn man sie fragte, manchmal einen Namen, ja, den oder jenen hätten sie noch vor Monaten irgendwo lebend gesehen, dann aus den Augen verloren, einer der noch Vermißten hatte ihnen aufgetragen, seinen Angehörigen mitzuteilen, in welchem Lager er sich befinde, daß er gesund sei, oder sie hatten diese Nachricht über Dritte zu übermitteln. Manchmal waren sie Todesboten, überbrachten Botschaften, die zu überbringen sie lieber unterlassen hätten, aber nicht unterlassen durften. Manchmal tauchte einer von ihnen kurz in einem Dorf auf, das er auf seiner Heimkehr zu durchwandern hatte, suchte nach einer bestimmten Familie, fand sie nicht gleich und ging weiter, weil es ihn dorthin zog, wo er zu Hause war. Dann konnte man Tage später in den Zeitungen lesen: JENER HEIMKEHRER, DER AM 12. OKTOBER DURCH X.; GEGANGEN IST UND NACH DER FAMILIE Y. GEFRAGT HAT, WIRD DRINGEND GEBETEN, SICH ZU MELDEN.
In den geplünderten, ausgeraubten Häusern fanden die Heimgekehrten in den wenigsten Fällen noch eines jener Kleidungsstücke vor, die sie getragen hatten, ehe man sie zu Soldaten machte. Ihre Frauen trugen dann die Uniformfetzen, die sie Jahre hindurch in Erdlöchern, Schützengräben, Unterständen, Tag und Nacht am Leib gehabt hatten, diese von Schweiß, von Nässe und Schmutz, manchmal auch von Blut verklebten, immer wieder mühsam gesäuberten Lumpen, von denen sie sich so gerne für immer getrennt hätten, in eine Färberei. Bestimmte Färbereibetriebe hatten sich ausschließlich auf das Umfärben von Soldatenuniformen spezialisiert, das Tragen von Kleidungsstücken, die als Uniformteile deutscher Soldaten erkennbar waren, hatten die Besatzungsmächte verboten.
Es kam auch vor, daß einer dieser unerwartet Heimgekommenen wieder fortging, wie jener Schneidermeister, dem ein Fremder die Tür öffnete, als er nach Hause kam. Nicht, daß der Schneider Angst vor Fremden gehabt hätte, aber dieser Fremde war nicht mehr fremd, er gehörte offensichtlich zum Haus und zu der in diesem Haus wohnenden Frau. Der Schneidermeister aus dem Dorf X., der bei minus vierzig Grad in russischen Winternächten, später auf dem Rückzug, später in einem Gefangenenlager, Gras und Blätter fressend wie ein Tier, um nicht zu verhungern, um HEIMKEHREN zu können, immer nur an dieses kleine Haus und an die in diesem Haus lebende Frau gedacht hatte, immer nur an diesen winzigen, auf keiner Landkarte auffindbaren Ort, der diese wenigen Quadratmeter ummauerten Raums gemeint hatte, wenn er das Wort HEIMAT aussprach oder dachte, dessen ganzes Denken auf diesen einen, einzigen Punkt fixiert gewesen war, sah sich um alles betrogen, was er für wiedersehenswert gehalten hatte. Er versuchte erst gar nicht, wenigstens einen Teil davon zurückzubekommen, was sein gutes Recht gewesen wäre, er war während der letzten Monate an Rückzug gewöhnt worden und setzte nun diesen Rückzug widerspruchslos fort.
Er ging nicht weit, nur bis zum nächsten Wäldchen, dort legte er seinen Tornister ins Gras, knüpfte einen Riemen an den Ast einer Akazie und erhängte sich.