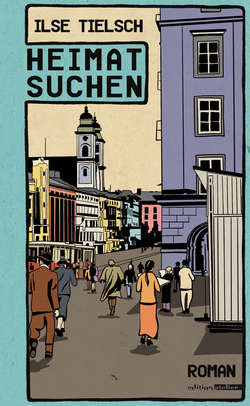Читать книгу Heimatsuchen - Ilse Tielsch - Страница 7
3
ОглавлениеEs scheint notwendig, die Spur der knapp vor dem Ende des Krieges eben sechzehn Jahre alt gewordenen Anni zu verfolgen, die in B. bleiben, in einem Keller über die erste, turbulente Zeit des zu erwartenden Fronteinbruchs, des erhofften und zugleich gefürchteten Kriegsendes versteckt werden sollte, mit dieser Entscheidung ihrer Eltern einverstanden war, die dann aber doch, im April, in einen der allerletzten, mit Menschen vollgestopften, mit Menschen behangenen, nach Westen fahrenden Züge gepreßt, ins Ungewisse, das Rettung, aber auch Tod bedeuten konnte, davongefahren ist.
Christian, der Freund, zwei Jahre älter als Anni und schon Soldat, hatte darauf bestanden, daß man sie wegschickte. Die Erinnerung hat Bilder aus diesen Tagen bewahrt, sie stellt Christian wieder an die Tür, die in Heinrichs und Valeries Wohnzimmer führt, läßt aus dem Radioapparat Wehrmachtsberichte und Sondermeldungen tönen, läßt Christian aufgeregt auf Heinrich und Valerie einreden, die ihn ratlos anstarren. Sie läßt die blassen Lichtkreise zweier vorschriftsmäßig abgedunkelter Fahrradlampen sich auf dem Granitsteinpflaster der Straße berühren, überschneiden, wieder voneinander entfernen. Christian und Anni sind auf ihren Fahrrädern zum mehrere Kilometer weit außerhalb der Stadt entfernten Bahnhof unterwegs. Dieses Bild der beiden blassen Lichtkreise auf dem Straßenpflaster hat das Gedächtnis festgehalten, während es den eigentlichen Zweck dieser Fahrt nicht mehr preisgibt. Sicher ist, daß sie im Zusammenhang mit Annis nun beschlossener und bevorstehender Abreise unternommen worden ist.
Einzeln, wie Szenenausschnitte aus einem Theaterstück, lassen sich diese Bilder beschwören, wie übriggebliebene Teile eines zerrissenen Films, was dazwischen geschah, ist verlorengegangen.
Anni und Christian sitzen im Zug, sie fahren aus der Kreisstadt zurück nach B. oder vielmehr zum Hauptbahnhof von B., wo sie ihre Fahrräder wieder vorfinden und auf ihnen in die Stadt zurückkehren werden. Wahrscheinlich hat Anni bei einem der zuständigen Ämter gegen Vorweis einer von Heinrich besorgten Dringlichkeitsbescheinigung eine Fahrkarte, jedenfalls die Bewilligung, eine solche zu erwerben, abgeholt, Christian hat sie auf diesem Weg begleitet. Man weiß nicht, ob später gemeinsame Wege noch möglich sein werden, ob man einander lebend wiedersehen wird. (Immer noch rollten DIE RÄDER FÜR DEN SIEG, an den niemand mehr glaubte. Reisebewilligungen wurden nur gegen den Nachweis äußerster Dringlichkeit ausgegeben.)
Der Zug ist vorschriftsmäßig abgedunkelt, das Abteil ist voll besetzt, aber stockfinster. Am Himmel steht kein Mond, schwarze Papierrouleaus sind vor die Fenster gezogen.
Ein Volksgenosse tappt im Dunkeln nach Annis Knie, Anni schlägt mit der Faust auf die tappende Hand, der Schlag ist deutlich zu hören, der Mann gibt einen knurrenden Laut von sich. Anni berichtet Christian empört, was geschehen ist, jemand kichert schadenfroh, die anderen schweigen.
DIESES SCHWEIN, sagt Christian laut.
Bilder: Anni, am Abend vor der Abreise, packt Koffer und Rucksack, steckt rasch noch einen kleinen Teddybären ein, läßt die von der Mutter vorbereiteten Schulzeugnisse liegen, ordnet Bücher auf einem Regal, als würde das Zimmer ausgespart bleiben aus allem, was sich in den nächsten Tagen ereignen wird. Sie nimmt eine kleine Umhängetasche aus Trachtenstoff aus einer Lade, sucht Fotoalben hervor, reißt Fotos von den Seiten ab, steckt die Fotos in die Umhängetasche, sitzt dann noch spät mit den Eltern beim Radio, hört noch einmal das Lied LILI MARLEEN.
Der Abschied von den Freunden am nächsten Tag, Abschied von Christian, rascher Abschied von den Eltern am Bahnhof, es ist nicht die Zeit für langes Abschiednehmen, man ist bemüht, keine Gefühle zu zeigen, obwohl oder gerade deshalb, weil man weiß, was diese Abschiede bedeuten können. Es ist möglich, daß man mit dem Leben davonkommt, es kann aber auch sein, daß man einander niemals mehr wiedersehen wird. Die Tränen kommen später, als Anni, zwischen andere, Fremde gepfercht, auf der Toilette eines Eisenbahnwaggons steht. Ihren Koffer hat sie an die Wand der Toilette geschoben, den Rucksack hat sie zwischen den Beinen, die Umhängetasche hängt über ihrer Schulter. Auf der Klosettmuschel sitzt, auf einem über die Muschel gelegten Koffer, eine junge blonde Frau mit einem Säugling im Arm.
So steht Anni viele Stunden lang. Wie lange diese Fahrt, oder ihr erster Teil, gedauert hat, ist nicht mehr rekonstruierbar, der Film ist nur noch in winzigen Teilen vorhanden, Tage und Nächte fließen ineinander, nur Augenblicke sind geblieben, die sich aus dem Dunkel der vergangenen Jahre heraufholen lassen.
Soldaten sind im Waggon, junge Männer, die noch am Leben sind, es vielleicht nicht mehr lange sein werden. Irgendwann muß die Toilette geräumt, zur Benützung freigegeben werden, als dann die junge Frau mit dem Säugling wieder auf dem über die Muschel gelegten Koffer sitzt, wird Anni von einem der Soldaten aus der Toilette gezogen, auf einen Sitzplatz gedrückt. Koffer und Rucksack sind in der Toilette geblieben, die Umhängetasche hängt an einem Haken neben dem Fenster, es ist kalt im Waggon, der Soldat schlägt die eine Hälfte seines Uniformmantels um Anni, die andere um seine eigenen Schultern. Anni sitzt mit dem Soldaten unter einem Zelt aus grobem Uniformstoff, sie sitzt eng an den Soldaten gepreßt, sie spürt Wärme, sie ist todmüde, es ist ihr gleichgültig, wer das ist, der sie an sich drückt, seinen Körper an ihren preßt, wer das ist, der ihr Wärme gibt, weil er selbst Wärme nötig hat, sie ist fast bewußtlos vor Müdigkeit, fällt in traumlosen Schlaf, aus dem sie emporschreckt, als der Zug auf offener Strecke hält, alles aus dem Waggon drängt, über Gepäckstücke stolpert, aus den Fenstern springt, sich in Buschwerk flüchtet, in Gräben oder an die flache Erde drückt.
Anni liegt auf einem Acker, Hände und Gesicht auf die klebrige Erde gedrückt, Flugzeuge dröhnen über sie hinweg, Schüsse peitschen, Geschosse schlagen ein. Der Soldat, neben dem sie Minuten vorher gesessen ist, kommt nicht zurück in den Waggon, sein Militärmantel liegt zusammengeknüllt auf dem Sitzplatz, der jedoch nicht leerbleibt, sofort wieder besetzt wird. Die Lücke hat sich geschlossen, der fehlende Mann wird nicht vermißt, oder sein Fehlen wird schweigend zur Kenntnis genommen. Annis Umhängetasche hängt noch am Haken, wird ihr jedoch irgendwann während dieser Fahrt gestohlen werden.
Das nächste Bild, zu dem es keine Überleitung gibt, setzt Anni und die Frau mit dem Säugling auf je einen Küchenstuhl, am Herd dieser Küche steht eine Frau, hantiert mit Kochgerät, wärmt Milch für den Säugling auf, kein Satz, kein von der Frau gesprochenes Wort ist im Gedächtnis haftengeblieben, erst später wird Anni wissen, daß die Frau Tschechin gewesen ist. Die junge Mutter mit dem Säugling ist von einem SS-Mann begleitet worden, der SS-Mann steht, an das Fensterbrett gelehnt, spielt wie zufällig mit seiner Pistole, blickt dabei ununterbrochen nach der Frau beim Küchenherd hin.
Erinnerungssplitter: Der SS-Mann ist sehr jung, die Frau am Herd ist alt gewesen, die Szene hat sich in Budweis abgespielt. Wie Anni in diese Küche, wie sie von dort wieder zum Bahnhof gekommen ist, wann der Zug von diesem Bahnhof wieder abgefahren ist, kann heute niemand mehr sagen, es gibt keine noch lebenden Zeugen dafür, zu denen ich, Anna, Verbindung hätte.
Der Zug, von Budweis nach Süden fahrend, behängt, beladen mit Menschen, immer mehr Menschen haben sich an den Trittbrettern festgebunden, sitzen auf den Puffern zwischen den Waggons, liegen auf den Dächern, klammern sich am Rand dieser Dächer feststehen, sitzen, hocken aneinandergedrängt im Inneren der Wagen, halten sich an Gepäckstücken, aber auch aneinander an. Niemand steigt unterwegs aus, immer noch versuchen weitere Menschen mit Bündeln, Rucksäcken, Koffern, in diesen hoffnungslos überfüllten Zug hineinzukommen. Mütter heben ihre Kleinkinder zu den Fenstern hoch, niemand ist in der Lage, ihnen zu helfen. Irgendwann sind die Soldaten nicht mehr im Zug, es sind die einzigen Fahrgäste, die unterwegs verschwunden, irgendwo ausgestiegen, verlorengegangen sind. In Linz an der Donau ist dann die Fahrt zu Ende, der Zug spuckt die Menschenmassen mit ihren Bündeln und Koffern aus.
Ein Zettel ist erhalten geblieben, ein vielfach gefaltetes, schon vergilbtes Stückchen Papier, das die Sechzehnjährige in einem um den Hals gebundenen Beutel auf dieser Fahrt bei sich getragen hat. Auf diesen Zettel hat Heinrich eine größere Anzahl von Namen und Adressen geschrieben, Leute, die er irgendwann näher kennengelernt hat, mit denen er im Briefwechsel gestanden ist, Verwandte, Freunde, Gastwirte, bei denen er mit Valerie während der spärlichen Urlaubswochen gewohnt hat. Daß diese Anschriften über niederösterreichische Kleinstädte, die Orte Furthof und Hohenberg, von Leoben bis Bad Goisern, von Passau bis Wien reichten, daß sogar eine Pariser Adresse darunter war, beweist, wie unmöglich die Berechnung von Annis Reiseroute gewesen ist. Irgendwo würde sie ankommen, irgendwo würde sie hoffentlich bleiben dürfen, würde man die Tochter aufnehmen, eine Zeitlang behalten, so hofften Heinrich und Valerie. Sie hätten, wäre das Kind eines Freundes oder Bekannten in ähnlicher Situation zu ihnen gekommen, das gleiche getan.
In einem Ausschnitt des Erinnerungsfilms sitzt Anni auf ihrem Rucksack auf dem Bahnhof in Linz an der Donau, der noch nicht durch jenen allerletzten, schwersten Bombenangriff des Zweiten Weltkriegs auf diese Stadt zerstört worden ist. Sie studiert den vom Vater mitgegebenen Zettel, findet den nächstgelegenen möglichen Zufluchtsort auf der Strecke Linz-Liezen, beschließt, sich versuchsweise dorthin zu wenden.
Sie besteigt wieder einen überfüllten Zug, erreicht den auf der Liste des Vaters rot unterstrichenen Ort, verläßt den Zug mangels anderer Gelegenheit durch das Fenster, ihr Gepäck wird ihr, ebenfalls auf diesem Wege, nachgereicht. Ihre Entscheidung ist eine gute Entscheidung gewesen. Die Adresse bezeichnet einen einsam gelegenen Vierkanthof, die Bäuerin, Witwe nach einem Verwandten der Mutter Valerie, nimmt Anni bei sich auf.
Erinnerungsreste, aneinandergereiht, ergeben ein Filmstück, das, rasch ablaufend, das Wesentliche aus dem Leben von Heinrichs und Valeries Tochter während der folgenden Monate erkennen läßt.
Anni, auf der Flucht vor amerikanischen Besatzungssoldaten, die das Kriegsende feiern, bei der Arbeit auf den Hof umgebenden Wiesen, Heu wendend, Ochsen treibend, Milchkannen schleppend, am ganzen Körper, vor allem an den Händen und Füßen, von ständig eiternden Wunden bedeckt, deren Narben lange sichtbar bleiben werden. Anni, papierdünne Scheiben vom schmalen Segment eines Brotlaibs schneidend, das sie wöchentlich zugeteilt bekommt, mehlige, bitter schmeckende Mostbirnen sind zusätzliche Nahrung gewesen.
Dann kommt eine Stelle, an welcher der Film angehalten werden muß, oder an welcher er von selbst anhält, weil das Gedächtnis den Schrecken festgehalten hat, der mit dem aufgezeichneten Augenblick verbunden gewesen ist. Ein Mann nähert sich dem Hof, betritt das Wohnhaus, sitzt in der Wohnstube neben dem Kachelofen auf einer mit gestickten Polstern belegten Bank, sagt, er habe B. BRENNEN sehen, er sei dabeigewesen, wie Annis Vater, Heinrich, GEFALLEN sei. Auch ihre Mutter sei nicht mehr am Leben. Kaum jemandem von der Bevölkerung könne die Flucht aus der brennenden Stadt gelungen sein. Er selbst sei wie durch ein Wunder davongekommen, von den in der Stadt Gebliebenen habe vermutlich niemand überlebt. (Später wird sich niemand finden, der sagen kann, wer dieser Mann gewesen ist. Ein Sadist, ein Irrsinniger, einer, der geträumt hat, was er nun als Realität weitergab, einer, der von anderen gehört hatte, was diese von anderen gehört hatten, der dieses vielleicht von Mund zu Mund immer schrecklicher Weitererzählte, in immer grelleren Farben Gemalte nun als sein eigenes Erlebnis wiedergab? Einer, der beauftragt worden war, Heinrichs Tochter zu ängstigen, ein Gespenst? Wie und wann und vor allem von wem hat der Mann von Annis Aufenthalt auf dem einsam gelegenen oberösterreichischen Bauernhof erfahren, wenn Anni selbst erst auf dem Bahnhof in Linz an der Donau auf die Idee gekommen ist, dort um Unterkunft zu bitten? Züge verkehrten kaum, Post wurde nicht befördert, Zeitungen waren seit dem Ende des Krieges noch nicht gedruckt worden, Botschaften wurden weitergesagt, gingen von Mund zu Mund, bis sie, in besonders günstigen Fällen, endlich ihre Adresse erreichten. Eine Möglichkeit, zu überprüfen, was der Mann erzählt hatte, gab es nicht. Man hatte die Wahl: zu glauben oder nicht zu glauben. Aber welche Veranlassung hätte Anni gehabt, zu bezweifeln, daß sich tatsächlich ereignet hat, was ihr erzählt worden ist?)
Die Stube mit dem Tisch, den Stühlen, der Eckbank aus Lärchenholz, mit dem bemalten Bauernschrank neben der Kammertür, mit Heiligenbild, hölzernem Herrgott am hölzernen Kreuz, mit den auf einer holzgerahmten Fotografie pyramidenförmig übereinandergeschichteten Mitgliedern eines Turnvereins, die kleinen, durch Gitter gesicherten, nach außen sich verjüngenden Fensteröffnungen, der Sonnenfleck auf der weiß gekalkten Wand, die gestickten Sprüche auf den Polstern, der grünweiß geflammte Milchkrug auf dem Regal, das Reh- und das Hirschgeweih, all das mit den Augen Erfaßbare ist eingeflossen in jenen Moment des Schreckens, es taucht in der Erinnerung an ihn, mit ihm, wieder auf.
Der Mann, der auf der mit bestickten Polstern belegten Bank neben dem Kachelofen gesessen ist, war mittelgroß, glatzköpfig, untersetzt. Auch er läßt sich aus der Vergangenheit heraufholen, sein gedrungener Körper, sein Rundschädel, seine Arme und sogar seine kurzen, stämmigen Beine, aber nicht seine Stimme, auch nicht sein Gesicht. Wo sein Gesicht sein müßte, ist ein leerer Fleck, Augen, Nase, Mundform sind nicht einmal angedeutet.
Obwohl wahrscheinlich ein Name genannt worden ist, ist kein Name im Gedächtnis, auch nicht im Gedächtnis der anderen, die damals auf dem Hof gelebt haben, haften geblieben.
Anni hatte von diesem Augenblick an beim Heuwenden, bei allen anderen zu verrichtenden Arbeiten über ihre weitere Zukunft nachzudenken. Sie hatte zu überlegen, auf welche Weise sie ihren Unterhalt verdienen würde, ohne anderen eine Last zu sein, ohne betteln zu müssen, ohne Bauernmagd bleiben, in Zukunft weiterhin ausschließlich Hilfsarbeiten verrichten zu müssen. Für eine Sechzehnjährige in jenen Monaten eine nicht ungewöhnliche Situation, wenn man bedenkt, daß wenige Wochen vorher Zwölfjährige nicht zu jung gewesen sind, in einem längst verlorenen Krieg zu sterben, daß jetzt überall im Land elternlose Kinder und Jugendliche unterwegs waren, daß überall Obdachlose auf den Straßen dahinzogen, die kein Ziel hatten, die nicht wußten, wovon sie in nächster Zukunft ihren Unterhalt bestreiten würden. Trotzdem, oder gerade deshalb, eine schwierige Situation. Es waren zu viele, die unterwegs waren, zu viele, die keine Unterkunft, keine Mittel, keinen Besitz mehr hatten, zu viele, die ihre Angehörigen suchten, zu viele, die unterzubringen waren, für die zu sorgen gewesen wäre. Dazu kam, daß sie, Anni, zu jenen gehörte, die man in diesem Land, das nun wieder Österreich heißen durfte, keineswegs brauchte, auch nicht haben, behalten wollte. Man hatte genug Sorgen mit den eigenen Bürgern, mit jenen, die durch Geburt, Herkunft, Heirat ein RECHT darauf hatten, in diesem Land zu leben, man brauchte keine anderen, Fremden, die aus Ländern kamen, in denen man sie auch nicht mehr haben wollte, sie sollten weiterwandern, möglichst rasch, möglichst bald, nach Deutschland ziehen, dort, so fand man, gehörten sie hin.
Wer wußte schon, und wenn er es wußte, wen hätte es interessiert, daß Heinrichs Hauptstadt niemals Berlin, immer nur Wien geheißen hatte? Wer wußte, wollte wissen, wie sehnsüchtig er als junger Student gehofft hatte, in dieser Stadt leben zu dürfen? Wer kannte schon die Geschichte von Heinrichs Mutter Friederike aus Furthof bei Lilienfeld, deren Mutter, der Mürzhofener Gastwirtstochter Amalia, die wiederum Enkelin eines steirischen Hufschmieds gewesen war? Wer wußte, daß Friederike, deren Jugendtraum die Kaiserstadt Wien gewesen war, zeitlebens, wenn der Name des Kaisers, der Kaiserin in ihrer Gegenwart nur genannt worden ist, wenigstens innerlich in eine Art Hofknicks niedergesunken ist? Die Geschichte der Urgroßtante, die im Lainzer Tiergarten als Dreizehnjährige für den jungen Kaiser gekocht, während er auf der Jagd gewesen war, von diesem Kaiser Säbel und Tschako zur ganz persönlichen Aufbewahrung übernommen hat, hätte niemanden interessiert. Kein Mensch wollte noch einen Kaiser. Von dem Reich, das er regiert hatte, für das in den Krieg zu ziehen man Heinrich als jungen Studenten gezwungen hatte, war ein winziger Rest geblieben, ein kleines Land, für das man sich Freiheit, Unabhängigkeit und eine demokratische Verfassung erhoffte, obwohl von all dem im Augenblick noch nicht viel zu bemerken war. Heinrichs Heimkehr aus diesem Krieg war eine Heimkehr auf Abruf gewesen. Was in der Folge geschah, ist bekannt. IHR SUDETENDEUTSCHEN SEID SCHULD AM KRIEG, diesen Satz hatte Anni mehr als einmal zu hören bekommen. Nun gehörte sie zu einer Gruppe von Leuten, die Staatsbürger keines Landes mehr waren, die keine Papiere besaßen, durch die sie zum Überschreiten der Zonengrenzen berechtigt gewesen wären, die nichts von dem tun durften, was ausschließlich Staatsbürgern zu tun erlaubt war, die kein Recht hatten, länger als ausdrücklich gestattet in Österreich zu leben. Nicht einmal zu jenen Verschleppten, Verstoßenen durfte sie sich zählen, die man in der Folgezeit DISPLACED PERSONS genannt hat, Leute, die ihre Heimat ebenfalls verloren hatten, denen dieses Unglück jedoch noch unter der Herrschaft des Hitlerregimes widerfahren war. Eine Tageszeitung, die von der amerikanischen Militärregierung herausgegeben wurde, teilte auch diese Menschengruppe in zwei Teile: Die D.P. WERDEN IN ZWEI KATEGORIEN GETEILT, DEREN ERSTE, DIE ALS »FREUNDE« ANGESPROCHEN WERDEN, SICH FREIWILLIG, WENN SIE GESUND SIND, ZUR ARBEIT MELDEN KÖNNEN UND REGULÄRE LÖHNE SOWIE BEI SCHWERARBEIT AUSSER DER LAGERVERPFLEGUNG ZUSÄTZLICHE LEBENSMITTEL ERHALTEN. DIE ZWEITE KATEGORIE, DIE ALS »FEINDE« ANGESPROCHEN WERDEN, ZUM BEISPIEL DIE VOLKSDEUTSCHEN, SIND DER ARBEITSPFLICHT UNTERWORFEN. FALLS SIE DIE ARBEIT VERWEIGERN, WERDEN SIE MIT NIEDRIGEREN RATIONSSÄTZEN IN ANDERE LAGER GESCHICKT.
Anni war ein Nichts, ein Niemand, kein Freund und kein Feind, ein Mensch, der nirgends hingehörte, niemand würde ihr eine Lehrstelle geben, niemand würde sie für längere Zeit beschäftigen, niemand würde ihr eine Chance geben können, die von Dauer gewesen wäre. Eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, gab es Anni überhaupt nicht. (Nur gut, daß sie die Tragweite all der Bestimmungen und Verbote, die ihre Person betrafen, damals gar nicht bedachte oder auch gar nicht verstand.)
Was also blieb Heinrichs Tochter übrig, was konnte, was durfte sie tun?
Vielleicht, dachte Anni, würde es möglich sein, wieder zur Schule zu gehen.
DEN ELTERN WÄRE ES RECHT GEWESEN, dachte sie und teilte ihren Entschluß, sich in einem Gymnasium um Aufnahme zu bewerben, der Bäuerin mit.
Die Bäuerin hatte Einwände. Sie brauche jetzt jede Arbeitskraft auf dem Hof, vor allem bei der Arbeit im Heu. Und womit Anni das alles, Schule, Wohnung, Essen, bezahlen würde?
(Anni hatte nicht nur an die vier oder fünf Goldmünzen gedacht, welche die Mutter in den Saum ihres Mantels eingenäht hatte. Heinrich hatte Jahre vorher auf einer oberösterreichischen Bank etwas Geld hinterlegt, Anni eine Bestätigung dieser Bank in beglaubigter Durchschrift mitgegeben, dazu eine Vollmacht, die sie berechtigte, bei Bedarf von seinem Guthaben abzuheben. Anni hoffte, daß man ihr bei Nachweis ihrer Bedürftigkeit einen Teil dieses Geldes ausfolgen würde, daß es ihr gelingen würde, damit eine Unterkunft zu bezahlen.)
Nachdem man die durch Kriegseinwirkungen entstandenen Schäden an Gleisanlagen, Weichen, Signalvorrichtungen auf den wichtigsten Eisenbahnstrecken notdürftig repariert, einen Teil der zerstörten Brücken durch Notbrücken ersetzt, das Allernotwendigste an Zugsgarnituren und Lokomotiven wiederhergestellt hatte, nachdem die Schuttberge im Bereich der Bahnhöfe so weit abgetragen worden waren, daß an die Wiedereinführung eines beschränkten Reiseverkehrs zu denken war, hatten die Behörden, mit Bewilligung der Besatzungsmacht, Reisen auf kurzen Strecken wieder gestattet.
Anni überhörte die Einwände der Bäuerin, bestieg Mitte August einen Zug und fuhr nach Linz.
Ist es wirklich nur einer jener Zufälle gewesen, die sich hin und wieder ereignen, war es das, was wir, geübt in der Verwendung von Ausweichworten, geschickten Umschreibungen uns unerklärbarer Zusammenhänge FÜGUNG nennen? Hat einer jener, unseren Augen nicht sichtbaren, jedoch zweifellos in einer uns nicht vorstellbaren Körperlosigkeit existierenden Schutzengel das, was wir FLÜGEL nennen, über Annis Schicksal gebreitet? Oder hat sie einfach nur – wie würde es Valerie genannt haben – GLÜCK GEHABT? Wer wollte sich herausnehmen, dies zu entscheiden?
Alles, was Heinrichs Tochter in der folgenden Zeit unternahm, gelang auf eine sie selbst überraschende Weise. Hilfe wurde ihr geboten, wo sie mit dieser Hilfe gar nicht gerechnet hatte. Schon im Zug ergab es sich, daß sie neben einer beinahe Gleichaltrigen saß, die sie nach ihrem Fahrtziel fragte, sich nach längerem Nachdenken an eine Familie erinnerte, die möglicherweise bereit sein würde, sie bei sich aufzunehmen, was dann auch tatsächlich geschah. Die Direktorin der Schule, in der Anni vorsprach, hörte sich die Geschichte der Sechzehnjährigen an, die nicht Hilfsarbeiterin oder Bauernmagd werden wollte, und beschloß, ihr trotz der fehlenden Staatsbürgerschaft den Schulbesuch zu gestatten. Da Schulzeugnisse nicht vorgelegt werden konnten, hatte Anni in absehbarer Zeit die Bestätigung eines Lehrers vorzulegen, der am Gymnasium der südmährischen Kreisstadt N. unterrichtet hatte und Anni den Abschluß der fünften Klasse bescheinigen konnte. (Was zunächst unmöglich zu sein schien, gelang, ein solcher Lehrer wurde gefunden.) Die Bank gewährte dem Mädchen, das ohne Angehörige war, eine monatliche Barabhebung von einhundertfünfzig Mark zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes.
Anni hatte ein Dach über dem Kopf, wenn auch nur für die nächste Zeit, sie hatte Geld, um Unterkunft und Lebensunterhalt zu bezahlen, sie mußte sich um die allernächste Zukunft keine Sorgen mehr machen. Auch die Erwachsenen wagten ja nicht, für längere Zeit zu planen, Prognosen für eine fernere Zukunft zu stellen. Der Krieg war vorbei, man lebte, ein gewisser Optimismus war angebracht, irgendwie würde sich alles fügen.
Anni fuhr aus Linz zurück auf den Bauernhof, um ihre Sachen abzuholen.
Ob und wieweit Heinrichs und Valeries Tochter durch das in der bäuerlichen Wohnstube laufende Radiogerät oder durch im Juli schon erscheinende Tageszeitungen oder nur durch die Gespräche und Berichte der Erwachsenen über bestimmte Zeitereignisse unterrichtet worden ist, wieweit sie von diesen Ereignissen überhaupt Kenntnis genommen hat, läßt sich heute nicht mehr sagen. In der Erinnerung zeichnet sich zwar die Nachricht vom Abwurf der BOMBEN auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 als alles verdunkelnder Schrecken ab, wann jedoch diese Nachricht Anni erreichte, in ihr Bewußtsein gedrungen ist, wann sie vom Ausmaß der Zerstörung, von der Anzahl der Toten, von all dem, was im Zusammenhang mit diesem Bombenwurf wahrscheinlich berichtet worden ist, erfahren hat, wann sie vor allem zum erstenmal Bilder der riesigen Rauchpilze zu sehen bekam, die vom Gedächtnis nur in Verbindung mit ANGST reproduziert werden können, ist vergessen. Es ist jedoch anzunehmen, daß über die bedingungslose Kapitulation Japans am 14. August und über die Ereignisse, die zu dieser Kapitulation geführt haben, sogar auf dem einsam gelegenen Bauernhof im oberösterreichischen Kremstal gesprochen worden ist.
Ebenso ist anzunehmen, daß der in den erwähnten Zeitungen am 27. Juli abgedruckte Erlaß der Militärregierung von den Bewohnern dieses Hofes zur Kenntnis genommen worden ist, der den Österreichern das Beflaggen ihrer Häuser an bestimmten Feiertagen wieder erlaubte: VOM TAGE DIESES BEFEHLS AN IST ES GESETZLICH ZULÄSSIG, DIE ÖSTERREICHISCHE FAHNE UND DIE ÖSTERREICH VERSINNBILDLICHENDEN FARBEN SO LANGE ZU HISSEN, ALS DIES MIT DEN HIERAUF ANWENDBAREN ÖSTERREICHISCHEN GESETZEN UND GEBRÄUCHEN ZULÄSSIG ERSCHEINT.
(Die Bäuerin zerschnitt ein Leintuch und nähte zwei weiße Streifen auf rotes Fahnentuch, je einen in der Mitte der vorderen und der rückwärtigen Fahnenseite. Rechts und links von diesen Streifen lugte das schmale Segment eines dunkler gefärbten Kreises hervor, der vorher mit dem bewußten weißen Stoffkreis abgedeckt, daher von Sonne und Wetter nicht gebleicht worden war.)
Am 28. Juli konnte man in der Zeitung lesen, daß die Stadt Wien in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden war. Den ersten Gemeindebezirk mit ausgebranntem Stephansdom, zerstörter Staatsoper, ebenso zerstörtem Burgtheater, mit ausgebrannten Kirchen, zerbombten Straßenzügen, zahllosen Ruinen, mit Schuttbergen, aufgerissenen Straßen, defekten Wasserleitungen, abgebrannten Lindenbäumen am Ring, mit ruinierten Fassaden, geborstenen Fensterscheiben übernahm die aus Mitgliedern aller vier Besatzungsmächte bestehende Alliierte Kommission, er wurde zur Internationalen Zone erklärt.
Am 6. August gab es in der amerikanisch besetzten Zone wieder Telegramm- und Telefonverkehr, allerdings NUR FÜR MITGLIEDER DER BESATZUNGSMACHT, FÜR VON DIESER AUTORISIERTE VERTRETER WICHTIGER, VON DER MILITÄRREGIERUNG ZUGELASSENER INDUSTRIEUNTERNEHMEN UND FÜR AMTSPERSONEN.
Mit dem gleichen Datum begann der Eisenbahnverkehr mit Italien wieder zu funktionieren.
Am 12. August wurden die Salzburger Festspiele eröffnet. Vor einem Volksgericht in Wien begann der erste Kriegsverbrecherprozeß.
Am 30. August schreibt der Verfasser eines Zeitungsartikels zur Flüchtlingsfrage, es sei nicht gerecht, den Flüchtlingen nur halbe Lebensmittelkarten zu geben, da doch die normalen Rationen das Existenzminimum keineswegs überschritten. Außerdem sei es undemokratisch, verantwortungslos und vor allem gemütslos, wenn öffentliche Beamte den traurigen Mut besäßen, diesen Leuten ins Gesicht zu sagen, daß solche Maßnahmen nur aus einem Grunde getroffen würden: DEN FLÜCHTLINGEN DEN AUFENTHALT ZU VERLEIDEN.
(Diesen Zeitungsartikel hat Anni bestimmt nicht gelesen, er ist in einem Waldviertier Lokalblatt erschienen.)
Am 17. September begann in Linz an der Donau der Schulbetrieb. An die Bevölkerung war kurz vorher das Ersuchen gerichtet worden, an der Zustandebringung der während der ersten Tage nach dem Einmarsch der alliierten Truppen aus den Schulen geraubten Güter wie: Bilder, Bücher, Filmapparate, Schreibmaschinen und diverser Lehr- und Lernbehelfe, auch der verschwundenen Bücher aus den Schüler- und Lehrerbüchereien, mitzuarbeiten, da diese Gegenstände zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs unbedingt notwendig seien. Grundsätzlich wurde erklärt, daß, da das Lehrziel im vergangenen Jahr in keiner Weise erreicht worden sei, alle Schüler dieses Jahr zu wiederholen hätten.
Als Anni nach Linz kam, ihren Rucksack auf dem Rükken, den Koffer in der einen, den Kasten mit der Ziehharmonika in der anderen Hand, waren die größten Bombentrichter im Bahnhofsviertel schon zugeschüttet worden, die geknickten, umgebrochenen Bäume weggebracht und zu Feuerholz zerschnitten, die höchsten Schuttberge entlang der Hauptstraßen hatte man abgetragen. Die Ruinen waren noch nicht beseitigt worden, die Aufschriften, die im letzten Kriegsjahr an die Häuserwände gemalt worden waren, DEIN OPFER UNSER SIEG oder NUN ERST RECHT, hatte man jedoch entfernt. Die Straßen und Plätze hatten ihre früheren Namen zurückbekommen, aus dem Adolf-Hitler-Platz war wieder ein Hauptplatz, aus den Hermann-Göring-Werken war die Österreichische Montan-Aktiengesellschaft geworden. Den Straßenbahnverkehr über die Donau hatte man wieder aufgenommen, die Überquerung der Brükke allerdings war jetzt nur mit Bewilligung der Behörde gestattet, da der jenseits der Donau liegende Stadtteil URFAHR von den Russen besetzt war.
Zum Kochen stand wieder Gas zur Verfügung, wenn es auch nicht viel zu kochen gab.
Salz jedenfalls gab es genug.
Anni bezog ein Bett in der Wohnung der Familie M., das frei geworden war, weil man den Ehemann der Frau M. in ein Lager für politische Gefangene abgeholt hatte. Auch der ältere der beiden Söhne war aus dem Krieg noch nicht zurückgekehrt. Sie ging in die Schule, machte Hausaufgaben, holte monatlich hundertfünfzig Mark von ihrer Bank, zahlte Miete und Kostgeld, behielt einen kleinen Teil des Geldes für sich, um Schulhefte, Straßenbahnfahrten und ähnliche kleine Ausgaben bestreiten zu können, was übrig blieb, sparte sie. Hin und wieder ging sie ins Kino, einmal ging sie ins Theater und sah die Operette DREIMÄDELHAUS, weinte dann in ihr Kopfkissen, weil Heinrich daheim Operettenmusik auf dem Klavier gespielt hatte, versprach sich selbst, eine gute Schülerin zu sein, weil sie sonst niemanden mehr hatte, dem sie es hätte versprechen können.
Auf diese Weise verging der Herbst. Es würde, hieß es, wahrscheinlich sehr kalt werden, die Menschen fürchteten sich vor dem Winter.