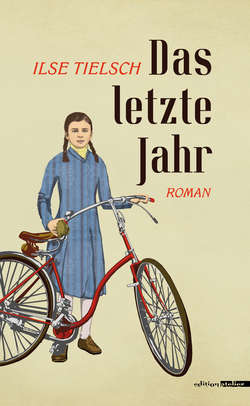Читать книгу Das letzte Jahr - Ilse Tielsch - Страница 9
5
ОглавлениеEine meiner zwei besten Freundinnen ist die Alenka. Wir sind viel zusammen und sie sitzt in der Schule neben mir.
Wenn die Marschenka und ich mit dem Fahrrad in Richtung Tarowitschky unterwegs sind, kommen wir immer an dem Haus vorbei, in dem die Alenka mit ihren Eltern und Geschwistern wohnt. Gleich nebenan ist das Deutsche Haus, in dem die Deutsch sprechenden Bewohner unserer Stadt ihre Feste feiern. Dort gibt es auch einen Gastbetrieb, wo sich die deutschen Familien an den Sonntagnachmittagen treffen. Die Damen haben sich dafür besonders schön gemacht, sind beim Friseur gewesen und haben sich die Lippen geschminkt, sie besprechen die neuesten Nachrichten und die Herren rauchen Zigarren und spielen das schwierige Kartenspiel Tarock.
Der Narodný dum, in dem sich die Tschechen treffen, liegt in einer anderen Straße. Ob dort auch Karten gespielt und Geschichten erzählt werden, weiß ich nicht.
Mein Vetter Albert wohnt in der Nähe des Deutschen Hauses. Sein Vater ist Hutmacher, das ist ein gutes Geschäft und er ist, weil er so schöne Männerhüte macht, ziemlich angesehen, denn für Männer gehört der Hut bei uns unbedingt zur kompletten Bekleidung. Vor gar nicht langer Zeit sind zu bestimmten feierlichen Gelegenheiten, vor allem natürlich in Wien, angeblich sogar noch Zylinder getragen worden.
Auch für Damen gehört es zum guten Ton, sich bei festlichen Anlässen mit Hüten zu schmücken, für jedes Fronleichnamsfest braucht man zum Beispiel unbedingt eine neue, modische Kopfbedeckung. Diese Hüte fertigen mehrere Modistinnen nach der jeweiligen neuesten Mode und nach den speziellen Wünschen ihrer Kundinnen an, oder sie formen einen schon einmal bei einem entsprechenden Anlaß getragenen Hut nach der neuesten Mode um.
Die Hüte für meine Mutter macht eine tschechische Modistin, die Frau Kabelka, die ein paar Gassen weiter ihre Werkstatt hat.
Im vergangenen Winter bin ich übrigens bei einem Elternabend im Deutschen Haus erfolgreich in einem Theaterstück aufgetreten. Ich habe einen Rauchfangkehrer gespielt, der eine Bäckerin trifft, und wie ich der Bäckerin mit dem Ofenruß, den ich vorher auf meine Hände gestrichen hatte, die weiße Schürze schwarz gemacht habe, haben alle Leute im Saal, vor allem meine Verwandten, sehr gelacht. Ich habe kurze Zeit daran gedacht, daß ich vielleicht Schauspielerin werden und zum Theater gehen könnte, dann aber ist mir die Idee mit dem Zirkus doch lustiger vorgekommen.
Weil Rauchfangkehrer früher angeblich Zylinder getragen haben, hat mir mein Großvater zu diesem Anlaß seinen geliehen und hat ihn mir vor Begeisterung über meinen Theatererfolg sogar schenken wollen. Es ist ein zusammenlegbarer Zylinder, er läßt sich zu einer Scheibe zusammenschieben und man kann ihn, wenn man ihn nicht auf dem Kopf tragen will, in die Tasche stecken. Einen Schapoklack, sagt er, nennt man das, das ist ein französisches Wort, denn die Franzosen haben diese praktische Kopfbedeckung erfunden. Weil mir der Schapoklack zu groß gewesen ist, hat man an der Innenseite einen zusammengerollten Papierstreifen eingelegt, damit ist es dann ganz gut gegangen.
Ich habe dieses Geschenk meines Großvaters nicht annehmen wollen, weil ich nicht weiß, was ich, wenn ich nicht gerade Theater spiele, damit anfangen soll. Darüber ist mein Großvater zornig geworden und hat den Zylinder über das Geländer der Brücke, über die wir gerade gegangen sind, in den Bach werfen wollen, da habe ich ihm den Schapoklack rasch aus der Hand genommen und mich herzlich dafür bedankt.
Mein Großvater kann auch bei anderen Gelegenheiten sehr zornig werden, gleich darauf aber ist er wieder ganz sanft und gut. Das hat er, sagt meine Großmutter, von seinem eigenen Großvater geerbt, von meinem eigenen Ururgroßvater also, der soll, heißt es, leicht in Zorn geraten sein, wenn ihn etwas geärgert hat. Er war Gastwirt in dem Dorf Niemtschitz, oder wie die Tschechen sagen Njemtschice, das liegt in der Nähe der mährischen Hauptstadt Brünn.
Vielleicht ist mein Ururgroßvater ein Tscheche gewesen, weil in Niemtschitz viele Tschechen wohnen, das aber wissen wir nicht und denken auch nicht darüber nach. Über die Ururgroßväter macht man sich bei uns wirklich keine besonderen Gedanken, es ist uns ziemlich egal, ob sie deutsch oder tschechisch gewesen sind. Warum soll das auch wichtig sein? Mein Onkel Franz und seine Frau, die Tante Frieda zum Beispiel, die schräg gegenüber wohnen, sind deutsch, obwohl in ihrem Familiennamen über das r am Schluß ein Hatschek gesetzt werden muß, wie das sonst nur im Tschechischen üblich ist. Vielleicht haben sie diesen Hatschek auch von einem Ururgroßvater geerbt, der dann irgendwann einmal zum Deutschen geworden ist.
Dafür interessiert sich niemand, und es geht ja auch niemanden etwas an. Manchmal, sagt mein Vater, hat sich ein Pfarrer bei der Eintragung eines neu geborenen Kindes einfach geirrt und den Namen des Täuflings falsch geschrieben, und weil man die mit Tinte geschriebenen Eintragungen in den Taufbüchern nicht ausradieren kann, ist es dann einfach bei der falschen Schreibweise geblieben.
Manchmal soll diese falsche Schreibweise allerdings auch absichtlich geschehen sein, damit es in unserer Gegend mehr Tschechen und weniger Deutsche gibt, das behaupten neuerdings manche Leute. Jedenfalls haben manche Deutsche auf diese Weise angeblich über einem Konsonanten in ihrem Namen einen Hatschek bekommen.
In letzter Zeit lassen allerdings manche Leute, die einen Hatschek in ihrem Namen haben, diesen beim Schreiben absichtlich weg. Mein Onkel Franz und die Tante Frieda haben den ihren jedoch bisher behalten, weil man nur so ihren Namen richtig aussprechen kann.
Namen bedeuten aber ohnedies beinahe gar nichts in unserer kleinen Stadt. Die Tschechen haben nicht selten deutsche Namen wie Müller oder Schmid und die Deutschen heißen Wessely, wie unser Herr Oberlehrer, Ostrtschil oder Nevadla oder Pelinka. Mir ist es gleichgültig, ob einer einen Hatschek in seinem Namen hat oder nicht, wenn ich nach Amerika gehe, muß ich mich ohnedies vollständig umstellen und die Indianersprache erlernen, vor allem die der Apachen, die mir besonders sympathisch sind, und dazu vielleicht auch die der Sioux, damit ich die ewigen Streitereien, die sie mit den Apachen haben, schlichten kann. Vielleicht haben die Indianer auch Hatscheks in ihren Namen oder vielleicht andere schwierige Zeichen, im »Schatz im Silbersee« habe ich nichts darüber gelesen.
In unserer Stadt kann jeder Deutsche etwas Tschechisch, jedenfalls so viel, daß er sich verständigen kann, und beinahe jeder Tscheche kann auch ganz gut Deutsch. Es kommt vor, daß ein Deutscher eine Tschechin heiratet oder umgekehrt, und selbstverständlich spielen die deutschen und die tschechischen Kinder zusammen, vor allem, wenn sie in derselben Gasse wohnen. Genauso ist es, wenn die Buben einer bestimmten Gasse mit den Buben einer anderen Gasse raufen, was erwähnt werden muß, weil es oft vorkommt. Die Gasse, in der ein Bub wohnt, ist viel wichtiger als die Sprache, da helfen alle zusammen, es ist dabei ganz egal, ob einer deutsch oder tschechisch ist.
Natürlich gibt es auch unter den Erwachsenen Streitereien, aber die haben auch meistens nichts mit der Sprache zu tun und so etwas kommt ja auch in anderen Gegenden vor, in denen nur eine einzige Sprache gesprochen wird.
In unserer Stadt ist es also anders als in den Dörfern, in denen nur Deutsche oder nur Tschechen wohnen, und ähnlich soll es zum Beispiel in Pohrlitz sein, das bei den Tschechen Pohorschelice heißt. Das sagt jedenfalls die Marschenka. In Pohorschelice, sagt sie, sind aber nicht wie bei uns mehr Deutsche als Tschechen, sondern mehr Tschechen als Deutsche. Sie weiß das, denn sie hat dort Verwandte.