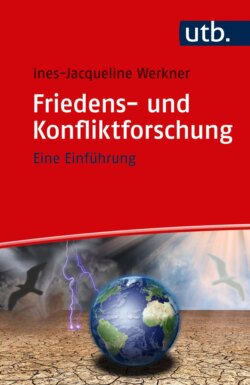Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 23
4.1 Zum Konfliktbegriff
ОглавлениеKonflikt ist dem lateinischen Ausdruck conflictus entlehnt und steht für Widerstreit und Zwiespalt. Etymologisch geht er auf confligere zurück, zusammengesetzt aus dem Präfix con (lateinisch für mit, zusammen) und dem Verb fligere (lateinisch für prallen). In dieser Ableitung stellen Konflikte – zunächst völlig wertneutral und unvoreingenommen – soziale Interaktionen beziehungsweise „soziale Tatbestände“ (Bonacker und Imbusch 2006, S.68) dar, an denen mindestens zwei Akteure1 (Individuen, Gruppen, Organisationen, Staaten etc.) beteiligt sind, charakterisiert durch unvereinbare Positionsdifferenzen.
Johan Galtung (2007, S.135f.) betrachtet Konflikte als „triadisches Konstrukt“ (vgl. Schaubild 5), bestehend aus:
dem Verhalten der Konfliktakteure, die den Konflikt anzeigen und bewusst werden lassen,
den Einstellungen und Annahmen der Konfliktakteure in Bezug auf die angenommenen Konfliktursachen, die Wahrnehmung der eigenen Position und die Bewertung der anderen Partei sowie
dem Widerspruch, ausgedrückt in inkompatiblen Zielzuständen.
Schaubild 5:
Das Konfliktdreieck nach Johan Galtung (2007, S.136)
„Konflikt = Annahmen/Einstellungen + Verhalten + Widerspruch/Inhalt“ – so die Galtungsche Kurzformel (2007, S.135). Zwischen allen drei Komponenten besteht ein enger Zusammenhang; sie sind stets im Kontext zu betrachten. Dabei könne ein Konflikt von jedem Punkt aus beginnen: Beispielsweise könne ein Widerspruch, der ein gewünschtes Ziel versperrt, als Frustration erlebt werden und zu einer aggressiven Einstellung und einem aggressiven Verhalten führen. Aber auch negative Einstellungen oder Verhaltensdispositionen können – sofern „etwas ‚auftaucht’, das nach einem Problem aussieht“ (Galtung 2007, S.137) – aktiviert werden und zu einem manifesten Konflikt führen. Diese Mechanismen bergen das Potenzial, Gewaltspiralen auszulösen. Zugleich lassen sich aber auch negative Einstellungen und negatives Verhalten zügeln und Widersprüche überwinden.
Galtung unterscheidet zudem zwischen der manifesten (sichtbaren) und latenten (unsichtbaren) Ebene eines Konflikts. Das Konfliktverhalten bildet die manifeste Ebene. Dagegen bleiben die Einstellungen der Akteure sowie ihre verfolgten Absichten und Ziele häufig im Verborgenen. Sie bilden die latente, unterbewusste Ebene des Konflikts. Dabei gebe es zwar Konflikte, die sich ausschließlich auf der latenten Ebene befinden, nicht dagegen Konflikte, die allein auf manifester Ebene verortet werden können.
Soll aus einem Konflikt ein manifester werden, müssen die widerstreitenden, unvereinbaren Positionsdifferenzen auch offen kommuniziert werden. Das heißt: Die Positionsdifferenzen müssen den Akteuren bewusst sein und für sie handlungsbestimmend werden. Zudem müssen sie – so Werner Link (1994, S.100) – „eine kritische Spannung im Beziehungszusammenhang bilden“. Letzteres stellt eine notwendige Bedingung dafür dar, dass „aus in sich selbst ruhenden Individuen Konfliktparteien werden“ (Meyer 2011, S.29).