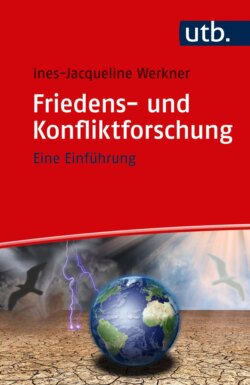Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 31
5.2 Die neuen Kriege
ОглавлениеMit dem Ende der Bipolarität und Blockkonfrontation wird verstärkt ein Wandel des Krieges konstatiert. Martin van Creveld argumentiert bereits 1991, dass der klassische zwischenstaatliche Krieg überholt sei und zunehmend nichtstaatliche Akteure, innerstaatliche Kriege sowie „low intensity conflicts“ an Bedeutung gewinnen. Andere Autoren sprechen von „wars of the ‚third kind‘“ (Holsti 1996), „kleinen Kriegen“ (Daase 1999) oder „wilden Kriegen“ (Sofsky 2002). Besondere Aufmerksamkeit erfahren hat der Begriff der „neuen Kriege“ – ein Terminus, der begrifflich auf Mary Kaldor (1999) zurückgeht und den Herfried Münkler (2002) prominent in die deutsche Forschungslandschaft eingeführt hat. Dabei setzen die einzelnen Autorinnen und Autoren dieses Theorems unterschiedliche Fokusse: So macht van Creveld vorrangig die Waffentechnologie und die Existenz atomarer Waffen für das Verschwinden des Krieges zwischen Großmächten verantwortlich, während Kriege an der Peripherie fortdauern. Kaldor betont die identitätspolitische Dimension der neuen Kriege, die die machtpolitische der alten Kriege ablöse. So werden die neuen Kriege im Namen der Identität (Nation, Stamm, Religion) geführt, wobei nationalistische oder ethnische Identitäten von Kriegsakteuren benutzt werden, um Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren und die Diaspora zu unterstützen. Münkler (2002; 2006a, b; 2018) wiederum hebt auf drei Merkmale ab:
die Entstaatlichung beziehungsweise Privatisierung des Krieges: Mit den neuen Kriegen habe der Staat sein Kriegsführungsmonopol verloren. So seien es zunehmend nichtstaatliche Akteure – Warlords, lokale Kriegsherren oder überregionale Kriegsunternehmer –, die das Kriegsgeschehen bestimmen und von ihm profitieren, während Staaten fast nur noch reaktiv auf Kriege reagieren.
die Kommerzialisierung des Krieges: Die neuen Kriege führen zu einer Diffusion von Gewaltanwendung und Erwerbsleben. Münkler (2002, S.29) konstatiert: „Der Krieg wird zur Lebensform: Seine Akteure sichern ihre Subsistenz durch ihn, und nicht selten gelangen sie dabei zu beträchtlichem Vermögen. Jedenfalls bilden sich Kriegsökonomien aus, die kurzfristig durch Raub und Plünderungen, mittelfristig durch unterschiedliche Formen von Sklavenarbeit und längerfristig durch die Entstehung von Schattenökonomien gekennzeichnet sind, in denen Tausch und Gewaltanwendung eine untrennbare Verbindung eingehen.“ Dabei unterscheiden sich die Warlordfigurationen der neuen Kriege von klassischen Bürgerkriegskonstellationen. Während Letztere politisch konnotiert seien und innerstaatliche Auseinandersetzungen zur Durchsetzung politischer Interessen und Ideen darstellen, könne – so Münkler (2002, S.44) – davon „in vielen der neuen Kriege nicht die Rede sein“.
die Asymmetrierung des Krieges: Diese stelle eine Reaktion auf nicht überwindbare militärische Asymmetrien dar und führe zu einer „Asymmetrierung der Kriegsgewalt durch ansonsten unterlegene und kaum kampffähige Akteure“ (Münkler 2006b, S.134), die sich auf diese Weise zu behaupten suchen. „Die Entstehung weltpolitischer Asymmetrien durch die offenkundig uneinholbare wirtschaftliche, technologische, militärische und kulturindustrielle Überlegenheit der USA geht mit einer Asymmetrierung des Krieges durch die Verlagerung der Kampfzonen, die Umdefinition der Mittel zur Kriegführung und die Mobilisierung neuer Ressourcen einher“ (Münkler 2002, S.53). Darunter lassen sich auch Strategien des transnationalen Terrorismus fassen (vgl. Kapitel 5.4 dieses Lehrbuchs). Die Asymmetrien beschränken sich dabei nicht nur auf die physische Sphäre, sie beinhalten auch eine psychische Dimension. Diese setzen bei der hohen Verwundbarkeit postheroischer Gesellschaften an, die immer weniger bereit seien, eigene Opfer in Kauf zu nehmen (vgl. Münkler 2002, S.50).
Mit dem Theorem der neuen Kriege verbinden sich weitere Charakteristika: Sie reichen von einer Entmilitarisierung des Krieges (so seien die kriegsführenden Parteien immer häufiger Krieger und nicht Soldaten) über die Nivellierung der Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten und eine damit verbundene Regellosigkeit, Entzivilisierung (auch Barbarisierung) und Enthegung des Krieges (sowohl zeitlich als auch räumlich) bis hin zu einer Hybridisierung der Zustände (weder Krieg noch Frieden). Die neuen Kriege richten sich auch nicht mehr gegen bewaffnete Kräfte, sondern primär gegen die Zivilbevölkerung. Waren in klassischen Staatenkriegen bis zu etwa 90 Prozent der Getöteten und Verwundeten Kombattanten, sind es in den neuen Kriegen mit 80 Prozent vorrangig Zivilisten (vgl. Münkler 2002, S.28f.). Damit einher gehen ein „Angstmanagement“, eine weitgehende „Entdisziplinierung der Bewaffneten“ und eine „Resexualisierung der Gewaltanwendung“ (Münkler 2002, S.29f.; vgl. Schaubild 11).
Zentrale Charakteristika der neuen Kriege
„Die Neuen Kriege schwelen vor sich hin, lodern gelegentlich auf und glimmen dann untergründig fort, so dass man oft nicht mit Sicherheit sagen kann, ob in dem betreffenden Gebiet Krieg oder Frieden herrscht; die Neuen Kriege sind weder zwischenstaatliche noch rein innergesellschaftliche Kriege, sondern fast immer beides zugleich, weswegen man auch von transnationalen Kriegen spricht; die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nonkombattanten, eine Schlüsseldifferenz des klassischen Kriegsrechts, spielt in ihnen keine Rolle, weswegen mit Blick auf die Zivilbevölkerung auch von Semikombattanten gesprochen wird. Die Neuen Kriege sind infolgedessen dadurch charakterisiert, dass sie keinerlei evolutive Richtung aufweisen, sondern durch rekursive und zirkuläre Dynamiken gekennzeichnet sind“ (Münkler 2018, S.1886).
Als Vergleichsfolie dient dem Theorem der neuen Kriege das herkömmliche Kriegsgeschehen, die sogenannten „alten Kriege“. Darunter werden nicht die Imperialkriege der europäischen Kolonialmächte oder die innergesellschaftlichen Kriege in Europa und andernorts gefasst, sondern „die zwischenstaatlichen Kriege, bei denen souveräne Territorialstaaten die Monopolisten sowohl der legitimen als auch der faktischen Kriegsführungsfähigkeit waren“ (Münkler 2018, S.1885). Dagegen mag man einwenden, dass es sich bei dieser Sichtweise um eine eurozentristische handelt, stellen die Staatenkriege global betrachtet eher die Ausnahme denn die Regel dar. Dennoch hat sich diese Konstellation international als durchaus prägend erwiesen: Allen Kriegsdefinitionen ist gemeinsam, dass sie den klassischen Staatenkrieg im Blick haben (vgl. Schmidt 2012, S.24). Die Charta der Vereinten Nationen wie auch das humanitäre Völkerrecht haben den Staat als Referenzpunkt (vgl. Münkler 2018, S.1885). Und auch Kalevi J. Holsti (1992, S.38f., zit. nach Daase 1999, S.15) konstatiert:
„Unsere leitenden Begriffe, Theorien der internationalen Beziehungen, strategischen Analysen und Untersuchungen über systemischen Wandel und die Rolle von Krieg in diesen Prozessen basieren explizit oder implizit auf den Mustern der Geschichte Europas und des Kalten Krieges.“
| Kriterien | Alte Kriege | Neue Kriege |
| Zeit: | 18. Jahrhundert – 1945 | verstärkt seit 1990 |
| Akteure: | Krieg zwischen modernen Staaten | Kriege zwischen politisch organisierten Gruppen |
| Implikationen für den Staat: | Monopolisierung staatlicher Gewalt (zentralisiert, nationale Armeen) | der Staat hat sein Monopol der Kriegsgewalt verloren; Entstaatlichung und Privatisierung des Krieges (Warlords, kriminelle Gruppen, Söldnerfirmen) |
| zentrales Moment: Nation (Trinität von Volk, Heer, Regierung) | Aufhebung der Trinität | |
| Krieg als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln | Krieg als Fortführung der Ökonomie mit anderen Mitteln (Kommerzialisierung des Krieges) | |
| Konsolidierung staatlicher Macht (Staatsbildungskriege) | Erosion staatlicher Strukturen (Staatszerfallskriege) | |
| Kriegsführung: | klar definierter Beginn (Kriegserklärung) und klar definiertes Ende | konturlos; weder Krieg noch Frieden |
| regelgeleitet (ius in bello), klare Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten | regellos, Enthegung, Entzivilisierung, Barbarisierung, Nivellierung der Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten | |
| hohe Intensität | geringe Intensität | |
| Symmetrie des Krieges | Asymmetrie des Krieges |
Schaubild 11:
Alte versus neue Kriege in Anlehnung an Herfried Münkler (2002)