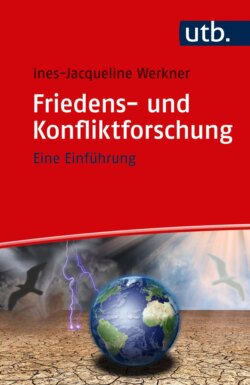Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 24
4.2 Konflikte – unerwünschte Erscheinungen?
ОглавлениеWie ein Konflikt bewertet und ob er als destruktive oder konstruktive Kraft wahrgenommen wird, hängt wesentlich von den jeweiligen theoretischen Vorannahmen ab. Idealtypisch lassen sich vier konflikttheoretische Positionen ausmachen (vgl. Bonacker und Imbusch 2006, S.76f.):
Aus der Sicht konservativer Gesellschaftstheorien gilt Konflikt als pathologische Erscheinung, der die soziale Ordnung bedrohe und zu bekämpfen sei. Dem Konflikt kommt hier eine ausschließlich negative Funktion zu; die gesellschaftliche Konfliktrealität wird dabei weitgehend geleugnet.
In einer abgeschwächten Variante wird Konflikt als Dysfunktion betrachtet. Hier wird die gesellschaftliche Konfliktrealität zwar nicht negiert, der Konflikt aber doch weitgehend negativ bewertet, sei er ein Anzeichen für die mangelnde Effizienz beziehungsweise das Nicht-Funktionieren gesellschaftlicher Strukturen.
Andere betonen dagegen die integrative Funktion von Konflikten. Aus dieser Perspektive sei der Konflikt ein normales Phänomen von Gesellschaften. Hier erfährt der Konflikt eine positive Bewertung, insbesondere infolge seiner angenommenen systemintegrativen Funktionen.
Darüber hinaus gibt es Vertreterinnen und Vertreter, die Konflikt als Katalysator sozialen Wandels betrachten. Aus dieser Perspektive werden soziale Konflikte als für die gesellschaftliche Entwicklung notwendiges Moment und Fortschritt der Geschichte verstanden.
Was bedeutet nun aber die sozialwissenschaftliche Anerkennung der Rolle von Konflikten für den sozialen Wandel für die Friedens- und Konfliktforschung? Wie passt diese positive Funktionszuschreibung zu dem auch in der Friedens- und Konfliktforschung vorherrschenden negativen Bild von Konflikten? Hier gilt es zunächst, zwischen dem Konflikt und Formen seines Austrags zu unterscheiden (vgl. Wasmuht 1992, S.7; Bonacker und Imbusch 2006, S.68f.). Denn erfahren Konflikte – entgegen ihrer wertneutralen Beschreibung als soziale Tatbestände und ungeachtet ihrer auch positiven Funktionen – eine vorrangig negative Zuschreibung, ist dies häufig dem Umstand geschuldet, vorrangig Konflikte mit einem hohen Gewaltpotenzial im Blick zu haben. Diese Perspektive ist der Friedens- und Konfliktforschung auch eingeschrieben, befasst sie sich – wie im Kapitel 3 ausgeführt – mit der Frage, „welche Faktoren dazu beitragen, dass aus Konflikten gefährliche Konflikte werden und welche Möglichkeiten zu ihrer Einhegung bestehen“ (Struktur- und Findungskommission der Friedensforschung 2000, S.259). Ungeachtet dessen – und das ist stets mit im Blick zu behalten – werden die meisten der zwischen- wie auch innerstaatlichen Konflikte friedlich ausgetragen; nur wenige von ihnen entwickeln sich zu ernsten Krisen und von diesen wiederum enden etwa zehn Prozent im Krieg (vgl. Ruloff 2004, S.14; Bonacker und Imbusch 2006, S.75).
Das erkenntnistheoretische Interesse der Friedens- und Konfliktforschung ist es also nicht, Konflikte per se zu vermeiden. Vielmehr geht es um einen gewaltfreien Austrag von Konflikten, das heißt um eine geregelte, zivile Konfliktbearbeitung. Das folgende Zitat illustriert diesen Sachverhalt in einem sehr anschaulichen Bild:
„Konflikte sind […] das Salz in der Suppe sozialen Lebens. Weder versalzene Suppen – gewaltsam ausgetragene Konflikte – noch salzlose Suppen – völlig konfliktfreie Welten – sind wünschenswert.“ (List 2006, S.54)