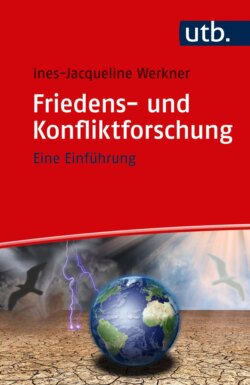Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 26
4.4 Kriegsdefinitionen
ОглавлениеKriege stellen eine bestimmte Form gewaltsamer Konflikte dar, gekennzeichnet durch „großräumig organisierte Gewalt“ (Münkler 2002, S.11). Die wohl bekannteste Definition stammt vom preußischen Militärtheoretiker Carl von Clausewitz: Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln – beziehungsweise in der Originalfassung:
„So sehen wir also, daß der Krieg nicht bloß als politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln“ (Clausewitz 2000 [1832], S.44).
Des Weiteren bestimmt Clausewitz (2000 [1832], S.27) Krieg als einen „Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“. Damit sind Mittel (Gewalt) und Zweck („dem Feinde unseren Willen aufzudringen“) des Krieges benannt. Diese funktionalistische Kriegsdefinition kann an Thomas Hobbes anschließen, hat dieser „das Konfliktpotenzial aus dem Inneren der Gesellschaft in das äußere verlagert“ und Krieg „als Motor dieser Transformation“ (Bonacker und Imbusch 2006, S.108) angesehen. Mit der Aufklärung hat sich ein rationalistischer Kriegsbegriff herausgebildet (vgl. Bonacker und Imbusch 2006, S.108). Danach sei Krieg irrational und eine Folge absolutistischer Herrschaftsstrukturen. Ein wesentlicher Vertreter dieses Ansatzes ist Immanuel Kant. Ihm zufolge sei der Mensch – ist er einmal durch eine republikanische Ordnung von seiner Unmündigkeit befreit – aufgrund seiner Vernunft in der Lage, Konflikte mit nicht-kriegerischen Mitteln zu lösen:
„Wenn (wie es in dieser Verfassung nicht anders sein kann) die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle, oder nicht, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten […], sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen“ (Kant 1968 [1795], S.351).
Seit den Weltkriegen dominiert die völkerrechtliche Definition. Danach stellen Kriege mit Waffengewalt und über einen längeren Zeitraum ausgetragene Konflikte zwischen zwei oder mehreren organisierten und zentral gelenkten Gruppen dar, bei denen es sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte eines Staates handeln muss. Im Völkerrecht kommt der Kriegsbegriff allerdings immer seltener zum Tragen. Stattdessen wird von „internationalen bewaffneten Konflikten“ (Formen zwischenstaatlicher Anwendung von Waffengewalt) beziehungsweise von „nicht-internationalen bewaffneten Konflikten“ (Formen innerstaatlicher Anwendung von Waffengewalt) gesprochen.
Die empirische Kriegsforschung versucht, sich dem Phänomen des Krieges durch quantitative beziehungsweise qualitative Operationalisierungen anzunähern. Im Fokus quantitativer Definitionen steht die Anzahl der Kriegsopfer. Sie bezeichnen einen sozialen Tatbestand als Krieg, wenn die Zahl der (direkten oder indirekten) Todesopfer einer gewaltsamen Auseinandersetzung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Hier dominiert der Ansatz von David Singer und Melvin Small, der in das Projekt Correlates of War der Universität Michigan eingegangen ist. Sie bezeichnen jeden bewaffneten Konflikt mit mindestens 1.000 getöteten Kombattanten (battle deaths) pro Jahr als Krieg. Quantitative Definitionen sind nicht unumstritten; auch differieren sie stark. Das beinhaltet zum einen den Schwellenwert selbst, ist dieser immer auch zu einem gewissen Grade willkürlich. Auch gibt es Konfliktdatenbanken wie die der Universität Uppsala in Schweden, die nicht nur getötete Kombattanten, sondern auch zivile Todesopfer (battle-related deaths) mit in ihre Analysen einbeziehen. Wieder andere mahnen an, gleichfalls die Größe der betroffenen Populationen mit zu berücksichtigen. Insbesondere würden quantitative Zugänge – so die Hauptkritik – keine Aussagen über zentrale Charakteristika des Krieges zulassen (vgl. Boemcken und Krieger 2006, S.12f.).
Qualitative Definitionen stützen sich stärker auf die Beschaffenheit des Konfliktaustrags. In dieser Tradition sieht sich beispielsweise das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK), auch wenn es an die eben beschriebenen quantitativen Ansätze anknüpfen kann. Das HIIK beschränkt sich in seiner Analyse nicht nur auf Kriege, sondern nimmt alle Konflikte in den Blick, die die „staatliche Kernfunktion oder die völkerrechtliche Ordnung bedrohen oder eine solche Bedrohung in Aussicht stellen“ (HIIK 2020b). Im Fokus steht die Konfliktintensität. In die Operationalisierung einbezogen werden Mittel (Waffen- und Personaleinsatz) sowie Folgen des Gewalteinsatzes (Todesopfer, Flüchtlinge und Ausmaß der Zerstörung). Dabei werden fünf Intensitätsstufen von Konflikten unterschieden: Disput, gewaltlose Krise, gewaltsame Krise, begrenzter Krieg und Krieg (vgl. Schaubild 9). Ein politischer Konflikt wird als Krieg eingestuft, wenn physische Gewalt „in massivem Ausmaß angewandt wird“ und die eingesetzten Mittel und Folgen „in ihrem Zusammenspiel als umfassend bezeichnet werden“ (HIIK 2020b).
Schaubild 9:
Stufen der Konfliktintensität nach dem HIIK (2020b)
Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Universität Hamburg (AKUF) orientiert sich an der oben erwähnten völkerrechtlichen Definition. In Anlehnung an den ungarischen Friedensforscher István Kende (1917-1988) gilt ein gewaltsam ausgetragener Konflikt als Krieg, wenn er alle der folgenden Merkmale aufweist:
(a) „an den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt, bei denen es sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte (Militär, paramilitärische Verbände, Polizeieinheiten) der Regierung handelt;
(b) auf beiden Seiten muss ein Mindestmaß an zentral gelenkter Organisation der Kriegsführenden und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle (Guerillaoperationen, Partisanenkriege usw.);
(c) die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuierlichkeit und nicht nur als gelegentliche, spontane Zusammenstöße, das heißt beide Seiten operieren nach einer planmäßigen Strategie, gleichgültig ob die Kämpfe auf dem Gebiet einer oder mehrerer Gesellschaften stattfinden und wie lange sie dauern“ (AKUF 2020).
Zudem differenziert die AKUF zwischen Kriegen und bewaffneten Konflikten. Letzteres bezeichnet militärische Auseinandersetzungen, die die Kriterien der Kriegsdefinition nicht in vollem Umfang erfüllen, beispielsweise wenn die Kontinuität der Kampfhandlungen (noch) nicht gegeben ist.
Auch qualitative Ansätze unterliegen der Kritik. Zum einen bleiben diese in der Regel einer staatszentrierten Perspektive verhaftet (vgl. beispielsweise Punkt a der AKUF-Definition), die der zunehmenden Entgrenzung des Krieges nicht gerecht werden. Zum anderen werden Kriege und bewaffnete Konflikte als klar abgrenzbare Tatbestände begriffen. In der empirischen Wirklichkeit sind die Grenzen – zwischen Kriegs- und Friedenszuständen, zwischen militärischer und ziviler Sphäre sowie zwischen innen und außen – dagegen fließend. So lassen sich auch Entwicklungen und Phänomene wie die sogenannten neuen Kriege nur begrenzt in die klassischen Kategorien einordnen. Bis heute besteht eine offene Debatte darüber, wo der transnationale Terrorismus zu verorten sei: als Krieg oder krimineller Akt, verbunden mit differenten Strategien der Konfliktbearbeitung (ausführlicher dazu Kapitel 5.4).
Was macht nun aber das Wesen des Krieges aus? Hier lassen sich drei zentrale Merkmale ausmachen (vgl. Jahn 2012, S.33): Erstens stellen Kriege – in Anlehnung an Carl von Clausewitz – eine Form der Politik dar. Damit bleiben andere gewaltsame Formen individueller oder gesellschaftlicher Konflikte wie Privatfehden oder kriminelle Bandenkriege außen vor (auch unabhängig von der Zahl der Opfer). Zweitens erfordern Kriege mindestens zwei kriegsbereite Akteure oder provokant formuliert: Krieg beginnt mit der Verteidigung. Und drittens unterscheiden sich die normativen Prämissen der Gewaltanwendung: Das Töten im Krieg ist – selbst heutzutage bei Einhaltung des humanitären Völkerrechts – rechtlich und häufig auch ethisch erlaubt. Dabei verlangen auch Demokratien ihren Soldaten und Soldatinnen im Krieg ab, entgegen gesellschaftlich etablierter Normen und Werte zu handeln, indem sie töten und zugleich die Bereitschaft eingehen, getötet zu werden.