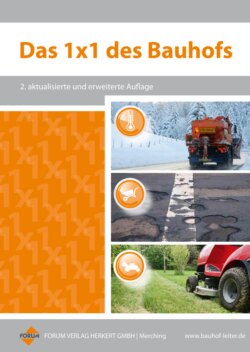Читать книгу Das 1x1 des Bauhofs - Inga Dora Meyer, Christian Borzym - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErste Hilfe
{Erste Hilfe}
Notrufnummern {Notrufnummer}
Rettungsdienst/Notarzt: 112
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
deutschlandweit, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr
W-Fragen bei einem Notruf:
Lassen Sie sich vom Disponenten abfragen – die W-Fragen dienen nur zur Orientierung für Sie!
Wo? exakte Ortsangabe
Was? Was ist passiert?
Wie viele? Anzahl betroffener Personen
Welche Verletzungen? ggf. die Verletzungen oder Erkrankungen konkretisieren–WARTEN! – auf Rückfragen des Disponenten
Absichern der Unfallstelle {Unfallstelle, absichern}
ruhig bleiben
Warnblinkanlage an
Warnweste anziehen (seit 2014 ist in jedem Fahrzeug mind. eine Weste Pflicht. Tipp: griffbereit lagern! siehe auch S. 228)
Warndreieck (griffbereit lagern!) auspacken und vor der Brust tragend hinter der Leitplanke gehend zum Bestimmungsort bringen.
Bei Wind und Wetter: Nutzen Sie das Kfz niemals als Wetterschutz. Warten Sie hinter der Leitplanke.
Entfernungen für das Aufstellen des Warndreiecks (Richtwerte):
| Stadt | 50 m |
| Land | 100 m |
| BAB | 200 m |
Reanimation {Reanimation} – Ablauf
Die Herz-Lungen-Wiederbelebung („Reanimation“) wird begonnen, wenn eine Person bewusstlos ist und keine oder eine nicht normale Atmung hat und somit der Kreislauf zusammenbricht. Damit die Person eine Chance auf ein Überleben hat, muss so schnell wie möglich durch Ersthelfer die Reanimation gestartet werden, um schwere Hirnschäden durch Sauerstoffmangel zu verhindern. Die Herzdruckmassagen dienen dazu, die ausgefallene Pumpfunktion des Herzens von außen zu übernehmen, und die Atemspende des Ersthelfers bringt frischen Sauerstoff in die Lunge.
Man beginnt mit 30 Herzdruckmassagen, es folgen 2 Beatmungen; dieses wiederholt sich so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft oder die Person wieder beginnt zu atmen. Eine möglichst unterbrechungsfreie Herzdruckmassage ist sehr wichtig, da diese das Blut zum Zirkulieren bringt – und somit den Sauerstoff im Körper transportiert.
Auffinden der Person
Beugen Sie sich zur bewusstlosen Person herunter, überstrecken Sie deren Kopf, indem Sie Kinn und Stirn anfassen und den Kopf vorsichtig nach hinten ziehen, um die Atemwege frei zu machen. Schauen Sie Richtung Brust der Person. Sie können die Atmung nun sehen, hören und fühlen. Wenn Sie innerhalb von zehn Sekunden keine Atmung feststellen können, beginnen Sie mit der Wiederbelebung. Wichtig: Gelegentliche, vereinzelte Atemzüge („Schnappatmung“) werden als „nicht normale Atmung“ bezeichnet und es wird mit der Wiederbelebung begonnen bzw. weitergemacht.
Herzdruckmassage
Die Person muss auf einer harten Unterlage liegen. Strecken Sie die Arme durch, setzen Sie sich nah im 90-Grad-Winkel an die Person. Legen Sie einen Handballen auf die Mitte des Brustkorbs und legen Sie Ihre zweite Hand auf die erste. Drücken Sie tief (min. 5 cm, max. 6 cm) und fest bei einer Frequenz von 100–120 pro Minute. Achten Sie darauf, den Brustkorb nach jeder Herzdruckmassage vollständig zu entlasten.
Beatmung
Machen Sie die Atemwege frei, indem Sie den Kopf der Person überstrecken. Sie fassen an Kinn und Stirn und ziehen den Kopf vorsichtig nach hinten. Schließen Sie die Nase, indem Sie sie mit Daumen und Zeigefinger zusammenkneifen. Atmen Sie normal ein und umschließen dann den Mund der Person. Blasen Sie eine Sekunde gleichmäßig in den Mund und schauen, ob sich der Brustkorb der Person hebt. Während Sie wieder einatmen, schauen Sie, dass der Brustkorb der Person sich wieder senkt. Ohne die Kopfposition der Person verändert zu haben, wiederholen Sie die Beatmung. Kehren Sie dann wieder zu 30 Herzdruckmassagen zurück. Sofern vorhanden nutzen Sie eine Beatmungshilfe.
Defibrillator für Laien
Der Laiendefibrillator, auch Automatischer Externer Defibrillator genannt, gibt bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung den frühestmöglichen Stromstoß ab und leitet die Ersthelfer an, die Wiederbelebungsmaßnahmen weiterzuführen. Er kann durch Ersthelfer sicher bedient werden und sorgt für eine höhere Überlebensrate. Zu einer Anschaffung wird auch seitens der gesetzlichen Unfallversicherungen geraten.
Wundversorgung
Die Wundversorgung soll pragmatisch und zielgerichtet sein. Wichtig ist, die Wunde nicht mit Hausmitteln, wie Mehl, Butter oder Salben, zu verunreinigen. Sollten sich Fremdkörper und/oder Schmutz in der Wunde finden, ist die Vorstellung bei einem Arzt oder der Notruf obligat. Hierauf ist im betrieblichen Bereich Wert zu legen, da die für die Behandlungskosten zuständigen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hier so wenig wie möglich Folgeschäden und Kosten riskieren wollen. Als Bauhofleiter sollten Sie also klar kommunizieren, dass Wunden korrekt versorgt, dokumentiert und ggf. der Mitarbeiter in eine geeignete Behandlungseinrichtung durch den Rettungsdienst gebracht wird.
Sonderfall Gefahrgut {Gefahrgut}
Sollten Sie orange und weiße Warntafeln sehen, ist höchste Vorsicht geboten. Abstand halten, Windrichtung beachten (Wind muss in Ihren Rücken wehen) und ggf. schnell flüchten. Grundregel: Läuft der Fahrer des Gefahrgut-Lkws weg – rennen auch Sie weg. Angaben auf den Warntafeln nur dann ablesen, wenn es gefahrlos möglich ist; bitte aber im Notruf angeben, dass Warntafeln an einem der verunglückten Fahrzeuge vorhanden sind, damit entsprechende Feuerwehrfahrzeuge alarmiert werden können.
Eigenschutz
Gefährden Sie sich niemals selbst, sondern achten Sie auf Ihren Eigenschutz. Bei Unfällen mit Maschinen ist es wichtig, diese abzuschalten, stromlos zu machen und gegen versehentliches Wiedereinschalten zu sichern. Auch das Fixieren von Baumaschinen nach einem Unfall gehört zum Eigenschutz und rettet ggf. Ihnen und dem Betroffenen das Leben. Bei einer Wundversorgung tragen Sie bitte immer Handschuhe – es dient dem beiderseitigen Schutz. Ein überstürztes „Reingrapschen“ in die Wunde bringt keinen Vorteil. Fordern Sie den Verletzten auf, selbst auf die Wunde (ggf. mit einem Tuch, Kleidungsstück, ...) zu drücken und Arm oder Bein hochzulagern. Daraufhin folgt das Verbinden mit Handschuhen und keimfreien Material aus dem Verbandkasten.
Versicherung der Ersthelfer
Ersthelfer sind persönlich und materiell über die jeweilige Landesunfallkasse versichert (SGB VII § 2 „Versicherungskraft Gesetz“; Absatz 1, Nummer 13a). Sofern Ersthelfer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch handeln, sind sie sowohl strafrechtlich (gem. Strafgesetzbuch) als auch haftungsrechtlich (gem. Bürgerlichem Gesetzbuch) nicht zu belangen. Da man Ersthelfern grundsätzlich das „Handeln nach bestem Wissen und Gewissen“ attestiert, ist die Kategorisierung einer Ersthelfermaßnahme als „grob fahrlässig“ oder „vorsätzlich“ falsch durchgeführt realistisch sehr, sehr unwahrscheinlich.
Abrechnung eines Rettungseinsatzes
Sollten Sie die Notfallsituation fehlinterpretiert haben, entstehen Ihnen keine Kosten. Ein Rettungstransport wird immer über die Krankenkasse des Patienten oder die Berufsgenossenschaft des Betriebes und daher nie über die Ersthelfer abgerechnet.
Ihr Recht auf Schulung – Ihre Pflicht zur Dokumentation
Die Unfallversicherungsträger bieten für ihre angehörigen Betriebe die Bezahlung der Erste-Hilfe-Ausbildung und der Erste-Hilfe-Auffrischung (innerhalb von 24 Monaten nach absolvierter Ausbildung) an. Ab 2015 ist die Grundausbildung wie die Auffrischung nur noch eintägig. In operativen Betrieben sind es 10 % der jeweils anwesenden Belegschaft, die geschult werden muss. Planen Sie hierbei auch Fluktuation und Krankheit des Personals ein. Informieren Sie sich darüber hinaus über Qualifizierungsmöglichkeiten für Ihre Mitarbeiter, z. B. als Fachkraft für Arbeitssicherheit, und schaffen Sie somit einen festen Ansprechpartner auf Ihrem Bauhof für die Themen Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Brandschutz.
Verbandbücher
Zu Ihrer Verpflichtung seitens der Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen gehört auch die Führung von Verbandbüchern. Hierin wird jede (!) Verletzung dokumentiert, um bei späteren Arbeitsausfällen beweisen zu können, dass es sich um einen Arbeitsunfall gehandelt hat. Weisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig in Sicherheitsunterweisungen auf ihre Berufsgenossenschaft hin. Dazu gehört auch der Hinweis, dass Unfälle auf direktem Wege zur oder von der Arbeit Wegeunfälle sind und somit auch über die Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen abzurechnen sind.
Rechtliche Grundlagen
§ 323c Strafgesetzbuch „Unterlassene Hilfeleistung“
„Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr (…) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“ Sie müssen also helfen, aber nur im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und ohne sich selbst zu gefährden. Ein Notruf ist daher (fast) immer möglich.