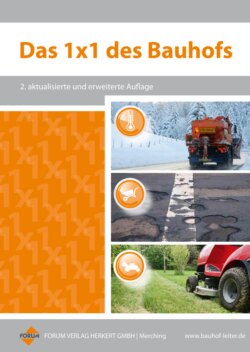Читать книгу Das 1x1 des Bauhofs - Inga Dora Meyer, Christian Borzym - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBaumkontrollen
{Baumkontrollen}
Organisation der gemeindlichen Baumpflege {Baumpflege, gemeindliche}
Eine Gemeinde ist prinzipiell für alle Bäume verkehrssicherungspflichtig, die auf Grundstücken in gemeindlichem Eigentum stehen. Welchem konkreten Zweck diese Grundstücke dienen (Straße, Sport- und Grünanlage, Friedhof, Kindergarten), ist dabei ohne Belang. Wer innerhalb der Gemeinde zuständig ist, legt die Gemeinde üblicherweise mit Geschäfts- und Arbeitsverteilungsplänen eigenverantwortlich fest. Danach kann sie bestimmen, dass bspw. das Grünflächenamt mit seiner Gärtnergruppe für sämtliche Bäume auf gemeindlichen Grundstücken zuständig ist. Andere Festlegungen wiederum sehen vor, dass der Bauhof namentlich für die Straßenbäume verantwortlich ist. Zur Haftungsvermeidung sind in jedem Fall eine klare und eindeutige Festlegung der Zuständigkeiten sowie eine effektive Organisationsstruktur erforderlich. Die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Hierfür müssen die finanziellen Mittel sowie eine ausreichende Personal- und Sachausstattung vorhanden sein. Allgemeine Finanzknappheit ist kein Entschuldigungsgrund für eine unterbliebene Verkehrssicherung.
Allgemeines zur Durchführung der Kontrollen
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Baumkontrollen grundsätzlich nur an Stellen durchzuführen, an denen auch ein Verkehr stattfindet. Dies betrifft vor allem Bäume an Straßen, in öffentlichen Grünanlagen, auf Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen, an Kindergärten und Schulen und in Wohnanlagen. Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen richten sich generell nach den im Einzelfall vorhersehbaren Risiken und danach, welche Vorkehrungen aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten geboten sind. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere (vgl. Breloer, Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen, 6. Auflage 2003, 12):
Zustand des Baumes (Alter, Baumart, Vorschädigungen, Vitalität)
Standort des Baumes (z. B. an einer öffentlichen Straße, in einer öffentlichen Parkanlage, neben baulichen Anlagen, an privaten Waldwegen oder im Waldbestand)
Art des Verkehrs (Verkehrsbedeutung und Verkehrshäufigkeit bei öffentlichen Straßen, fließender oder ruhender Verkehr, Kfz- oder Fahrradverkehr)
berechtigte Sicherheitserwartungen des jeweiligen Benutzers (mit welchen Gefahren muss der Benutzer rechnen und welche kann er erkennen; stark frequentierte Straße oder öffentlicher Feldweg, innerörtliche Parkanlage oder naturbelassener Steig im Wald)
Art der drohenden Schadensfolgen (Sachschäden oder auch Körperschäden, Schadenshöhe)
Zumutbarkeit der erforderlichen Maßnahmen (Berücksichtigung von Kosten und ökologischen Interessen an der Erhaltung von Baumbeständen; je größer die Wahrscheinlichkeit der Schädigung und je schwerer der drohende Schaden ist, desto höher ist das Maß des wirtschaftlich Zumutbaren)
Status des Verkehrssicherungspflichtigen (die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht sind bei einer Behörde höher als bei einer Privatperson)
Im Ergebnis ist eine Gesamtabwägung aller Gesichtspunkte vorzunehmen.
Die Regelkontrolle {Regelkontrolle}
Häufigkeit der Kontrollen
Nach der bislang überwiegenden oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei Bäumen an gewidmeten öffentlichen Straßen eine zweimalige Regelkontrolle im Jahr erforderlich. Diese soll einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand erfolgen. So können am besten alle möglichen Schäden erkannt werden. Welke Blätter sind nur während der Vegetationsperiode erkennbar, dagegen sind Faullöcher an Ästen oder am Stamm besser im unbelaubten Zustand festzustellen.
Die generelle Forderung der Rechtsprechung nach einer zweimaligen Kontrolle im Jahr wird von Baumfachleuten überwiegend abgelehnt. Dem folgend stellt der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit einem privaten Grenzbaum fest, dass sich die gebotene Häufigkeit der Baumkontrollen nicht verallgemeinern lasse, sondern vom Alter und dem Zustand des Baumes sowie seinem Standort abhänge.
Die „Richtlinien zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen – Baumkontrollrichtlinien“ (Ausgabe 2010; herausgegeben von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)) enthalten im Abschnitt 5.3.2.2 ebenfalls differenzierte Regel-Kontrollintervalle, abhängig vom Alter des Baumes, seines Zustands und seines Standorts. Danach werden selbst ältere, stärker geschädigte Bäume an stärker frequentierten Straßen nur einmal im Jahr kontrolliert.
Die Standardkontrolle bei gesunden oder nur leicht geschädigten Bäumen mittleren Alters, die an stärker frequentierten Straßen oder in belebten Grünanlagen stehen, findet alle zwei Jahre statt (jeweils abwechselnd im belaubten und im unbelaubten Zustand).
Neue Urteile halten die starre zweimalige Kontrolle im Jahr mittlerweile für überholt und gehen davon aus, dass die FLL-Baumkontrollrichtlinien die Regeln der Technik auf dem derzeitigen Stand wiedergeben. Allerdings hat sich diese Ansicht sind noch nicht bei allen Gerichten durchgesetzt.
Wer den FLL-Baumkontrollrichtlinien folgen möchte, muss als Erstes seinen Baumbestand ermitteln und eine Grunderfassung zur Festlegung der Kontrollintervalle durchführen. Hierfür bietet sich i. d. R. die Einrichtung eines Baumkatasters an.
Davon unabhängig sind zusätzliche Kontrollen immer vorzunehmen, wenn besondere Ereignisse wie Sturm oder starke Gewitter Beeinträchtigungen der Standsicherheit usw. befürchten lassen.
Bei privaten, d. h. nur tatsächlich öffentlichen Wegen in freier Landschaft und im Wald ist zu berücksichtigen: Nach § 69 BNatSchG und § 14 Abs. 1 Satz 1 BWaldG ist das Betreten der freien Natur und des Waldes zu Erholungszwecken jedermann gestattet. Die Ausübung dieses Rechts erfolgt allerdings auf eigene Gefahr (§§ 60 Satz 1 BNatSchG, 14 Abs. 1 Satz 3 BWaldG i. V. m. den Landeswaldgesetzen). Dies gilt namentlich für naturtypische bzw. waldtypische Gefahren (§§ 60 Satz 3 BNatSchG, 14 Abs. 1 Satz 4 BWaldG). Danach gibt es insbesondere keine Verpflichtung, die Besucher vor baumtypischen Gefahren zu schützen, z. B. vor Totholz. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für die Verkehrssicherung von Bäumen an gewidmeten öffentlichen Straßen sind auf private Wege in der freien Landschaft oder im Wald nicht übertragbar. Regelmäßige Baumkontrollen sind hier den Grundstückseigentümers nicht zumutbar. Dies gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich auch dann, wenn diese Wege stark frequentiert werden. Hat der Eigentümer allerdings Kenntnis von einer massiven akuten Gefahrenlage, ist ihm die Beseitigung dieser Gefahr anzuraten. Eine Verkehrssicherungspflicht auch für naturtypische bzw. waldtypische Gefahren besteht in der Umgebung von Erholungseinrichtungen wie beispielsweise Ruhebänken, Grillplätzen, Trimm-Dich-Pfaden.
Der Umfang der Regelkontrolle
Die Regelkontrolle findet in der Form einer Sichtkontrolle statt. Hierbei handelt es sich um eine äußere Besichtigung, die der Gesundheits- und Zustandsprüfung des Baumes zur Feststellung seiner Stand- und Bruchsicherheit dient. Sie stellt die erste Stufe der Baumkontrolle dar. Die Kontrolle erfolgt grundsätzlich vom Boden aus. Bei sehr hohen Bäumen bietet sich die Zuhilfenahme eines Fernglases an. Eine Kontrolle aus einem fahrenden Fahrzeug genügt nicht. Der Baum ist nach Möglichkeit von allen Seiten fußläufig zu prüfen. Dabei sollte er zunächst aus größerer Entfernung betrachtet werden, dann aus der Nähe.
Auch wenn es in erster Linie eine bloße Inaugenscheinnahme des Baumes ist, hat sich das Mitführen einfacher Werkzeuge, wie zum Beispiel eines Schonhammers, Splintmessers oder eines Sondierstabs, bewährt. So kann bereits im Rahmen der Sichtkontrolle der eine oder andere nicht sicher einzuordnende Defekt vollständig geklärt werden.
Die Durchführung der Kontrolle
Wichtig ist, ob verdächtige Umstände erkennbar sind, die nach der Erfahrung auf eine besondere Gefährdung durch den Baum hindeuten. Die optische Kontrolle erfasst die Teilbereiche Krone, Stamm, Wurzeln und das Baumumfeld.
Klassische Schadensindizien sind im Sommer v. a. welkes Laub und absterbende dürre Äste. Zu achten ist generell auf Pilzbefall, Faullöcher an Ästen und am Stamm, Verfärbungen, äußere Verletzungen, schlechten Allgemeinzustand, ungünstige Stellung, v-förmige Zwiesel usw. Im Sommer können Bäume aufgrund von Hitze oder Wassermangel ein lichtes Kronenbild oder Kronenverfärbungen aufweisen. Die Ursache hierfür kann aber auch in größeren Baumaßnahmen mit Aufgrabungen im Wurzelbereich liegen. Der Stammfuß ist ebenfalls zu untersuchen, wobei gegebenenfalls Moos, abgestorbene Rinde und Gras zu entfernen sind. Hierfür bietet sich die Kontrolle im Sommer an, da dies im Winter bei geschlossener Schneedecke nicht durchführbar ist. Damit der Kontrolleur nichts übersieht, empfiehlt sich die Verwendung einer Checkliste, anhand derer die einzelnen relevanten Punkte abgearbeitet werden können (vgl. z. B. FLL-Baumkontrollrichtlinien Abschnitt 5.3.2.1, S. 24). Bei Bäumen an Straßen sind zudem die Freihaltung des Lichtraumprofils sowie die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen wichtig.
Weiteres Vorgehen
Werden bei der Regelkontrolle keine Anzeichen für eine Gefährdung durch den Baum festgestellt, besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Wenn dagegen Schadensindizien vorhanden sind, muss festgelegt werden, was weiter zu veranlassen ist. Ist zweifelhaft, ob die erkannten Mängel die Verkehrssicherheit beeinträchtigen oder besteht eine Unsicherheit hinsichtlich der zu treffenden Maßnahmen, ist eine eingehende fachliche Untersuchung des Baumes erforderlich. Diese weitergehenden Maßnahmen stellen die zweite Stufe der Baumkontrolle dar und müssen von eigenen oder externen, besonders qualifizierten Fachleuten (Baumpfleger, Baumsachverständige) durchgeführt werden. Unter Umständen reicht aber auch eine weitere Sichtkontrolle z. B. mittels Hubsteiger aus, um das Ausmaß des Schadens besser beurteilen zu können.
Die bei einer Sichtkontrolle erkannten Mängel (insbesondere Totholz) müssen je nach Gefährdungslage unverzüglich bzw. in einem angemessenen Zeitraum beseitigt werden.
Dokumentation der Kontrolle
Die Gemeinde hat in einer gerichtlichen Auseinandersetzung ggf. nachzuweisen, dass sie ihrer Verkehrssicherungspflicht inhaltlich und zeitlich nachgekommen ist. Es ist deshalb unabdingbar, dass der Baumkontrolleur die Kontrolle dokumentiert. Dies sollte schriftlich mit Unterschrift geschehen, vorzugsweise mit entsprechenden Formblättern (z. B. Musterkontrollblatt der FLL-Baumkontrollrichtlinien, S. 49 ff.). Alternativ können mobile Erfassungsgeräte (Handhelds) mit speziellen Erfassungsprogrammen verwendet werden. Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs der Dokumentation ist zu unterscheiden: Liegen keine Anzeichen für eine mangelnde Verkehrssicherheit vor, ist die Kontrolle in Form einer Negativkontrolle ohne Einzelbaumerfassung zulässig. Es reicht ein Festhalten des Begehungstermins sowie des Standorts des kontrollierten Baumes oder – im Falle mehrerer Bäume oder ganzer Bestände – die Bezeichnung des kontrollierten Gebiets (z. B. Straßenname, Spielplatz, Schulgelände). In jedem Fall muss ersichtlich sein, wer die Kontrolle durchgeführt hat. Sind an einem Baum jedoch Maßnahmen zur Verkehrssicherheit erforderlich, müssen genauere Angaben erfolgen. Neben Termin und Standort sind aufzunehmen: Baumnummer, Baumart, Stammdurchmesser (wenn kein Baumkataster vorhanden ist, um den Baum wieder finden zu können), Höhe, Vitalität, festgestellte Schäden, weiterer Untersuchungsbedarf, erforderliche Maßnahmen, Hinweise für zukünftige Kontrollen.
Der Kontrolleur muss im Rahmen seiner Dokumentation entsprechende Zeitvorgaben machen, bis wann die erforderlichen Maßnahmen (auch eingehende Untersuchungen) durchzuführen sind. Die Dringlichkeit der Maßnahmen kann z. B. in den Stufen sofort, innerhalb von zwei Wochen, innerhalb von sechs Monaten oder innerhalb der nächsten zwei Jahre festgelegt werden.
Durch eine entsprechende Organisation beim Bauhof muss sichergestellt werden, dass die Aufschreibungen auch tatsächlich durchgeführte Kontrollen repräsentieren und nicht nur „Phantomüberprüfungen" darstellen. Der Vorgesetzte der Baumkontrolleure hat insoweit eine Kontroll- und Überwachungspflicht. Dringend zu empfehlen sind Dienstanweisungen, aus denen sich insbesondere ergibt, wer für die Kontrolle zuständig ist, wie der Kontrollnachweis geführt wird, wie zu kontrollieren ist, wie oft (Kontrollzeitraum), welchen Umfang die Kontrolle haben muss und wer was wann zu tun hat, wenn Mängel festgestellt werden.
Bei vorgeschädigten Bäumen mit hohem Gefahrenpotenzial empfiehlt sich die Führung einer eigenen Risikoliste, um die Vornahme regelmäßiger Sonderüberprüfungen überwachen und ggf. auch nachweisen zu können. Hier kann auch ein Baumkataster gute Dienste leisten, in dem die Bäume, soweit sie Dritte gefährden können, erfasst sind. Anhand dieses Katasters können dann je nach Alter der Bäume, Verkehrsbedeutung des Standorts usw. das Gefährdungspotenzial eingeschätzt und die Intensität der Kontrollen festgelegt werden.
Methoden der Baumkontrolle
Die Regelkontrolle erfolgt generell als Sichtkontrolle. Im Rahmen dieser Sichtkontrolle findet vielfach die von Mattheck begründete VTA-Methode (Visual Tree Assessment = visuelle Baumbeurteilung oder qualifizierte Sichtkontrolle) Anwendung. Sie stellt vorrangig auf das mechanisch gesteuerte Wachstum der Bäume mit seinen natürlichen Gesetzmäßigkeiten ab und zeigt zudem, auf welche Weise die Bäume bemüht sind, ihre Schäden zu reparieren. Die Defektsymptome der Bäume wie zum Beispiel Fäule, Risse usw. werden dabei als Warnsignale in der Körpersprache der Bäume begriffen. Die Rechtsprechung hat z. T. ausdrücklich die VTA-Methode als sachgerechte Methode anerkannt. In der baumfachlichen Literatur gibt es allerdings auch Vorbehalte, vgl. Schulz AUR 2009, 394. Der in der Literatur ebenfalls bestehende Methodenstreit zwischen VTA-Methode und den Methoden mit Zugversuchen zur Standsicherheitsbestimmung (z. B. Elasto-, Inclino-Methode) wirkt sich in erster Linie auf der zweiten Stufe bei den eingehenden Untersuchungen aus.
Fachliche Kenntnisse eines Baumkontrolleurs {Baumkontrolleur}
Die Regelkontrolle durch Sichtprüfung erfordert entsprechend geschulte und praktisch eingearbeitete Kräfte, jedoch nicht den Einsatz von Holz-, Baum- oder Forstfachleuten. Der Baumkontrolleur muss aber zumindest über ausreichende Fachkenntnisse verfügen (z. B. bietet die FLL einen Lehrgang zum „FLL-zertifizierten Baumkontrolleur“ an), die er regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen hat. Er muss Schäden und Schadsymptome in der Krone, am Stamm und im Bodenbereich erkennen und beurteilen können, ob eine Verkehrsgefährdung gegeben ist. Zudem wird verlangt, dass er in der Lage ist, einen Pilzbefall zum Beispiel durch den Brandkrustenpilz zu erkennen. Aktuelle Baumkrankheiten wie das Eschentriebsterben müssen ihm geläufig sein. Die insoweit notwendige Fortbildung hat der Vorgesetzte bzw. die Gemeinde als Arbeitgeber dem Baumkontrolleur zu ermöglichen.
Die konsequente Beachtung der obigen Ausführungen hilft, Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht und damit zivilrechtliche und strafrechtliche Haftungsfälle zu vermeiden.
Beachtung des Natur- und Artenschutzes
Bei der Baumkontrolle bzw. -pflege sind die Regelungen des Natur- und Artenschutzes zu beachten. Naturschutzrechtliche Vorgaben können sich zunächst einmal aus kommunalen Baumschutzregelungen nach § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG ergeben (Baumschutzsatzungen/-verordnungen). Zu beachten sind weiterhin die Anforderungen des allgemeinen Artenschutzes insbesondere nach § 39 BNatSchG. Gemäß § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Im Verbotszeitraum generell zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Hs. 2 BNatSchG).
§ 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG führt zudem Ausnahmen von den Verboten des Satzes 1 Nr. 2 auf. Danach gelten die Verbote nicht für behördlich angeordnete Maßnahmen (Nr. 1). Hierunter fallen insbesondere Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Ebenso wenig greifen sie bei Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, und zwar dann, wenn sie behördlich durchgeführt werden oder behördlich zugelassen sind oder der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen (Nr. 2).
Praktisch bedeutsam sind vor allem die Vorschriften des besonderen Artenschutzes, die in § 44 BNatSchG geregelt sind. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verbietet bei wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten die Zerstörung aktueller oder regelmäßig genutzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Zu diesen besonders geschützten Arten zählen beispielsweise nahezu alle heimischen Säugetierarten (u. a. die in Bäumen lebenden Eichhörnchen und Siebenschläfer), alle Fledermausarten sowie bestimmte Holzinsekten wie der Rosenkäfer. Darüber hinaus sind sämtliche europäische Vogelarten besonders geschützt. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG untersagt bei streng geschützten Arten jede erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten. Unter diesen Schutz fallen insbesondere alle europäischen Vogelarten, alle Fledermausarten sowie bestimmte Holzinsekten wie z. B. der Eremit.
Von den Verboten des § 44 BNatSchG kann aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt werden. Ihre Erteilung liegt im Einzelfall im Interesse der Gesundheit des Menschen bzw. der öffentlichen Sicherheit (§ 45 Abs. 7 Nr. 4 BNatSchG). Voraussetzung hierfür ist, dass der Erhaltungszustand der Population einer Art sich dadurch nicht verschlechtert und keine zumutbare Alternative vorhanden ist (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). Die frühzeitige Beteiligung der Naturschutzbehörde ist zu empfehlen. Verstöße gegen Artenschutzrecht sind bußgeldbewehrt (§ 69 BNatSchG).