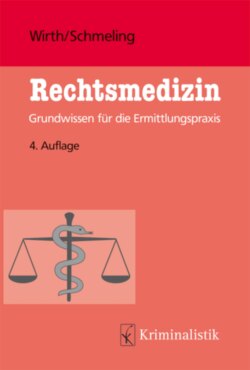Читать книгу Rechtsmedizin - Ingo Wirth - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Rechtsmedizin und Kriminalistik
ОглавлениеDie Rechtsmedizin, auch Gerichtliche Medizin genannt, gehört zu den ältesten Spezialfächern der Medizin und ist durch gemeinsame Aufgaben mit der Kriminalistik eng verbunden. Den Zusammenhang zwischen beiden Wissenschaftsgebieten verdeutlicht die Definition der Rechtsmedizin: Es ist diejenige medizinische Disziplin, „die in Lehre, Forschung und Praxis die Anwendung medizinischer Kenntnisse und Methoden zur Klärung rechtserheblicher Tatbestände zum Inhalt hat“.[1]
Der Rechtsmediziner ist ein Arzt, der nach dem Medizinstudium eine mehrjährige Weiterbildung zum Facharzt absolviert und mit einer Prüfung vor der zuständigen Ärztekammer abschließt. Aufgrund seiner Spezialkenntnisse wird er hauptsächlich für Polizei und Justiz als Sachverständiger tätig. Die Berufsbezeichnungen Rechtsmediziner und Gerichtsarzt werden oft synonym verwendet. Streng genommen, handelt es sich beim Gerichtsarzt jedoch um einen zur Wahrnehmung ärztlicher Tätigkeiten in gerichtlichen Angelegenheiten bestellten Arzt, der nicht zwingend Facharzt für Rechtsmedizin sein muss.
Bedingt durch die Vielfalt ihrer Aufgaben, berührt die Rechtsmedizin praktisch alle Fachgebiete der Medizin. Die Pathologie, speziell die Pathologische Anatomie als Lehre von den krankhaften Organveränderungen, steht der Rechtsmedizin am nächsten. Die Vertreter beider Fachgebiete führen Leichenöffnungen zur Feststellung der Todesursache aus. Dem Pathologen obliegt die Untersuchung natürlicher Todesfälle. Häufige Ursachen sind Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Die Begutachtung nichtnatürlicher Todesfälle ist Aufgabe des Rechtsmediziners. Zum nichtnatürlichen Tod gehören sämtliche durch äußere Gewalteinwirkung bedingte Todesfälle, beispielsweise durch Messerstiche, Erhängen oder Ertrinken, sowie die Vergiftungen.
Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren wesentlichen Unterschied. Der Pathologe arbeitet eng mit klinisch tätigen Ärzten, wie Chirurgen und Internisten, zusammen. Durch die Mitwirkung beim Erkennen und Behandeln von Krankheiten kommen seine Untersuchungsbefunde auch Lebenden zugute. Der Rechtsmediziner hingegen verwendet seine Untersuchungsergebnisse vorrangig für die Rekonstruktion des zum Tod führenden Geschehens. Dazu reicht die Feststellung der Todesursache allein nicht aus. Beispielsweise interessiert bei einem Kopfdurchschuss zwar auch die Frage, ob der Tod unmittelbar durch die Hirnverletzung oder mittelbar durch eine Bluteinatmung verursacht wurde. Viel wichtiger ist es aber, aus den Untersuchungsbefunden Hinweise auf die Schussentfernung, die Schussrichtung und die Handlungsfähigkeit des Getroffenen sowie Anhaltspunkte für eine Selbst- oder Fremdbeibringung abzuleiten. Folglich setzt die Tätigkeit des Rechtsmediziners eine kriminalistische Denk- und Arbeitsweise voraus.
Abhängig von der konkreten Aufgabenstellung werden in der Rechtsmedizin Erkenntnisse und Methoden anderer medizinischer Fachgebiete genutzt. Das gilt besonders für die Traumatologie, die Lehre von den Verletzungen. Die Forensische[2] Traumatologie als Teilgebiet der Rechtsmedizin beschäftigt sich mit dem Zustandekommen und den Folgen mechanisch verursachter Körperschädigungen. Der plötzliche natürliche Tod im Säuglings- und Kleinkindalter führt in den Bereich der Kinderheilkunde. Um Fälle von Abtreibung und verheimlichter Geburt begutachten zu können, muss Wissen aus dem Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe herangezogen werden. Schließlich treten vereinzelt Todesfälle im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen auf. Dann trägt die gerichtliche Leichenöffnung zur Aufklärung der Sachlage bei. Auch wenn der Rechtsmediziner den Todesfall nicht selbst untersucht hat, kann er mit einer Begutachtung nach Aktenlage beauftragt werden.
Manchmal reicht ärztliches Wissen allein nicht aus, um einen Fall vollständig aufzuklären. So kann der Rechtsmediziner aufgrund seiner Kenntnisse der menschlichen Anatomie aus einem Knochenfund all die Skelettteile herausfinden und bestimmen, die vom Menschen stammen. Die Zuordnung von Tierknochen dagegen nimmt der Veterinäranatom vor.
Auch mit den Naturwissenschaften steht die Rechtsmedizin in enger Beziehung. Das betrifft insbesondere die Chemie, denn der Giftnachweis im menschlichen Körper erfolgt vorwiegend mit chemischen Methoden. Das entsprechende Spezialgebiet heißt Toxikologische Chemie, die auch die Alkohol- und Drogenanalytik einschließt. Die Toxikologie ist die Lehre von den Giften und Vergiftungen. Als Teilgebiet der Rechtsmedizin werden die rechtlich bedeutsamen Aspekte von Vergiftungen unter der Bezeichnung Forensische Toxikologie zusammengefasst. Speziell bei Vergiftungen mit Medikamenten ergeben sich wiederum Berührungspunkte zu einem medizinischen Fachgebiet. Es handelt sich um die Pharmakologie, die Lehre von den Arzneimitteln.
Einige Gesetzmäßigkeiten aus der Physik bilden die Grundlage für das Verständnis der Knochenbruchmechanik sowie für die Erklärung von Verletzungen durch Schuss, Elektrizität und Strahlung. Den Wissensbestand der Zoologie nutzt der Rechtsmediziner unter anderem, um die Verursacher von Tierfraß an menschlichen Leichen herauszufinden. Wenn die Herkunft pflanzlicher Bestandteile des Mageninhalts Verstorbener bestimmt werden muss, sind Kenntnisse aus der Botanik notwendig.
Der Rechtsmediziner untersucht nicht nur Leichen, sondern muss auch Lebende nach Straftaten begutachten, beispielsweise nach Schlägereien, Sexualdelikten oder Kindesmisshandlungen. Das Gutachten stützt sich neben den rechtsmedizinischen Untersuchungsergebnissen je nach Sachlage auf Befunde aus anderen medizinischen Fachgebieten, wie Intensivmedizin, Chirurgie, Frauen- oder Kinderheilkunde. Es genügt jedoch nicht, vorhandene Verletzungen am Körper eines Opfers oder eines Tatverdächtigen lediglich festzustellen und nach medizinischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Vielmehr wird vom Rechtsmediziner erwartet, dass er bei der Begutachtung die im Strafrecht vorgeschriebenen Kriterien berücksichtigt. Das Gericht muss sich auf die gesetzesgemäße Interpretation der medizinischen Befunde verlassen können. Aus diesem Grund sind für den Rechtsmediziner fundierte Rechtskenntnisse, besonders des Strafrechts, unverzichtbar.
Die Anwendung medizinischen Wissens im Dienst der Rechtspflege schließt Probleme der Forensischen Psychiatrie ein. Dieses Fach hat seine historischen Wurzeln in der Rechtswissenschaft und in der Rechtsmedizin. Nach heutigem Verständnis ist die Forensische Psychiatrie ein Spezialgebiet der Psychiatrie, das sich mit den fachspezifischen Begutachtungsfragen und mit der Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher befasst. In der Begutachtungspraxis wird das Fach teils durch Psychiater, teils durch speziell ausgebildete Rechtsmediziner vertreten.
Die Grundlage psychiatrischer Beurteilung und psychiatrischen Handelns bildet die Psychopathologie. Wesentliche Aufgaben der Psychopathologie sind die Erkennung und Beschreibung einzelner psychischer Auffälligkeiten und deren Ordnung zu immer wieder beobachtbaren Symptomenkomplexen. Psychopathologische Exploration und Verhaltensbeobachtung gehören zu den grundlegenden Untersuchungsmethoden des forensisch tätigen Psychiaters.
Den wichtigsten Beitrag zur Kriminalistik leistet der Rechtsmediziner durch seine Mitwirkung bei Todesermittlungssachen. Im Idealfall beginnt die Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsbeamten und Rechtsmediziner mit der Ereignisortuntersuchung, setzt sich fort bei der gerichtlichen Leichenöffnung mit der gemeinsamen Erörterung von Ermittlungsergebnissen und Obduktionsbefunden und reicht bis zur Bestätigung oder Widerlegung von Aussagen. Bei Tötungsverbrechen ist es unerlässlich, dass der Rechtsmediziner bereits am Tat- oder Fundort mit seinen Untersuchungen beginnt. Von ihm erwarten die Kriminalisten gleich an Ort und Stelle erste Aussagen zur Todeszeit, zur Todesursache und zum Hergang der Tat. Weitere wesentliche Informationen erbringt die gerichtliche Leichenöffnung. Dabei ist die Anwesenheit eines verantwortlichen Ermittlungsbeamten erforderlich. Aus dem Ergebnis der Leichenöffnung können sich Anhaltspunkte für die Rekonstruktion des Tathergangs, für eine weitere Suche und Sicherung von Spuren und Vergleichsmaterial sowie für Vernehmungen ergeben. Die Kenntnis der Tatortsituation erleichtert die Interpretation der Untersuchungsergebnisse und ist durch noch so gute Fotografien nicht zu ersetzen.
Die Rechtsmediziner teilen ihre Auffassung zum untersuchten Todesfall den Ermittlungsbeamten in einem Vorläufigen Gutachten mit. Vorläufig deshalb, weil darin nur der erste Eindruck wiedergegeben werden kann. Ein zusammenfassendes Gutachten ist erst nach Abschluss aller Zusatzuntersuchungen, vor allem mikroskopischer und toxikologischer Untersuchungen, und der kriminalistischen Ermittlungen möglich.
Heute stellt die Mitwirkung des Rechtsmediziners bei der Aufklärung von Tötungsverbrechen eine Selbstverständlichkeit dar. Mindestens genauso wichtig ist es aber, ihn bei unerwarteten und unklaren Todesfällen möglichst frühzeitig hinzuzuziehen. Nach wie vor bildet eine sachkundig und sorgfältig durchgeführte Leichenschau die entscheidende Voraussetzung für die Aufdeckung latenter Tötungsdelikte wie auch anderer nichtnatürlicher Todesfälle.
Für die rechtsmedizinische Rekonstruktion tödlicher Verkehrsunfälle ist die gerichtliche Leichenöffnung die wichtigste Untersuchungsmethode, aber allein nicht ausreichend. Um ein verwertbares rekonstruktives Ergebnis zu erreichen, sollte auf eine Besichtigung des Unfallortes und der Unfallfahrzeuge durch den Rechtsmediziner sowie auf seine Mitwirkung bei der Spurensicherung nicht verzichtet werden.
Im Rahmen der Todesermittlung ist es notwendig, die Identität des Verstorbenen zweifelsfrei festzustellen. Die Identifizierung von Leichen und Leichenteilen erfordert unter bestimmten Umständen die Anwendung rechtsmedizinischer Untersuchungsmethoden. Dabei werden traditionell Erkenntnisse aus der Anatomie, Anthropologie, Zahnheilkunde und Röntgendiagnostik genutzt. Die Identifizierung unbekannter Toter durch den Rechtsmediziner beschränkt sich nicht auf Einzelfälle, sondern er kommt auch nach Katastrophen mit einer Vielzahl von Leichen zum Einsatz.
Die Fortschritte der Molekularbiologie haben das Methodenspektrum von Rechtsmedizin und Kriminalistik außerordentlich erweitert. Aus der DNS-Forschung resultierten nicht nur für die Identifizierung unbekannter Toter neue Möglichkeiten. Weitaus stärker wurde die forensische Spurenuntersuchung durch die Einführung molekularbiologischer Verfahren bereichert. Aufgrund der zunehmenden Verfeinerung der spurenkundlichen Untersuchungsmethoden sind Rechtsmediziner und Kriminaltechniker immer mehr auf eine Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten angewiesen, so Biochemiker, Molekularbiologen, Humangenetiker, Biostatistiker, Biophysiker und Informatiker. Deshalb ist eine fachübergreifende Kooperation aller Beteiligten eine wesentliche Voraussetzung für den Untersuchungserfolg.
Gerade in der Spurenkunde bestehen vielfältige Berührungspunkte zwischen der Rechtsmedizin einerseits und der naturwissenschaftlichen Kriminalistik andererseits. Während die Suche und Sicherung von Spuren unstrittig als Aufgaben der Kriminaltechnik angesehen werden, gibt es für die Untersuchung und Begutachtung von Spurenmaterial kein solches Monopol. Bedingt durch die historische Entwicklung und abhängig von der Leistungsfähigkeit der beteiligten Institutionen, werden Spuren menschlicher Herkunft, hauptsächlich Blut, Sekrete, Haut und Haare, entweder in einer kriminaltechnischen Einrichtung oder in einem Institut für Rechtsmedizin ausgewertet. Für die Zuständigkeit in diesem Bereich bestehen nach wie vor kontroverse Ansprüche. Doch mehr denn je gilt, dass es die „Hauptsache ist, die Aufgabe gut zu erledigen, Nebensache, wem die Erledigung zukommt“.[3]
Wie das Beispiel DNS-Analytik zeigt, müssen neue Methoden und Erkenntnisse aus anderen Wissenschaftsgebieten stets auf ihre Anwendbarkeit in Rechtsmedizin und Kriminalistik geprüft werden. So hat sich die ursprünglich für die Erforschung von Erbkrankheiten entwickelte Technik schon bald als überaus wertvoll für die forensische Spurenuntersuchung erwiesen.
Nicht zuletzt ergeben sich aus der Rechtspraxis häufig Problemstellungen, die eine wissenschaftliche Bearbeitung in der Rechtsmedizin erfordern. Bei manchen Todesfällen muss eingeschätzt werden, wann der Tod eines Menschen eintrat. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen der Abkühlung der Leiche und dem Zeitpunkt des Todeseintritts aufgezeigt, die eine Todeszeitschätzung erlauben. Solche rechtsmedizinischen Forschungen dienen ausschließlich einer kriminalistischen Zweckbestimmung. Die Forschungsergebnisse vergrößern den Fundus spezifischer Erkenntnisse und Methoden der Rechtsmedizin, über den in dieser Geschlossenheit kein anderes medizinisches Fachgebiet verfügt.
Die Rechtsmedizin ist Lehr- und Prüfungsfach im Medizinstudium. Somit erwirbt jeder Arzt rechtsmedizinische Grundkenntnisse, zumeist fehlen ihm aber Spezialwissen und praktische Erfahrungen. Für Studierende der Rechtswissenschaft gibt es an vielen Universitäten einen fakultativen rechtsmedizinischen Unterricht. Dem Kriminalbeamten wird vor allem in der Fortbildung rechtsmedizinisches Wissen vermittelt.
Wie dargestellt, leistet der Rechtsmediziner seinen fachspezifischen Beitrag zur Klärung unterschiedlicher rechtserheblicher Sachverhalte. Er kann jedoch durch seine Mitarbeit den Ermittlungsbeamten nur unterstützen. „Der Aufbau des Beweisgebäudes liegt allein in der Hand des Kriminalisten.“[4]