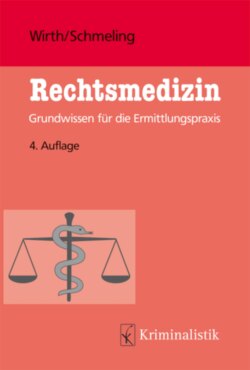Читать книгу Rechtsmedizin - Ingo Wirth - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. Tod und Leichenuntersuchung › 4. Ärztliche Leichenschau › 4.1 Feststellung des Todes
4.1 Feststellung des Todes
Rechtlich darf erst nach ärztlicher Diagnose und Bescheinigung des Todes von einer Leiche gesprochen werden. Nach medizinischer Auffassung gilt als Leiche der Körper eines Gestorbenen, gekennzeichnet durch Leichenerscheinungen. Juristischer Ansicht zufolge ist eine Leiche der Körper eines toten Menschen oder totgeborenen Kindes, solange er noch nicht zerfallen oder noch nicht Gegenstand des Rechtsverkehrs geworden ist (etwa Leichen oder Leichenteile für den Anatomieunterricht im Medizinstudium).
Bei Neugeborenen unterscheidet man zwischen
| • | Lebendgeborenen und |
| • | Totgeborenen. |
Als lebendgeboren gilt ein Kind, wenn nach der Trennung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen, die natürliche Lungenatmung eingesetzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, unabhängig von Länge und Gewicht des Kindes oder von der Dauer der Schwangerschaft. Wenn ein Lebendgeborenes verstirbt, gilt es rechtlich generell als Leiche.
Ein Kind ist totgeboren, wenn es nach der Trennung vom Mutterleib keines der maßgeblichen Zeichen eines Lebendgeborenen und ein Gewicht von mindestens 500 g aufweist. Unter dieser Voraussetzung gilt auch ein Totgeborenes rechtlich als Leiche. Demnach gilt nicht als Leiche eine Leibesfrucht unter 500 g Körpergewicht. Sie wird als Fehlgeburt, Frühgeburt oder Abort bezeichnet.
Die Feststellung des Todes ist dem Arzt als Aufgabe zugewiesen, weil dazu meist medizinische Kenntnisse erforderlich sind. Bei Eintreffen am Fundort hat sich der Arzt unverzüglich davon zu überzeugen, ob die Person noch lebt oder tot ist. Wenn keine sicheren Todeszeichen vorhanden sind, müssen Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden. Andernfalls kann der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung erhoben werden.
Die Forderung der Todesfeststellung wird durch den Nachweis sicherer Todeszeichen erfüllt. Im Allgemeinen sind frühestens 15 bis 20 Minuten nach dem Todeseintritt die ersten Totenflecke zu erwarten, Totenstarre und Fäulnis folgen erst deutlich später. Diese Leichenerscheinungen sind zuverlässige Kriterien für die sichere Feststellung des Todes. Das gilt ebenfalls für offensichtlich nicht mit dem Leben vereinbare Verletzungen, wie vollständige Schädelzertrümmerung, Abtrennung des Kopfes oder Rumpfdurchtrennung.
Zur Dokumentation des ärztlich festgestellten Todes finden sich auf einigen Todesbescheinigungen als ankreuzbare Kästchen folgende sichere Zeichen des Todes:
| • | Totenflecke, |
| • | Totenstarre, |
| • | Fäulnis, |
| • | Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind, |
| • | Hirntod. |
Es wird gefordert, dass vor dem Ausstellen der Todesbescheinigung mindestens eines der sicheren Todeszeichen deutlich ausgeprägt ist. Hält sich der Arzt konsequent an diese Forderung, besteht keine Gefahr, einen Lebenden für tot zu erklären. Zu beachten ist dabei, dass eine Kältestarre nicht als Totenstarre fehlgedeutet werden darf.
In einigen Bundesländern sind Ärzte im Rettungsdienst von ihrer Verpflichtung zur Durchführung einer vollständigen Leichenschau befreit. Ihre Pflicht beschränkt sich auf die Feststellung des Todes. Länderabhängig ist vom Notarzt außerdem eine Vorläufige Todesbescheinigung auszustellen. Bei Anhaltspunkten für einen nichtnatürlichen Tod hat auch der Notarzt sofort die Polizei zu informieren.
Bis in die Gegenwart wird immer wieder über die irrtümliche Ausstellung von Todesbescheinigungen in der Fachpresse wie auch in den Massenmedien berichtet. Diese Fälle sind insgesamt selten und ausnahmslos auf eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht zurückzuführen. Erfahrene Ermittlungsbeamte kennen aus der Praxis genügend Beispiele, bei denen der Leichenschauarzt nur einen flüchtigen Blick auf die leblose Person wirft und keine Untersuchung vornimmt. Ebenso kommt es vor, dass die Todesbescheinigung nach den Auskünften der Angehörigen ausgestellt wird, ohne die im Nebenzimmer liegende Person untersucht zu haben. Selbst aufgrund telefonischer Benachrichtigung entstanden schon Todesbescheinigungen.
Unter bestimmten Bedingungen können alle Lebenserscheinungen auf ein Minimum reduziert sein. Äußerlich lassen sich in solchen Fällen Atmung, Puls, Körperwärme und Reflexe kaum wahrnehmen, und es besteht eine tiefe, unter Umständen langdauernde Bewusstlosigkeit. Für diesen Zustand, bei dem die Unterscheidung zwischen Leben und Tod außerordentlich erschwert ist, wurde der Begriff Scheintod geprägt. Gelingt durch geeignete Behandlungsmaßnahmen die volle Wiederherstellung aller Lebensfunktionen, bedeutet das nicht die Erweckung eines Toten, sondern eines tief Bewusstlosen. Die medizinischen Fachausdrücke Vita reducta und Vita minima besagen, dass es sich um einen auf das Äußerste verminderten Zustand des Lebens handelt. Zur Feststellung von Lebenszeichen in solchen Fällen sind apparative Untersuchungen, wie Ableitung von Hirn- und Herzströmen, notwendig.
Die wichtigsten Ursachen für eine Vita minima werden unter der Buchstabenfolge A – E – I – O – U zusammengefasst. Dabei bedeuten:
| A | = | Alkoholvergiftung, Anoxie (Sauerstoffmangel), Anämie (Blutarmut). |
| E | = | Epilepsie, Ertrinken, Elektrizität, auch Blitzschlag. |
| I | = | Injury of head (Schädel-Hirn-Trauma). |
| O | = | Opium, gemeint Drogen- und Medikamentenvergiftungen. |
| U | = | Urämie (Harnvergiftung durch Nierenversagen) und andere komatöse Zustände (Koma = Zustand tiefer Bewusstlosigkeit), Unterkühlung. |
Bestimmte Zeichen berechtigen weder einzeln noch kombiniert zur Feststellung des Todes. Das sind
| • | Abkühlung (nicht gleichzusetzen mit Leichenkälte), |
| • | Muskelschlaffheit, |
| • | Hautblässe, |
| • | Reaktionslosigkeit der Pupillen, |
| • | Reflexlosigkeit, |
| • | Pulslosigkeit und |
| • | Atemstillstand. |
Diese Erscheinungen werden unsichere Zeichen des Todes genannt.
Durch sog. Lebensproben wollte man früher die Beweiskraft der unsicheren Todeszeichen erhöhen. Um den Atemstillstand nachzuweisen, wurde empfohlen, einen Spiegel vor Mund und Nase zu halten. Blieb ein Beschlagen aus, so meinte man damit den Beweis für den Atemstillstand erbracht zu haben. Zum selben Zweck wurde eine Feder vorgehalten, Seifenschaum aufgebracht oder ein randvoll gefülltes Wasserglas auf den Brustkorb gestellt. Das Erliegen der Herz-Kreislauf-Funktion sollte beispielsweise durch die Siegellackprobe festgestellt werden. Man tropfte heißen Siegellack auf die Haut und beobachtete, ob sich eine Hautrötung entwickelte. Wegen der Gefahr, dass eine Vita minima nicht erkannt wird, sind die genannten Lebensproben zur zweifelsfreien Feststellung des Todes unbrauchbar.
Die Angst vor dem Lebendig-Begrabenwerden im Zustand des Scheintodes resultierte nicht zuletzt aus der Fehldeutung von Leichenerscheinungen:
| • | Der Tote „schwitzt“ – in Wirklichkeit Kondenswasser auf der abgekühlten Leiche, |
| • | die Lage der Leiche verändert sich – in Wirklichkeit verursacht durch Eintreten und Lösen der Totenstarre, später durch Fäulnis, |
| • | „Totenlaute“ (Stöhnen oder Seufzer) sind zu hören – in Wirklichkeit eine Leichenerscheinung, bedingt durch das Hochdrücken des Zwerchfells infolge Fäulnisgasansammlung im Bauchraum mit Entweichen von Luft durch die Stimmritze, |
| • | die Aufrichtung des männlichen Gliedes – in Wirklichkeit Fäulnisgasansammlung im Gewebe der äußeren Geschlechtsorgane, |
| • | die Leiche lässt eine „ganz frische Haut“ und „neue Nägel“ erkennen – in Wirklichkeit Ablösung der Oberhaut zusammen mit den Nägeln infolge Fäulnis, sodass die rosig und feucht wirkende Lederhaut bzw. die Nagelbetten frei liegen, |
| • | eine verstorbene Schwangere „gebärt“ im Sarg ihr Kind – in Wirklichkeit kommt eine sog. Sarggeburt durch einen starken Fäulnisgasdruck im Bauchraum zustande, der ebenso einen Kotabgang an der Leiche bewirken kann. |
Bei Exhumierungen festgestellte Lageveränderungen der Leiche im Sarg sind zwanglos durch Umkippen oder Herunterstürzen bei unsachgemäßem Transport zu erklären.