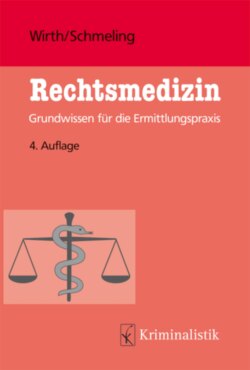Читать книгу Rechtsmedizin - Ingo Wirth - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Kriminalistische Leichenuntersuchung
ОглавлениеEine gerichtliche Leichenschau gemäß § 87 I StPO ist die Besichtigung der äußeren Beschaffenheit einer Leiche, die in der Regel vom Staatsanwalt oder auf dessen Antrag gemäß § 162 StPO vom Richter vorgenommen wird. Die Besichtigung des Leichnams sollte möglichst am Tat- oder Fundort durchgeführt werden (Nr. 33 I RiStBV). Die gerichtliche Leichenschau ersetzt nicht die ärztliche Leichenschau nach den landesrechtlichen Bestimmungen, die in jedem Fall erfolgen muss. Dadurch ist gesichert, dass jeder Verstorbene von einem Arzt untersucht wird.
In der Praxis muss der Ermittlungsbeamte regelmäßig eine Leichenschau am Fundort vornehmen. Vom Beamten wird keine medizinische, sondern eine kriminalistische Untersuchung der Leiche erwartet. Die Spezifik dieser Aufgabe liegt darin, die äußeren Leichenbefunde vollständig zu erfassen und darüber hinaus hinsichtlich ihrer Verursachung kriminalistisch zu bewerten. Auch wenn der Ermittlungsbeamte über Grundkenntnisse der Rechtsmedizin verfügt, sollte er nicht darauf verzichten, bei offensichtlichen Kapitalverbrechen und bei dubiosen Todesfällen so früh wie möglich einen Rechtsmediziner hinzuzuziehen.
Für die kriminalistische Leichenuntersuchung hat sich das Vorgehen nach einem Handlungsschema bewährt. Empfehlenswert ist das von Naeve (1978) angegebene Schema einer Leichenschau.
Handlungsschema für eine kriminalistische Leichenuntersuchung [1]
| 1. | Zeitpunkt des Beginns der Leichenschau (Datum, Uhrzeit). |
| 2. | Beschreibung der Leichenumgebung. Örtlichkeit: geschlossener Raum (Fenster geschlossen oder geöffnet), im Freien. Abdeckung der Leiche. Untergrund: trocken, nass, moorig u. a. Raum- bzw. Außentemperatur. Witterungsverhältnisse. Hinweise auf Einnahme von alkoholischen Getränken oder Medikamenten (Flaschen, Gläser, Verpackungsmaterial). Hinweise auf Erkrankungen (Arztbriefe, Rezeptformulare, Medikamente). |
| 3. | Beschreibung der Bekleidung: Kleidung geordnet oder ungeordnet? Knöpfe oder Reißverschlüsse geöffnet oder geschlossen? Knöpfe ausgerissen? Art der Ober- und Unterbekleidung, Schuhe. Beschädigungen und Verschmutzungen der Bekleidung einschließlich der Schuhe, Schleifspuren an den Schuhen. Taschenzustand und -inhalt. Uhren, Schmuck. Was wird ausgezogen? Was wird aufgeschnitten? Welche Beschädigungen oder Verschmutzungen entstehen beim Auskleiden der Leiche? |
| 4. | Lage der Leiche (Rückenlage, Bauchlage, Seitenlage, Arme oder Beine angewinkelt, Kopf nach rechts oder nach links gedreht). Geschlecht, Lebensalter (ggf. Schätzung), Körpergröße, Körperbau, allgemeiner Ernährungszustand. Körperanhaftungen (Blut, Kot, Eiter, Sperma, Schmutz – Lokalisation der Körperanhaftungen, ggf. unter Beschreibung des Verlaufs von sog. Rinnspuren – z. B. Blutrinnspuren). |
| 5. | Die Zeichen des Todes: Erkaltung (ggf. Temperaturmessung im After), Totenflecke (Lokalisation, Farbe, Wegdrückbarkeit, Intensität, Aussparung der Totenflecke an den Aufliegestellen oder im Bereich von Hautfalten oder eng anliegender Kleidung). Totenstarre (es werden sämtliche großen und kleinen Gelenke einschließlich Kiefergelenke untersucht). Hautvertrocknungen (Lippen, Genitale). Fäulnis: Grünfäulnis der Bauchhaut, Ablösung der Oberhaut, mit Flüssigkeit gefüllte blasige Abhebungen der Oberhaut, Fäulnisdunsung des Gesichts, Fäulnisgasblähung des Bauches und des Hodensackes. Durchgetretene Blutaderzeichnung (netzartige dunkelgrüne bis schwarze Verfärbung der Haut über den Blutadern), Fäulnisflüssigkeit im Mund und in den Naseneingängen. Ausziehbarkeit der Haare. Ablösbarkeit der Fingernägel. Vertrocknungserscheinungen (Fingerkuppen, Nasenspitze). Mumifizierung. Fettwachsbildung. Skelettierung. Fliegeneier, Maden (Länge), Puppen, Puppenhüllen. Waschhautbildung an Händen und Füßen. Ablösbarkeit der Waschhaut. |
| 6. | Etwa vorhandene krankhafte Veränderungen oder Abnormitäten (bei kriminalpolizeilicher Leichenschau keine medizinischen Diagnosen – nur Beschaffenheit und Lokalisation der von außen erkennbaren Veränderungen). • Narben. Hautveränderungen: warzenähnlich, borkenbelegt, flächenhaft oder fleckig, kleinfleckig, großfleckig, ungleichmäßig oder streifig. • Rötungen der Haut mit oder ohne Vertrocknung. • Braunfärbung der Haut (sog. Braunpigmentation), Farbe eventueller warzenähnlicher Hautveränderungen (d. h. Pigmentierung der Warzen – braun, schwarz). Hautgeschwüre (flach, tief, Rand wie ausgestanzt). Eiterbelag der Geschwüre. • Injektionsstiche (Lokalisation, Zahl, Hautunterblutungen in Umgebung der Injektionsstiche. Farbe der Hautunterblutungen in Umgebung der Injektionsstiche. Narben nach Injektionsstichen). • Tätowierungen (Lokalisation, Motivdarstellung, einfarbig-blau, mehrfarbig). • Überzahl oder Mangel an Gliedmaßen (z. B. Zehen oder Finger), Gelenkveränderungen (Knie, Ellenbogen, Finger: Verdickungen, Schwellungen). • Schwellungen im Bereich der Fußknöchel und der Unterschenkel (nach kräftigem Fingerdruck: Dellenbildung = Oedem, d. h. vermehrte Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, z. B. bei chronischer Herz-Kreislauf-Schwäche). • Beschaffenheit der Haare – Kopf, Bart – Farbe, Länge, Schnitt, Tönung oder Färbung. Augenbrauen, Scham- und Achselbehaarung. • Farbe der Augen (zu beachten bei Fäulnisleichen, besonders bei Wasserleichen im Zustand der Fäulnis: natürliche Augenfarbe nicht mehr feststellbar, infolge Fäulnis stets eine braune „Augenfarbe“). • Gebiss: Beschaffenheit der Zähne, Zahnersatz, Zahnlücken. Ggf. Zahnarzt mit eingehender Beschreibung der Beschaffenheit der Zähne beauftragen. • Art der zahnärztlichen Arbeiten: Amalgamfüllungen, Porzellanfüllungen, Zementfüllungen. Lokalisation der Füllungen. Zahnkronen, Zahnplatten, Zahnersatz. Bei unbekannten Personen besonders eingehende Beschreibung (ggf. Fotografie) der besonderen Merkmale: Narben, Tätowierungen, Gebissbeschaffenheit. |
| 7. | Untersuchung von Kopf, Hals, Brustkorb, Bauchregion, Rückenfläche, After, äußeren Geschlechtsteilen, Armen, Beinen. Die Untersuchung dieser Körperregionen erfolgt vornehmlich zur Feststellung bzw. zum Ausschluss von Merkmalen äußerer Gewalteinwirkung. • Kopf: Dunsung des Gesichts und bläuliche Verfärbung der Gesichtshaut. • Kopfschwartenschwellungen oder -verletzungen. Beim Abtasten des Schädels abnorme Knochenbeweglichkeit. Schwellungen im Gesicht. Blutungen und Schleimhauteinreißungen an den Lippen (auch Lippeninnenfläche betrachten). • Schwellungen und Unterblutungen der Augenlider (Brillenhämatom). • Augenlider geschlossen oder geöffnet? Weite der Öffnung der Augenlider. • Blutungen in der Augenbindehaut – punktförmige Blutungen, flächenhafte Blutungen. • Augenfarbe. Weite der Sehlöcher (Pupillen), unterschiedliche Weite der Pupillen oder gleich weite Pupillen. Pupillen rund oder entrundet. • Fremdinhalt in den Nasenöffnungen: Blut, Schleim, Mageninhalt. Abrinnspuren – Verlaufsrichtungen der Abrinnspuren. • Schaumpilz vor der Nase (weiß, rötlich-bluthaltig). Abnorme Beweglichkeit des Nasenskeletts beim Abtasten. Schwellung der Nase. • Unterblutungen oder Verletzungen der Ohrmuscheln, Schwellungen. • Fremdinhalt in den Gehörgängen (ausgetretenes Blut oder eingeflossenes Blut), Abrinnspur aus den Gehörgängen – Verlaufsrichtung der Rinnspuren. • Mund geschlossen oder geöffnet. Zunge zwischen den Zahnreihen oder Zunge weit vorgestreckt. Zungenspitze angetrocknet. Flüssigkeitsspiegel in der Mundhöhle. Blut in der Mundhöhle und im Mundvorraum. Schaumpilz vor dem Mund (weiß, bluthaltig rötlich, feinblasig, grobblasig). Abrinnspuren aus dem Mund – Verlaufsrichtung der Rinnspuren. • Auffällige Geruchswahrnehmung bei Druck auf den Brustkorb. • Hals: Hautverletzungen, Hautunterblutungen, Hautkratzer. Strangwerkzeug am Hals. Strangmarke am Hals (Beschaffenheit und Lokalisation: oberflächlich, tief, breit oder schmal, braun-vertrocknet. Doppelte Strangmarke. Verlaufsrichtung der Strangmarke, ggf. Knotenabdruck). Blutungen innerhalb oder in der Umgebung der Strangmarke. Kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Hautblasen in der Umgebung der Strangmarke. • Abnorme Beweglichkeit der Halswirbelsäule (Beurteilung nicht immer sicher möglich). • Rumpf und Extremitäten: Hautunterblutungen, Hautvertrocknungen, Hautverletzungen (Beschaffenheit, Größe und Lokalisation der Verletzungen). Abnorme Beweglichkeit des Brustkorbskeletts. Abnorme Beweglichkeit des knöchernen Beckenringes. • Abnorme Beweglichkeit der Extremitäten (Knochenbrüche?). Regelwidrige Lage der Beine (nach innen oder nach außen gedreht). • Sorgfältige Betrachtung der Hände, ganz besonders der Handinnenflächen (Abwehrverletzungen, Strommarken – ggf. Lupenbetrachtung). Narben an der Innenfläche der Handgelenke („Pulsaderschnitte“). • Besondere Berufsmerkmale an den Händen. Schwielenbildungen. Beschaffenheit der Fingernägel (frische Abbrüche oder Einrisse). Auffällige Anhaftungen unter den Fingernägeln. • Untersuchung der Fußsohlen (Strommarken). • Schleifspuren am Rücken oder an den Fersen. Verlaufsrichtung der Schleifspuren. • Achten auf Injektionsstiche an für Injektionen ungewöhnlichen Stellen. • After und Genitale: Blutungen aus dem After oder aus dem Genitale. Äußerlich erkennbare Verletzungen. Kot in der Umgebung des Afters. Welche Spuren im Einzelnen an der Leiche und in deren Umgebung zu erwarten sind, hängt hauptsächlich von der Art der äußeren Gewalteinwirkung ab. Dennoch gibt es eine Reihe allgemeingültiger Anhaltspunkte, die eine Differenzierung zwischen einem Tod durch eigene oder fremde Hand zulassen. Im Allgemeinen weisen folgende Feststellungen auf einen Suizid hin: • Türen und Fenster von innen verschlossen und unbeschädigt, • geordneter Leichenfundort, • pedantisches Zurechtlegen von Urkunden für den Sterbefall, insbesondere Testament und Bestattungsvertrag, • Abschiedsbriefe (Schrifturheberschaft!) oder andere Schriftstücke, heute auch elektronische Aufzeichnungen (z. B. Fax, E-Mail, SMS), • Kombination von mehreren Suizidmethoden, • Mitnahme anderer Personen in den Tod, • vorangegangene Suizidversuche oder früher geäußerte Selbsttötungsabsichten, • Vorbereitungshandlungen, wie Schenkungen, Abschiedsbesuche und Beschaffung des Suizidmittels (z. B. Gift, Schusswaffe), • Persönlichkeit, Lebensumstände und gegebenenfalls Krankengeschichte (z. B. Depression, Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, Krebserkrankung) mit Hinweisen auf ein mögliches Suizidmotiv. Auch wenn der Täter einen Verschleierungsversuch unternommen hat, kann der Tat-/Fundort einige der wesentlichen Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung bieten: • Beschädigungen an Türen oder an Fenstern als Hinweis auf gewaltsames Eindringen, • offensichtliche Unordnung, wie umgestürzte Einrichtungsstücke, herausgerissene Schubladen, durchwühlte Schränke und Behältnisse oder auf dem Fußboden verstreut liegende Gegenstände, • Spuren eines Kampfes, insbesondere Blutspuren, • Fundsituation der Leiche, wie in Teppich eingerollt, in Plastiksack verpackt, im Bettkasten oder in einem Gewässer, • Auffindung zerstückelter Leichen und von Leichenteilen, • Lage des Körpers und Stellung der Gliedmaßen (sog. Lustmordstellung), • Schleifspuren und bei Fundorten im Freien widersprüchliche Reifen- oder Schuhspuren, • Hinweise auf mitgenommene, meist wertvolle Gegenstände. Um die Todesursache zuverlässig festzustellen, ist eine Leichenöffnung (= innere Leichenschau, Obduktion, Sektion, Autopsie) erforderlich. Nach wie vor gilt, dass eine Leichenöffnung die einzig sichere, wichtigste und auch billigste Methode zur Aufklärung unklarer Todesfälle ist. |