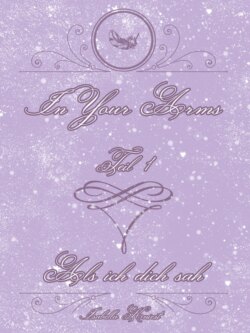Читать книгу In Your Arms - Isabella Kniest - Страница 14
ОглавлениеKapitel 3 – Eine Rettung und ein Herzenswunsch
Finsternis hatte sich über die verschneite Landschaft gelegt.
Als ich vor zehn Minuten meine Seitenscheibe von einer dicken Schneeschicht befreit hatte, hatte ich mich davon bezeugen dürfen, wie wenig die sinkenden Temperaturen dem starken Schneefall ausmachten.
Drei Stunden.
Drei geschlagene Stunden wartete ich nun auf Hilfe! Doch niemand war vorbeigefahren. Keine einzige Menschenseele.
Zitternd drückte ich mich tiefer in den Sitz.
Ich steckte ganz schön in der Klemme.
Wenn wahrhaftig niemand mehr vorbei kam, was sollte ich dann tun? Bei dem Wetter sich zu Fuß auf den Weg zu machen, wäre einem Selbstmord gleichzusetzen. Die letzte Ortschaft lag über zehn Kilometer weit entfernt. Und die Nächste tauchte ebenfalls erst in ungefähr zehn Kilometern auf.
Ich richtete meine Brille.
Wie es aussah, musste ich weiterhin untätig in meinem erkalteten Wagen auf Hilfe warten –
Zwei Lichtstrahlen verdrängten meine Überlegungen. Da wo sie die Dunkelheit durchschnitten, enthüllten sie mir allmählich kritische Ausmaße annehmendes Schneegestöber.
Ein Auto, schoss es mir durch den Kopf. Das muss ein Auto sein!
Hektisch und mit rasendem Puls riss ich die Wagentür auf und stolperte hinaus.
Ungefähr vierzig Meter von mir entfernt erblickte ich ein von Schneeflocken umwehtes Fahrzeug.
Das konnte meine Rettung sein!
Gleichermaßen wie Erleichterung sich in meiner Seele ausbreitete, tauchte meine vertraute Menschenscheue auf.
Der schiere Gedanke daran, einer wildfremden Person meine missliche Lage zu erklären, bescherte mir einen heftigen Adrenalinausstoß.
Ich ordnete mich zur Ruhe.
Es brachte nichts, vor Panik durchzudrehen. Ohne Hilfe war ich verloren. Das war Fakt. Demzufolge blieb mir gar nichts anderes übrig, als meine Schüchternheit auf die Seite zu schieben, meine Arme nach oben zu reißen und zu winken.
Hoffentlich sah mich der Fahrer … er musste mich einfach sehen!
Nach einigen Momenten erkannte ich eine Schaufel, welche pulvrige Massen an Schnee auf die Seite schob.
Ein Schneepflug.
Während ich weiterhin wie verrückt mit den Armen schwenkte, setzte ich einen Schritt Richtung Straße.
Das Fahrzeug drosselte die Geschwindigkeit.
Oh, Gott sei Dank!
Dafür beschleunigte mein Herzschlag sich nochmals um gut fünfzig Prozent.
Würde die Person mich mitnehmen? Würde sie mir helfen wollen? Oder würde sie Geld verlangen? Geld, das ich nicht hatte …
Mit leicht quietschenden Bremsen wurde das Fahrzeug zum Stehen gebracht. Die Fahrertür öffnete sich und ein graubärtiger Mann gekleidet mit einer dicken braunen Winterjacke, orangefarbenen Hosen und einer roten Haube auf dem Kopf stieg aus.
»Was machen Sie denn hier?« Den Ton in seiner Stimme vermochte ich nicht recht einzuschätzen. Klang er vorwurfsvoll oder doch ein wenig besorgt?
»Ich war auf den Weg zu meinen Eltern«, versuchte ich zu erklären und zeigte in die Richtung, in welche ich weiterfahren wollte. »Vier Dörfer weiter … bin dann aber ins Schleudern geraten und hier steckengeblieben … Wäre es möglich … könnten Sie mich mitnehmen?«
Ich wunderte mich, wie schnell und flüssig ich mein Ansinnen über die Lippen gebracht hatte. In der Vergangenheit war mir dies nie gelungen.
»Das würde ich sofort machen«, antwortete er sachlich. »Aber leider ist die Straße gesperrt worden.«
»Was?« Mir wurde es flau im Magen. »… Aber wieso das?«
»Umgestürzte Bäume.« Er blickte in die Richtung, aus der ich gekommen war. »Und auf der anderen Seite siehts nicht besser aus … ich habe gerade erst die Nachricht erhalten.« Er tippte auf das in seiner Brusttasche herauslugende Funkgerät. »Und in den nächsten Tagen wird sich an diesem Zustand mit Sicherheit nichts großartig ändern.«
Leichte Panik züngelte hoch in mir. »Und wie kommen wir von dieser Straße runter?«
Etwa überhaupt nicht?
Musste ich die nächsten zwei, drei Tage hier ausharren und warten? Das konnte einfach nicht sein, oder?
Er nickte nach rechts in den Wald. »Ein paar Kilometer weiter geht eine Straße in ein abgelegenes Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Dort wollte ich warten, bis sich das Wetter etwas beruhigt hat.«
Seine Worte brachten mir bloß geringe Erleichterung.
Ich knetete die Hände.
Würde er mich mitnehmen? Oder müsste ich zu Fuß dorthin gehen?
…
»Würden Sie mich … könnten Sie mich mitnehmen?« Nervosität veranlasste mich, meine Nase zu kratzen. »… Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Wagen steckt fest –«
Ein breites sich in sein Gesicht schleichendes Lächeln ließ mich verstummen. »Ich kann sogar noch etwas Besseres … Ich ziehe Ihren Wagen heraus. Dann können Sie mir bis ins Dorf nachfahren.«
Ich fühlte mich um tausend Felsbrocken erleichtert. »Ja wirklich? Das würden Sie tun?«
Er nickte. »Na sicher! Überhaupt kein Problem. Das geht ganz schnell.«
Und er behielt recht.
Keine zehn Minuten benötigte er, um meinen Wagen aus dem Schneehaufen herauszuziehen.
»Folgen Sie mir«, rief er mir zu, während er in den Schneepflug einstieg. »Es ist nicht weit.«
Mit klopfendem Herzen hielt ich das Lenkrad verkrampft in den Händen, eine konstante Geschwindigkeit von dreißig Kilometern pro Stunde beibehaltend. Eine Armee an Schneeflocken wehte gegen meine Frontscheibe, erweckte den Anschein, sämtliche Fahrzeuge an einer Weiterfahrt hindern zu wollen.
Ich fühlte mich erschöpft, und die Angst, nochmals die Kontrolle über mein Fahrzeug zu verlieren, nagte an meinen Nerven.
Reiß dich zusammen, Liza! … Du hast alles richtig gemacht. Der Mann scheint ebenfalls nett zu sein. Und dein Auto fährt. Alles ist gut ausgegangen.
Ja, alles war gut ausgegangen. Meine Zweifel waren komplett umsonst gewesen. Somit wurde es höchste Zeit, dass meine nervliche Anspannung sich legte …
Meine Gedanken schweiften ab.
Wann hatte es eigentlich zuletzt solchermaßen heftig geschneit?
Das musste mindestens fünf Jahre zurückliegen.
…
Wie schön es als Kind gewesen war, im tiefen Schnee zu spielen … mit kalten Beinen und nassen Haaren in die wohlig warme, gut duftende Stube zu treten … Ein heißer Kakao … Buchteln mit Vanillesoße … Kekse … fröhliche Weihnachtsdekoration …
Weiße Weihnachten … Das hatte es lange nicht mehr gegeben.
Würde ich es noch einmal erleben dürfen?
Die von dem alten Herrn erwähnte auftauchende Straßengabelung beförderte mich aus der Vergangenheit zurück ins Hier und Jetzt.
Während wir links abbogen, erblickte ich ein beinahe zur Gänze zugeschneites Straßenschild. Lediglich die ersten zwei Lettern waren zu erkennen: »Se« und auf einer kleineren Zusatztafel darunter »10 km«.
…
Wenn ich mich nicht gänzlich irrte, bedeutete dies, für weitere zwanzig Minuten die Konzentration beizubehalten.
Dichtes, von der Schneelast sich allmählich gefährlich nach unten beugendes Nadelgehölz säumte die unbekannte, in Dunkelheit liegende Landstraße.
Wie mochte das Dorf heißen?
Ich konnte mich partout nicht daran erinnern, je ein Schild mit diesen Anfangsbuchstaben gesehen zu haben – weder ein paar Dörfer davor noch danach. Und die Einfahrt zu dieser Nebenstraße war mir genauso wenig aufgefallen.
Nach weiteren endlosen Minuten des Kopfzermarterns ließ ich es dabei bewenden und schaltete das Radio an.
»Driving Home for Christmas«, drang aus meinen Radioboxen.
Ich musste schmunzeln.
Mein Lieblingslied.
Die Melodie, der Text – die dadurch entfesselten Gefühle … es erinnerte mich ebenfalls an meine Kindheit. An diese wundervolle Zeit ohne Zweifel, Ängste und Sorgen. Andererseits erweckte es Leere. Und Einsamkeit – wie ich dies im Winter, aber speziell zur Weihnachtszeit, oft empfand. Ein Gefühl, entstanden aus dem Wunsch endlich einem Mann zu begegnen, der sich nicht von mir abwandte. Ein Mann, der mich auf dieselbe Weise liebte, wie ich ihn. Ein Mann, dem ich vertrauen durfte …
Nun allerdings, seitdem dieses winzige Licht der Hoffnung namens Tobias ebenso erloschen war wie all die Vorherigen, riss dieser dumme Traum mir ein noch tieferes Loch ins Herz, als dies in der Vergangenheit je der Fall gewesen war.
Ja, es war mein größter Wunsch.
Seit jeher.
Einen Partner zu finden, der zu mir gehörte. Jemand, der mich auf dem restlichen Weg meines Lebens begleitete. Jemand, den ich auf dem restlichen Weg seines Lebens begleiten durfte …
Gähnend drehte ich die Lautstärke höher.
Ein Mann … der Mann. Derjenige, welcher. Der Eine, zu dem ich gehörte. Derjenige, für welchen ich mein Leben geben würde … der Mann, an den ich mich anlehnen durfte … und umgekehrt. Jemand, für den es sich zu kämpfen lohnte. Ein Mann, der sich gleichermaßen um mich sorgte, wie ich mich um ihn.
Das leicht ausbrechende Heck meines Wagens vernichtete sämtliche Gedankenspiele und trieb mir den Schweiß aus den Poren.
Konzentrier dich!
Wenn ich nicht besser aufpasste, würde ich ein zweites Mal in einem Graben landen.
Fürchterlicherweise dauerte es keine fünf Minuten, bis diese unbarmherzige Sehnsucht erneut über mich niederstürzte. Und in weiterer Folge begann mein Verstand zu arbeiten.
Weshalb gelang es mir nicht, jemandem zu begegnen, welcher dasselbe für mich empfand, wie ich für ihn? Sah ich wahrlich derart kindlich-naiv aus, sodass kein einziger Mann auf dieser Welt Interesse an mir zeigen wollte?
Bestimmt lag es an meiner geringen Oberweite gepaart mit meiner Brille, meiner Make-up-Verweigerung und meinem introvertierten Charakter – wie Anna mir dies andauernd unter die Nase rieb.
Je öfter ich weggestoßen wurde, desto unsicherer wurde ich …
Lediglich geliebt und von meinen Mitmenschen geachtet werden wollte ich. Wozu war mein Leben gut, wenn ich Tag für Tag alleine zurechtkommen musste? Sollte dies wahrhaftig den Sinn des Lebens darstellen? Erkennen zu müssen, im Grunde genommen, alleine zu sein … von niemandem beachtet zu werden? Dass alles, was ich tat und wofür ich kämpfte, letztlich völlig belanglos war … ich mein Leben lang alleine bleiben würde, bis zu meinem Tode?
Unweigerlich kamen mir die Tränen.
Dieses schreckliche Gefühl der Trauer nahm tagtäglich zu, wiederum meine Hoffnung schwand. Eine Hoffnung, die einmal unbezwingbar angemutet hatte – damals, als ich nach bestandener Abschlussprüfung aus dem Schulgebäude getreten war.
Ich war mir so sicher gewesen, ein jedes meiner Ziele erreichen zu können.
…
Lediglich drei Wünsche waren es gewesen: Ein eigenes Haus, eine fixe Arbeit mit netten Kollegen und einen mich liebenden rücksichtsvollen Partner.
Mehr wollte ich nicht. Mehr brauchte ich nicht. Mehr verlangte ich nicht. Ich wünschte mir keine Reichtümer, keinen »hippen« gut bezahlten Job, ein nagelneues Sportcabriolet oder eine Stadtvilla in Wien.
Lieber begnügte ich mich mit den kleinen Dingen im Leben. Mir reichte eine warme Wohnung und vernünftiges Essen. Und wenn ich mir ab und an ein hübsches Kleid kaufen durfte … ja, was brauchte ich mehr? Keine von uns in diesem Leben angehäuften materiellen Güter konnten wir mit in den Tod nehmen. Positive Eindrücke und Erinnerungen – dies zählte … und nur wenige davon hatte ich bislang erleben dürfen.
Ich drängte mich nicht gerne in den Mittelpunkt. Bereits deshalb hatte ich mich niemals nach übertrieben verantwortungsvollen Jobangeboten umgesehen oder überdurchschnittlich gut aussehende Jungs angesprochen. Des Weiteren war ich mir über meine eher bescheidenen Talente überaus im Klaren. Es gab nicht viel, das ich wirklich gut konnte. Zwar wusste ich von allem ein klein wenig, aber von nichts gut genug, um damit aufzufallen, daraus Profit zu schlagen oder von Männern im Allgemeinen bemerkt zur werden.
Seit jeher standen mir meine Unsicherheit, Ängste und Selbstzweifel gehörig im Wege. Immerhin hatten diese mich in eine beinahe fünfjährige Arbeitslosigkeit gedrängt. Ebenso rührte der beschämende Umstand davon her, noch niemals zuvor geküsst worden zu sein.
Nun, womöglich wäre ich rascher zu einen Job gekommen, wenn ich über einen großen Bekanntenkreis hätte blicken dürfen. Bedauerlicherweise war es mir weder damals noch heute möglich, auf eine solche Option zurückzugreifen. Die einzigen Menschen, die allzeit zu mir standen, waren meine Eltern. Sie glaubten an mich und sie unterstützten mich. Und dafür liebte ich sie bedingungslos.
Durch das Arbeitsmarktservice hatte ich schließlich den Job in der Buchhaltung erhalten. Obgleich ich mit den Kollegen nicht sonderlich gut zurechtkam – und es im Laufe der Zeit bloß schlimmer zu werden schien – hatte ich auf eine Besserung gehofft – gleichermaßen, wie ich dies von vielen anderen Gegebenheiten meines Lebens erhofft hatte …
Ich hatte fest daran geglaubt, der Weg aus der durch Mobbing gezeichneten Schulzeit würde irgendwann in ein glückliches Leben münden. Ich hatte vermutet, die Schatten meiner Vergangenheit abschütteln zu können. Ebenso war ich mir sicher gewesen, spätestens mit fünfundzwanzig Jahren in einer glücklichen Beziehung sein zu dürfen, und mit meiner großen Liebe meinen dreißigsten Geburtstag zu verbringen – irgendwo auf einer tropischen Insel … mein Traummann an meiner Seite … die Füße im weißen Sand vergrabend …
…
Wie töricht ich gewesen war, anzunehmen, es würde tatsächlich geschehen!
Als ob es wahre Liebe gab! Als ob es Freundschaft und Verständnis gab!
Ein brustzusammenziehendes Gefühl nötigte mich, tief einzuatmen.
Ich musste aufhören, mir über solch dumme Dinge den Kopf zu zerbrechen!
Doch sämtliche Versuche, mich auf den Schneefall und den Schneepflug vor mir zu konzentrieren, misslangen, und meine Gedanken rutschten abermals in dieselbe Schiene ab.
Eine Beziehung.
Weshalb brauchte ich überhaupt eine Beziehung? Weshalb sehnte ich mich nach einer für mich ohnehin in unerreichbarer Ferne legenden Sache?
Fakt war: Niemand wollte mich! Ich war ein naives Mauerblümchen. Eine Frau, die sich nicht wie eine Frau, sondern wie ein dummer Teenager fühlte. Eine Frau, die zu allem Überfluss wie ein Teenager aussah! Aber das Schlimmste stellte nach wie vor die Tatsache dar, diesen vermaledeiten Wunsch nach einem Partner nicht aus meiner Seele löschen zu können! Dabei war ich mir über mein infantiles Verhalten zur Gänze bewusst.
Wenn ich darüber nachdachte … Es brauchte mich nicht zu wundern, dass ein jeder sich von mir abwandte. Wer wollte auch jemanden an seiner Seite, der wie ein trotziges Kind nach der großen Liebe quengelte? Wer wollte jemanden an seiner Seite, der zu schüchtern geworden war, um einen Mann anzusprechen? Wer wollte jemanden an seiner Seite, der an Realitätsverlust litt?
…
Anna hatte wie immer recht: Ich war unfähig, irgendetwas richtig zu machen. Demzufolge funktionierte es auch mit einem Partner nicht. An etwas anderem konnte es nicht liegen.
Sonst hätte ich längst jemanden kennengelernt.
Trauer presste mir die Seele zusammen.
Gleichgültig wie sehr ich es mir einzureden versuchte, keinen Partner zu brauchen, dieser in die Knie zwingende Seelenschmerz gedachte weiter anzuwachsen.
Meine Seele schien nach irgendjemandem zu schreien, der mir einen Beweis für die Existenz wahrer Liebe gab.
Mein Herz wollte es so sehr. Meine Seele verzehrte sich danach.
Alleine mein Verstand hatte begriffen, welch großen Irrsinn diese peinliche romantische Vorstellung eines liebevollen, mich küssenden und in seinen Armen haltenden Mannes darstellte.
Und überhaupt: Selbst wenn es einen solchen Mann geben sollte, wie vermochte ich es, diesem zu begegnen, wenn ich nie in Diskotheken und auf Feste ging? Wie sollte ich, ein solch dummes, unscheinbares und flachbrüstiges Ding, einem derartigen Traummann auffallen?
Ich musste den Kopf schütteln.
Heutzutage wollten Menschen verreisen, mit ihren Statussymbolen angeben und Spaß haben. Sie wollten tanzen, singen, Party machen – Prioritäten, welchen ich rein gar nichts abgewinnen konnte.
Anstatt Festivals zu besuchen, mich hoffnungslos zu betrinken und ausschließlich meine eigenen Bedürfnisse ohne Rücksicht auf andere zu befriedigen, wünschte ich mir ein freundliches Miteinander, Respekt und Anstand, lange Spaziergänge im Wald, gemeinsames Zusammensitzen, Reden, sich wortlos in die Augen blicken …
Die kurz aufflackernden Bremslichter des Schneepflugs vor mir brachten mich zum Schluss, für diese Zeit schlichtweg zu altmodisch zu sein.
Ich musste mich damit abfinden. Ich passte nicht in diese Welt.
Irgendwann würde mein Herz dies wohl verstanden haben.
Hoffentlich dauerte es nicht mehr allzu lange!
Ein Popsong, welcher an Fingernägel erinnerte, die über eine Schultafel kratzen, veranlasste mich, das Radio abzuschalten.
Eines hatte ich in den vielen Jahren der Einsamkeit gelernt: Das Leben bestand nicht daraus, Träume zu verwirklichen. Das Leben bestand daraus, Hoffnung und Glauben zu verlieren. Mit Gewalt öffnete es meine Augen, zeigte mir die Realität. Eine Realität aus Rücksichtslosigkeit, Einsamkeit und Gefühlskälte.
Mein Verstand arbeitete weiter, wollte wieder einmal keine Ruhe mehr geben … Erst das Dorf, welches langsam zwischen den eingeschneiten Wäldern hervortrat, vollbrachte es, meine tristen Gedanken für einen Moment kaltzustellen.
Wie ein Bild von Thomas Kinkade lag es in einem lang gezogenen Hang – die Häuser durch den starken Schneefall beinahe nicht zu erkennen. Einzig die hell erleuchteten unzähligen kleinen Fenster, die gelb scheinenden Straßenlampen sowie bunte Weihnachtsdekorationen ließen Straßen und Grundstücke erahnen.
Ein romantischer wie kitschiger Anblick, der mir das Herz zum wiederholten Male zusammenkrampfte.
Ich zählte mich wahrlich nicht zu den Romantikern, jedoch mit meiner großen Liebe durch eine derartige bezaubernde Winterlandschaft spazieren – diese Vorstellung trug ich seit Kindesbeinen an in meinem Herzen.
…
Wieso tauchten diese vermaledeiten Bilder bloß andauernd auf?! Sie waren es schließlich, die mir mein Herz zerrissen!
Ich war keine sechzehn mehr. Selbst, wenn ich mich solchermaßen dumm fühlte – ich war dreißig Jahre alt! Ich war erwachsen! Dieser Umstand alleine sollte mir zu verstehen geben, dass eine Zeit, in welcher ich wie ein verliebter Teenager durch die Gegend herumstolzieren hätte können, endgültig vorübergezogen war.
Gegangen war die Chance auf Küsse im Park, sorgenfreie Ausflüge, mit Liebe und Glück gefüllte Sommerferien oder Spontanurlaube.
In meinem Alter sollte man solche Dinge längst erlebt haben. Da sollte man einige Jahre zusammen gelebt, womöglich sogar ein Haus gekauft haben. Da gründete man eine Familie. Da hatte man sich ein Leben aufgebaut.
Ergo: Sollte ich noch irgendwann einmal irgendjemanden antreffen, der sich überwand und mit mir abgab, wäre die Zeit des kindischen Verliebtseins ohnehin nicht mehr möglich. Sie war still und heimlich an mir vorübergezogen. Ich hatte sie verpasst.
Wie sagten meine Arbeitskolleginnen? »Es ist deine Schuld, wenn du dir nicht früher einen Mann geangelt hast. Jetzt bleibst du allein.«
Der Schneepflugfahrer leitete mich durch die lieblich geschmückten Blockhütten hinauf zu einer sanft erleuchteten Pension.
Ich stellte meinen Wagen in einer halb ausgeschaufelten Parklücke ab und stieg aus.
»Ich weiß gar nicht, wie sehr ich Ihnen danken soll«, entgegnete ich erschöpft, dafür wenigstens die schmerzenden Überlegungen zu verdrängen vermögend.
Der Mann präsentierte mir ein verschmitztes Lächeln. »Sie können mich zu einem kleinen Bier einladen.« Er nickte zur Pension. »Das Edelweiß hat ein eigen gebrautes köstlich schmeckendes Weißbier.«
Diesen Gefallen tat ich ihm gern.
Kichernd bejahte ich. »Einverstanden … Ich muss bloß meinen kleinen Trolley aus dem Kofferraum heben, dann kanns losgehen.«
»Soll ich Ihnen behilflich sein?«
»Nein, nein.« Kopfschüttelnd öffnete ich die Heckklappe. »Er ist ganz leicht. Ich brauche nicht sehr viel Gepäck.«
»Dann sind Sie aber eine große Ausnahme unter dem weiblichen Geschlecht.«
Glucksend hob ich den weißen Rollkoffer heraus und schloss die Klappe. »Danke für das Kompliment.«
…
Ich erschrak.
Seit wann gelang es mir, auf eine solchermaßen lockere und ungezwungene Art mit einer mir völlig fremden Person zu sprechen? Üblicherweise überwogen meine Selbstzweifel, sodass ich eine Aussage wie diese bestenfalls mit einem kurzen Lächeln beantwortet hätte.
Wahrscheinlich hatte meine Aufgekratztheit Schuld daran. Der Beinahe-Unfall, die drei Stunden des bangen Wartens auf Hilfe – da konnte man schon ein wenig durcheinandergeraten.
Ein raues Lachen seinerseits erklang. »Gern geschehen.« Er streckte mir die Hand entgegen. »Ich heiße übrigens Walter. Wenn es dir recht ist, können wir uns gern Duzen … das tun hier eigentlich alle.«
Hochzüngelnde leichte Ängste unterdrückend ergriff ich seine Hand. »Gerne. Und ich bin Liza. Freut mich.«
»Wie?« Er schien verwirrt. »So einen Namen habe ich aber noch nie gehört.«
»Äh … du kannst mich auch gerne Lisa nennen, wenn es für dich einfacher ist.« Ich zog meine Hand zurück. »Das tun sowieso die meisten.«
»Das klingt gut.« Seine Lippen zeigten mir ein Lächeln. »Na, dann komm mal mit, Lisa.«
An meinem Namen war bisher ein jeder verzweifelt. Und, wie in Walters Fall, hatte ich damit kein Problem. Weh tat es allerdings, wenn man mich hänselte oder mir irgendwelche selbst ausgedachten Spitznamen gab.
Wie Kitty …
Walter öffnete mir die schwere Holztür. »Nur herein in die gute Stube.« Alsbald er zur Rezeption blickte, an der ein junger, elegant gekleideter schwarzhaariger Mann stand, verwandelte sein Lächeln sich in ein breites Grinsen. »Michi! Sieh mal, wen ich mitgebracht habe.«
Während ich meine Stiefel abklopfte, baute meine Menschenscheue sich abermals auf.
Schluckend trat ich zu den beiden.
»Das ist Lisa«, stellte Walter mich vor. »Sie braucht ein Zimmer, solange die Straße gesperrt ist.« Er sah zu mir. »Ich gehe schon mal zur Bar. Komm einfach nach, wenn du dein Zimmer reserviert hast.«
»In Ordnung.« Ich lächelte meine Unsicherheit weg, stellte den Trolley neben mich hin, griff in meine Handtasche und holte nach einigem Suchen mein Portemonnaie hervor. »Wie viel kostet denn ein Einzelzimmer?«
»Fünfundvierzig Euro plus zwanzig Euro Single-Aufschlag.«
Verflixt und zugenäht!
Das kam mir ganz schön teuer.
»Das ist etwas viel … Gibt es vielleicht ein Einzelzimmer? Irgendwo eines im hintersten Eck, oder so?«
Der Mann wirkte entsetzt. »Nein, tut mir leid. Wir bieten nur Doppelzimmer an.«
Und ich wollte mich für meine unbedachte Äußerung liebend gerne selbst ohrfeigen.
Weshalb musste meine Nervosität und Unsicherheit mir durchwegs Steine in den Weg legen? Weshalb brachte mein Gehirn solch dumme Erwiderungen hervor?
Wo blieb die Schlagfertigkeit und Redegewandtheit, wenn ich sie brauchte?
»Ist es möglich, mit Kreditkarte zu zahlen?«
Der Rezeptionist bejahte. »Sehr gerne.«
Ich war kein Freund bargeldloser Bezahlung. Allein meine Musikeinkäufe, welche ich ausnahmslos online abwickelte, hatten mich dazu gedrängt, ein solches Zahlungsmittel beantragen zu lassen.
Als sie mich in den darauffolgenden Jahren aus einer großen Anzahl heikler Situationen gerettet hatte – wie zu niedrig geschätzte Tankkosten oder Geldknappheit ausgelöst durch Nachzahlungen der Stromrechnung – war sie mir jedoch zu einem unabdingbaren Freund im Kampf des Lebens einer jungen Frau geworden.
Ich zog die graue Karte hervor und reichte sie dem jungen Mann. »Bitte sehr.«
Eben wollte er sie in das POS-Gerät stecken, da beäugte er sie nochmals kritisch. Er räusperte sich. »Tut mir leid, aber diese Karte ist abgelaufen.«
Mir wurde es heiß und kalt und schwindlig zugleich.
Bitte, was?!
»Zeigen Sie mal.« Ich nahm sie zurück und blickte auf das Datum: Zwölf zweitausendsechzehn.
Grundgütiger!
»O nein …« Leicht panisch durchsuchte ich die gesamte Brieftasche. »Nein … Nein. Das kann nicht wahr sein!«
Bittere Verzweiflung ummantelte mich.
Ich suchte die Handtasche vollständig ab sowie sämtliche Manteltaschen.
Nichts.
Resigniert blickte ich in die dunklen Augen des Rezeptionisten. »Ich … Ich habe die neue Karte dann wohl zu Hause auf meinem Bürotisch liegen gelassen.«
Der Mann nickte verständnisvoll. »Sie können auch gerne mit einer Bankomatkarte bezahlen.«
O nein!
Diese Option kam für mich ebenso wenig infrage. Aus dem einfachen Grund: Mein Konto war leer.
»Das geht zur Zeit leider nicht …«
Gott, war das peinlich! Schließlich konnte ich ihm schlecht sagen, wie Pleite ich war. Welch Bild hätte das abgegeben?
…
Und jetzt?
Was sollte ich tun? Meine Eltern anrufen und sie fragen, ob sie mir etwas liehen?
Nein.
Ihre finanzielle Situation sah nicht unbedingt rosiger aus.
Ich hatte mich da selbst reingeritten, demzufolge musste ich mich selbst rausholen … Bloß wie?
Nachdenklich blickte ich mich um.
»Gibt es eine andere Möglichkeit der Bezahlung?«
Im selben Moment wurde ich mir meiner – neuerlich – dummen Worte gewahr.
Herrgott!
Was konnte er mir denn anbieten? Ratenzahlung vielleicht?
Es wurde sekündlich schlimmer mit mir …
Der junge Mann runzelte die Stirn. »Worauf wollen Sie hinaus?«
Eben wollte ich zu einer, wahrscheinlich wesentlich dummeren Antwort ansetzen – da ertönte eine satte männliche Stimme.
»Oh! Ein neuer Gast.«
Ich wandte mich nach rechts. Ein vielleicht ein Meter siebzig großer, ziemlich übergewichtiger älterer Herr trat zu uns. »Sie scheinen etwas besorgt. Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Er wirkte sehr herzlich und aufgeschlossen – allen voran sein entwaffnendes Lächeln.
Würde er es verstehen, wenn ich ihm meine Lage erklärte?
…
Es wurde mir flau im Magen.
Für gewöhnlich hatte ich Pech, wenn ich andere Menschen um Hilfe bat. Da traf ich auf Personen, welche sich für meinen Schlamassel nicht interessierten, oder mit genügend eigenen Problemen kämpften und mich aus diesem Grunde links liegen ließen.
Würde es, wie zuvor bei Walter, in dieser Situation anders verlaufen? Durfte ich es wagen? Oder würde der Herr mich hochkant rauswerfen?
Im Auto Übernachten war nicht eben die Vorstellung eines verlängerten Wochenendes in den Bergen. Andererseits: Welche Alternativen gab es?
…
Die Augen des Mannes strahlten mich glücklich an. Sie schienen ungemein verständnisvoll und aufrichtig …
Ach, was solls!
Ich kratzte meinen gesamten Mut zusammen und begann zögerlich zu erklären: »Ich habe ein Problem … Nun … Es ist so …«
Meine Güte! Ich klang so unsicher. Wahrscheinlich vermutete der Mann bereits, ich sei ein völlig hilfloser und unfähiger Mensch …
»Ich war auf den Weg zu meinen Eltern. Sie wohnen vier Dörfer weiter –«
Ein zärtliches Berühren meines linken Oberarmes durch seine Hand brachte mich dazu, innezuhalten.
»Kommen Sie mit. Besprechen wir das am besten in meinem Büro.«
Mit aller Kraft hielt ich mich davon ab, zurück zu stolpern.
Ich ertrug es nicht, wenn Personen mir zu nahe kamen. Dazu zählten bereits ein einfaches Berühren meines Arms oder ein unverbindliches Händeschütteln – selbst dann, wenn ich, wie heute, einen langen Mantel und Handschuhe trug.
All meiner Aufregung zum Trotz begann mein Verstand die Situation blitzschnell zu werten. Und keinen Augenblick später brachte er eine Frage hervor: Weshalb wollte der Herr in seinem Büro, und nicht hier mit mir sprechen? Schließlich wusste er nicht, in welcher Lage ich mich befand.
…
Wollte er womöglich etwas ganz Spezielles von mir?
Beruhige dich!, ermahnte ich mich. Du bist einfach zu übervorsichtig. Viel mehr, als im Auto zu übernachten, kann bei der Sache nicht rauskommen … also, versuche dich ein wenig zurückzuhalten.
Lautlos seufzend nickte ich dem Mann zu.
Ich folgte ihm durch einen langen, mit Holz verkleideten Korridor, auf dessen Wänden Knüpfbilder von verschneiten Häusern und Wildtieren hingen. Ein altrosa Teppichboden verschluckte sämtliche Geräusche unserer Schritte und unterstrich die heimelige Atmosphäre.
»Da wären wir.« Dort, wo der Flur einen Knick nach links machte, befand sich eine nachgedunkelte Holztür. Diese mündete in ein mittelgroßes mit Vollholzmöbeln, Holzstuck und schweren dunkelroten Vorhängen eingerichtetes Zimmer. Ein behaglicher Duft von ebendiesen Möbeln vermischt mit Vanille hing in der Luft, und ein in verschiedenen Brauntönen gehaltener Teppich schmückte den Boden.
»Hier bitte.« Er zeigte auf einen von zwei Holzstühlen, auf dessen Rückenlehnen Edelweißblüten eingeschnitzt worden waren. »Setzen Sie sich.«
Dankend ließ ich mich nieder.
»Sie scheinen mir ziemlich verzweifelt«, entgegnete der dickliche Mann besorgt, während er sich mir gegenüber auf einen gewaltigen Ledersessel setzte. »Haben Sie Schwierigkeiten?«
Mein Herzschlag beschleunigte sich.
»Wie? Was –«
Woher konnte er das wissen?
»Tut mir leid …« Er vollführte beruhigende Handgesten. »Ich falle schon wieder mit der Tür ins Haus, nicht?«
»Äh, also –«
»Es tut mir wirklich leid. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.« Einige Augenblicke lang hielt er die Lider geschlossen. »Es ist bloß so … ich erkenne, wenn Menschen bedrückt sind … Darum mein Vorschlag, hier mit Ihnen darüber zu sprechen.«
Spätestens jetzt war ich vollends meiner Worte beraubt.
Strahlte ich meine Verzweiflung etwa dermaßen heftig aus?
…
Wollten Mitmenschen deshalb nichts mit mir zu tun haben? Hatte das daran Schuld? Machte sich deshalb ein jeder lustig über mich?
Kälte erfasste mich.
Wollte etwa deshalb kein Mann mit mir zusammen sein?
…
»Also«, riss der Herr mich aus meinen Grübeleien. »Wenn Sie darüber sprechen möchten – nur raus damit.«
»Ich … nun –«
Meine finanziellen Sorgen konnte ich nicht irgendeinem fremden Menschen anvertrauen! Damit gab ich mich höchstens der Lächerlichkeit preis – etwas, das mir in der Vergangenheit unzählige Male widerfahren war und ich aus exakt diesem Grunde zwingend verhindern wollte.
Andererseits – was hatte ich noch großartig zu verlieren, außer einen Stolz, welchen ich ohnehin längst verloren hatte?
Des freundlichen Herren wärmeausstrahlende Augen nahmen mir einen Teil meiner Verunsicherung.
»Ich bin gänzlich pleite«, gab ich seufzend zu und nahm meine Uschanka ab. »Ich habe meine Kreditkarte zu Hause vergessen und mein Konto ist blank. Darüber hinaus trage ich nur fünfzig Euro bei mir – mein Tankgeld für diesen Monat.«
Stumm nickend hörte er mir angestrengt zu. Erkennen konnte ich dies an seinen leicht zusammengezogenen Augenbrauen und der in Falten gelegten Stirn.
»Und jetzt ist die Straße gesperrt, und ich komme nicht zu meinen Eltern. Sie hatten mich eingeladen – wollten unbedingt, dass ich sie besuche.«
»Und dann musste der Schneesturm aufkommen«, warf er nachdenklich ein.
»Ja, genau so siehts aus.« Ich legte meine Hände um die Kopfbedeckung in meinem Schoß. »Ich kann Ihnen bloß vorschlagen, meine Eltern anzurufen, damit sie mir das Geld vorstrecken … Ich habe wirklich nichts mit.«
Abermals nickte er.
Meine Eltern wollte ich damit am wenigsten belasten, aber irgendwie musste ich das Hotelzimmer schließlich bezahlen. Was blieb mir da anderes übrig?
»Können Sie kochen, abwaschen, putzen?«
Ich blinzelte. »Äh … ja, natürlich.«
Er setzte sich etwas auf. »Wenn es Ihnen recht ist, können Sie die Zeit, in der Sie hier warten müssen, für mich arbeiten.«
Perplex starrte ich in sein rundliches glattrasiertes Gesicht.
Meinte er …?
»Somit können Sie Verpflegung und Übernachtung abarbeiten und müssen weder Ihre Eltern noch sonst wen um Hilfe fragen.« Etwas Undeutbares blitzte in seinem Gesicht auf. »Wie ich das nämlich sehe, wollen Sie andere nicht sehr gerne um Hilfe bitten … Aber damit wäre allen geholfen, nicht?«
Mit der Zeit wurde es unheimlich.
Wie machte er das?
War dies Zufall?
Dieser Mann machte nicht den Eindruck, auf gut Glück zu raten oder sich kurzfristig irgendetwas zusammenzureimen und damit ab und an einmal richtig zu liegen.
Plötzlich wurde es mir klar: Es musste eine Art Gabe sein. Er hatte das nötige Feingefühl, um zu erkennen, wann Menschen sich in Not befanden.
…
Grundsätzlich hatte ich solche Reaktionen und Fähigkeiten als eine Art Hollywood-Märchen abgetan – nette ältere Herren oder Damen, welche auf nahezu zauberhafte Weise das Leid fremder Menschen erkannten und ohne Gegenleistung Hilfe anboten …
»Ich … ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Peinlich berührt richtete ich meine Brille. »Ich will niemandem Schwierigkeiten bereiten … und bedeutend weniger möchte ich wie ein Versager aussehen.«
»Das tun Sie absolut nicht«, erwiderte er fröhlich. »Sie wirken sogar sehr stark … Sie können Ihr Innerstes ganz gut verstecken.« Verspielt zwinkerte er mir zu. »Meine Frau ist Ihnen da sehr ähnlich. Sie spielt auch ständig die Toughe, dabei benötigt sie eine starke Schulter zum Anlehnen viel öfter, als es ihr lieb ist.« Für einen Wimpernschlag huschte etwas Ähnliches wie Unsicherheit über seine herzlichen Züge. »Aber bitte sagen Sie es ihr nicht … sonst bekomme ich ernste Schwierigkeiten.«
Ich musste schmunzeln.
Es war einfach zu komisch.
Da saß ich mit einem wildfremden Mann, der mehr über mich zu wissen schien als meine eigenen Eltern – und plauderte mit ihm über charakterliche Schwächen und leere Bankkonten.
Dieser Tag würde wohl als der verrückteste in meine Lebensgeschichte eingehen.
»Ich werde ihr nichts verraten«, versprach ich.
Sein Lächeln wuchs an. »Ach ja.« Er griff nach Papier und Stift und legte diese vor mich hin. »Bitte schreiben Sie mir Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer auf.«
Ich fasste nach dem Kugelschreiber.
»Nur für Notfälle.«
»Ich verstehe … Wenn irgendjemand vom Amt vorbeischaut … oder ich Schwierigkeiten mache, oder?«
Er bejahte. »Obwohl ich solche Vorsichtsmaßnahmen wirklich ungern treffe.« Ein unerwartet trauriger Unterton schwang in seiner Erklärung mit. »Ich habe leider einiges erlebt. Darum passe ich jetzt etwas besser auf.«
Durch meine vermaledeite Nervosität brachte ich es wieder einmal nicht zuwege, meine Daten schön leserlich auf Papier zu bringen. Wie das eines Kindes, welches eben seine ersten Schreibversuche unternommen hatte, mutete mein fürchterliches Gekrakel an.
»Das kann ich gut nachvollziehen.« Meine Finger steif und schmerzend gab ich ihm Papier und Stift zurück. »Die Gesellschaft ist leider nicht mehr das, was sie einmal war.«
»Ja.« Sein kummervolles Gesicht versetzte mir einen Stich.
War er, wie ich, tief verletzt worden?
»Es ist furchtbar … andererseits –« Schlagartig brachte der Mann strahlende Hoffnung zum Ausdruck. »Beweisen Sie mir, dass es noch Ausnahmen gibt.«
Eine unangenehme Wärme stieg mir in die Wangen. »Meinen Sie? … Ich bin mir da nicht so sicher.«
Ich sollte anders sein?
Ich bekam nichts auf die Reihe … Stets beschwerten die Leute sich, jammerten und schimpften. Über jede Kleinigkeit. Ich war sicherlich keine Ausnahme. Ich war nicht einmal die Regel. Ich war ein Niemand.
Der Mann erhob sich. »Aber ich.« Er präsentierte mir ein breites Grinsen. »Das muss reichen.«
Von seinem fröhlichen Ausdruck angesteckt, stand ich lächelnd auf.
Er umrundete den Schreibtisch und hielt mir die Hand hin. »Übrigens. Mein Name ist Manfred Weiß … Aber am liebsten ist es mir, wenn wir uns Duzen.« Seine Lippen verzogen sich geringfügig. »Obwohl das nicht alle meine Angestellten tun.«
»Gerne.« Ich ergriff seine Hand und schüttelte sie. »Ich heiße Liza.«
»Wie Liza Minelli?«
»Ja, genau.«
Ich konnte es kaum fassen! Der erste fremde Mensch, der meinen Namen richtig aussprach!
»Dann weiß ich Bescheid.« Er führte mich aus dem Büro. »Ich bringe dich zu Michi. Der wird dir deinen Zimmerschlüssel geben.«
Frische Unsicherheit kletterte in mir empor. »Eine Bitte hätte ich noch.«
»Ja?« Er musterte mich mit demselben neugierigen Blick wie vorhin. »Nur raus damit.«
»Darf ich meine Eltern anrufen?« Ich knetete meine behandschuhten Hände. »Mein Handy hat keinen Empfang … und sie werden sich bestimmt Sorgen machen.«
»Aber natürlich! Das Telefon bei der Rezeption steht zu deiner freien Verfügung.«
Erleichterung ließ mich aufatmen. »Vielen Dank.« Ich überlegte. »Ach ja … ab wann soll ich morgen zum Dienst antreten?«
»Am liebsten würde ich dich ausschlafen lassen. Da wir zurzeit aber eine Hochzeitsrunde mit dreißig Personen im Hause haben, bin ich dankbar für jede helfende Hand. Es wäre somit toll, wenn du zwischen sechs und halb sieben in der Küche sein würdest.«
»Selbstverständlich. Gar kein Problem. Ich bin sowieso Frühaufsteher.«
»Wenn das bloß alle meine Angestellten wären!« Herzliches Lachen drang aus seiner Kehle. »Na ja, vielleicht schauen sie sich bei dir etwas ab.«
Ich machte eine wegwerfende Handgeste. »Ich denke, erst sollte ich mich beweisen … Man sollte den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben.«
Ganz besonders mich nicht …
Kichernd führte Herr Weiß mich zum Empfang.
»Michi! … Gib Liza die Schlüssel.«
»Sehr gern.« Der junge Mann fasste nach einem auf der Mauer hinter ihm hängenden Schlüssel mit einem ovalen Anhänger, auf dem die Nummer 26 eingraviert worden war, und reichte ihn mir. »Hier bitte.« Er zeigte zur langen Holztreppe. »Ihr Zimmer befindet sich im ersten Stock. Haben Sie einen schönen Aufenthalt.«
»Ihr könnt euch gerne Duzen«, informierte Manfred. »Liza wird uns für die nächsten Tage etwas zur Hand gehen. Jedenfalls solange das stürmische Wetter anhält und die Straße gesperrt ist.«
»Oh.« Michis Augen weiteten sich geringfügig. »Dann kommen heute wohl keine Gäste mehr.«
»Nein«, erwiderte Manfred beschwingt. »Ich glaube nicht.«
»Dann wird das ein ruhiger Abend werden.«
»Ja.« Der Hotelbesitzer nickte. »Da bin ich mir ziemlich sicher.«
»Super!«
Die beiden Männer warfen sich vertraut-wissende Blicke zu.
Was hatte dies zu bedeuten?
Ich atmete lautlos durch. »Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Ich wüsste wirklich nicht, was ich sonst gemacht hätte.«
Der dickliche Mann schenkte mir ein weiteres Lächeln. »Dafür sind wir ja da.« Er klatschte in die Hände. »Aber jetzt muss ich mich noch um ein paar Dinge kümmern.« Damit verschwand er Richtung Korridor.
Ich drehte mich zu Michi. »Darf ich bitte kurz das Telefon benutzen? Ich müsste meine Eltern anrufen … mein Handy hat nämlich keinen Empfang.«
»Sicher.« Er machte mir Platz. »Mit diesem Funk-Zeugs hat man einzige Probleme, stimmts?«
Nickend trat ich hinter die Rezeption und hob den weißen Hörer des an die Achtzigerjahre erinnernden Telefons ab, welches etwas seitlich jedoch gut sichtbar neben einer Wasserlilie stand. »Ja, das sehe ich genauso. Ein Festnetzanschluss funktioniert beinahe immer. Handys dagegen geben bald einmal den Geist auf.«
»Genau meine Rede! Aber am schlimmsten finde ich die Akkulaufzeit. Jedes Mal, wenn man schnell etwas nachschauen oder jemand anrufen will, ist der Saft aus.«
Ein Kichern zurückhaltend drehte ich mich zum jungen Mann um. »Mir gehts ganz gleich! Oder die Software hängt sich auf und das Telefon startet neu.«
»O Mann!« Er verdrehte die Augen. »Das ist der Horror!«
Wir lachten beide laut auf.
…
Meine Güte, tat das gut. Nach solch einer langen Zeit ein gänzlich normales Gespräch führen, ohne unterbrochen oder gemaßregelt zu werden …
Obgleich Arbeitskollegen sich ohnehin nicht sonderlich gerne mit mir unterhielten, waren kurze Gespräche in den letzten Monaten zu einer echten Seltenheit geworden. Dies lag an der Tatsache, aufgrund meiner Kaffeeeinladung von Tobias nun ebenfalls ignoriert zu werden.
»Aber jetzt lasse ich dich einmal dein Gespräch führen.« Lächelnd drehte Michi sich zur Seite und begann Papiere wegzuordnen.
»Es dauert nicht lang«, versprach ich und begann die Nummer zu wählen.
»Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.«
Ich wollte etwas Weiteres erwidern, da hielt ein besorgt klingendes »Hallo« meiner Mutter mich davon ab.
»Hey, Mama! Ich bin’s!«
»Liza?!« Ihre Stimme überschlug sich regelrecht. »Geht’s dir gut?«
Ein gewaltiges Schuldgefühl fing an, sich um meine Seele zu wickeln.
Wie lange hatte sie sich meinetwegen gesorgt?
»Es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde … Aber es geht mir gut.«
»Ist etwas passiert?« Gott sei Dank klang sie ein wenig gefestigter. »Bist du noch unterwegs?«
»Nun … nein … Ich hatte einen kleinen Unfall, aber passiert ist mir nichts. Und was ich bisher gesehen habe, hat auch das Auto keinen Schaden genommen –«
»Einen Unfall?! In Gottes willen! Was genau ist denn passiert? Wo bist du jetzt? Sollen wir dich abholen kommen?«
Himmel!
Durch meine törichte Erzählung war das exakte Gegenteil geschehen: Nicht beruhigt hatte ich sie, sondern ihren Kummer angefacht!
Ich hätte erst gar nichts erwähnen sollen.
»Ich bin in einem Hotel in Seedorf«, versuchte ich zu beschwichtigen. »Ihr könnt mich nicht abholen. Die Landstraße ist bis auf Weiteres gesperrt. Ich sitze also so lange hier fest, bis der Schneefall aufgehört und die umgestürzten Bäume weggeräumt worden sind.«
Es entstand eine längere Pause, in welcher meine Mutter aller Wahrscheinlichkeit nach die Situation zu überdenken versuchte.
»Sag mir bitte genau, was passiert ist.« Einerseits flehend, andererseits streng gab sie diese Anweisung kund.
Ich räusperte mich, schluckte Scham- und Versagensgefühle hinunter. »Ich bin ins Schleudern geraten und im Schnee stecken geblieben … Dann habe ich drei Stunden lang gewartet. Zum Glück ist ein Schneepflug vorbeigekommen. Der Fahrer hat mir geholfen, den Wagen herauszuziehen.«
Solch eine schlechte Autofahrerin wie mich gab es in Österreich mit Sicherheit kein zweites Mal …
Meine Mutter atmete erleichtert aus. »Dann ist ja noch einmal alles gut ausgegangen.«
Und ich fühlte mich beträchtlich erleichterter.
»Ja. Mir gehts wirklich gut. Jetzt muss sich bloß das Wetter beruhigen, dann kann ich zu euch kommen.«
»Mach dir da bitte keinen Kopf. Hauptsache, dir geht es gut.« Eine kurze Zeit der Stille folgte. »Ich hätte dich nicht drängen sollen, zu uns zu kommen. Wärst du nicht losgefahren, dann wäre das nicht passiert … Es tut mir furchtbar leid.«
Mir wurde es reichlich anders zumute. »Red keinen Unsinn! Da hat niemand Schuld dran.«
Wie kam sie auf die Idee, sich selbst die Schuld zu geben? Niemand konnte etwas dafür … Wenn überhaupt, dann war der Fehltritt einzig und allein bei mir zu suchen! Wäre ich zu Weihnachten vorbeigekommen, hätte ich mir dieses Fiasko und meinen Eltern unnötige Sorgen erspart.
»Es gibt aber ein anderes Problem«, fuhr ich zögerlich fort. »Sollt es derart heftig weiter schneien, komme ich womöglich überhaupt nicht mehr zu euch durch.«
»Wieso das?«
»Ich muss Montag wieder arbeiten. Weiteren Urlaub beantragen, ist nicht möglich. Mein Chef hat mir nur für diese paar Tage frei geben können. Zurzeit ist viel zu tun.«
Ich vernahm ein leises Seufzen. »Na ja, dann schauen wir, dass wir zu dir kommen.«
»Das wäre toll.« Ich lächelte. »Zurzeit ist es leider ziemlich stressig.«
»Seit du bei dieser Firma arbeitest, scheinst du keine freie Minute mehr zu haben … Wird das mit der Zeit nicht zu belastend für dich?«
Jetzt fing sie wieder damit an.
Seitdem ich ihr vom Arbeitsstress erzählt hatte, beharrte sie auf eine Kündigung.
Selbstredend verstand ich ihre Besorgnis. Sie hatte recht, wenn sie meinte, ich müsse mich in einem Job wohlfühlen … Leider Gottes funktionierte die Welt nicht auf diese Weise.
Aus diesem Grunde verschwieg ich ihr auch meine seelische Verfassung und vertröstete sie jedes Mal, wenn sie oder mein Vater mir einen Besuch abstatten wollten oder ich zu ihnen fahren sollte.
Ich wollte sie nicht belasten. Zeitlebens hatten sie sich um mich gekümmert. Nun war ich erwachsen und musste mit meinen Schwierigkeiten selbst zurechtkommen.
Wie hieß es noch gleich? Das Leben war hart …
»Bitte, Mama … Du weißt, wie schwer es ist, seine Arbeit zu wechseln. Die Zeiten haben sich geändert. Ich muss froh sein, überhaupt einen Job zu haben.«
»Das weiß ich, Schätzchen.« Sie hörte sich bekümmert an. »Ich mache mir nur Sorgen. Das verstehst du, oder?«
…
»Natürlich.«
Aber exakt dies wollte ich verhindern!
Himmel!
Wollte mir wahrhaftig gar nichts mehr gelingen?
»Lass dich nicht zu sehr einspannen. Achte auf dich. Es soll dir gut gehen. Wenn es dir dort nicht gefällt, dann kündige. Besser ein paar Monate arbeitslos zu sein, anstatt sich fertigzumachen.«
Wenn dies so einfach gewesen wäre! Schließlich brauchte ich das Geld. Vor allem jetzt, wo dergestalt viele Zahlungen ins Haus geflattert waren und auf meinem Konto gähnende Leere herrschte. Außerdem war ich mir sicher: Wenn ich jetzt kündigte, würde ich weit länger als ein paar Monate arbeitslos sein …
»Ich passe auf mich auf, versprochen.«
»Das sagst du andauernd … und dann fühlst du dich trotzdem unwohl.«
Sie kannte mich einfach zu gut.
»Mir geht es wirklich gut … aber jetzt muss ich aufhören.«
»Ja, ich verstehe.« Der leise vorwurfsvolle Protest in ihrer Stimme versetzte mir einen Stich.
Ich verstärkte den Griff, mit welchem ich den Telefonhörer festhielt.
Was bitte schön sollte ich denn tun? Sie wusste, wie mein Leben verlief und wie wichtig mir meine Unabhängigkeit war. An meiner Situation konnte sie ebenso wenig etwas ändern wie ich selbst. Was brachte es da, dieses Thema erneut bis ins kleinste Detail durchzukauen? Darüber hinaus hätte ihr eine solche Diskussion im günstigsten Falle weiteren Kummer bereitet.
»Hast du genügend Geld mit?«
Manchmal schien sie Gedanken lesen zu können. »Ja … ja, keine Sorge.«
»Wirklich?«
Mir wurde es heiß. »Ja … es ist alles in Ordnung. Ich rufe dich an, sobald ich mich auf den Weg mache, okay?«
»Ist gut.« Erneut hörte ich sie leise aufseufzen. »Aber wenn du doch Hilfe brauchst, dann ruf mich an.«
»Danke … das mache ich, versprochen.«
»Na gut.«
…
Sie war sich meiner Flunkerei bewusst geworden.
Ich fühlte mich hundsmiserabel deswegen.
»… Dann schlaf gut. Und pass auf dich auf.«
»Mach ich.« Ich rieb mir über die rechte Schläfe – die Gewissensbisse wollten dadurch aber in keiner Weise abnehmen. »Gute Nacht. Und grüß Papa von mir.«
»Ich werde es ihm ausrichten … Gute Nacht, Schätzchen.«
Ausatmend legte ich den Hörer auf die Gabel.
»Eine besorgte Mutter?«, vermutete Michi.
Mit warmen Wangen nickte ich ihm zu.
Es war klar gewesen, dass er mitgehört hatte … So etwas Peinliches!
»So sind Mütter eben.«
Er kicherte. »Ja, aber besser so, als andersrum.«
»Da hast du recht.« Ich trat zu meinem Koffer. »Ich werde einmal in mein Zimmer gehen und meine Sachen auspacken. Und dann werde ich mich noch kurz zu Walter setzen.«
»Mach das.« Michi fasste nach einem Buch und hielt es hoch. »Und ich werde mir diesen Thriller hier zu Gemüte führen.«
Sein glückseliger Anblick brachte mir ein Lächeln ins Gesicht zurück. »Darfst du das denn?«
Er nickte eifrig. »Ja, wenn es ruhig ist und wir nichts zu tun haben, dürfen wir auch mal ein wenig lanzeln.«
…
Von daher rührten die wissenden Blicke vorhin!
»Na, dann viel Spaß mit der Geschichte.« Ich hob den Trolley auf und trug ihn über die Holztreppe hoch in den ersten Stock. Oben angekommen, stellte ich ihn zurück auf den Boden, fasste nach dem Griff und zog ihn hinter mir her.
Der Korridor hatte große Ähnlichkeit mit dem in Erdgeschoss. Lediglich die mit Ölfarben gemalten Bilder, welche Jäger mit ihren geschossenen Trophäen, darunter Steinböcke, Hirsche und Gämse zeigten, brachten die typisch österreichische Atmosphäre nochmals besser zur Geltung.
Mein Zimmer lag ungefähr in der Mitte, von einer mächtigen Vollholztür versperrt. Ich schloss auf und trat ein. Ein behaglicher Duft von Holz und Zimt stieg mir in die Nase. Mein Blick glitt durch den schätzungsweise fünfzehn Quadratmeter großen Raum. Das Doppelbett befand sich auf der rechten Seite, gegenüber davon stand ein Schrank. Vor mir, unter dem quadratischen zweiflügeligen Kastenfenster mit den altrosa Vorhängen und dem Store mit Blumenmuster, erstreckte sich eine kurze Kommode, auf der eine Duftlampe stand. Der Boden war mit einem naturfarbenen Teppich ausgelegt worden, welcher sich bereits unter meinen Stiefeln unbeschreiblich weich anfühlte.
Um diesen nicht zu beschmutzen, zog ich mir zu allererst die Schuhe aus. Ich entledigte mich des Mantels und der Handschuhe und begann sodann, den Koffer auszupacken. Mit den Hygieneartikeln in der Hand schritt ich an der Kommode vorbei in das kleine hellgelb verflieste Bad. Es beinhaltete eine Dusche, ein WC und ein winziges Waschbecken mit einem vielleicht sechzig mal sechzig Zentimeter großen Spiegel an der Wand.
Niedlich war kein Ausdruck.
Ich musste gestehen, so wohl wie ich mich hier fühlte, fühlte ich mich nicht einmal in meiner kleinen Vorstadtwohnung mit den vielen Laubbäumen und den im Sommer blühenden Stauden drumherum.
…
Um ehrlich zu sein, hatte ich mich dort noch nie sonderlich wohlgefühlt. Das lag zum einen an der viel befahrenen Straße und zum anderen an den Mietern.
Was will die Angeberin hier?
Kannst du dir die Miete überhaupt leisten?
Ich sage es dir das letzte Mal: Wenn du an der Reihe bist mit dem Stufenwischen, dann muss das pünktlich erledigt werden, oder es wird der Hausverwaltung gemeldet – und dann verlierst du die Wohnung schneller, als du schauen kannst.
Kopfschüttelnd versuchte ich, die Gedanken loszuwerden.
Weshalb mussten Menschen stets solchermaßen kalt sein? Was hatte ich ihnen getan? Was hatten sie davon, andere runter zu machen? Wieso konnte die Gesellschaft nicht freundlich miteinander umgehen?
Seufzend trat ich zum Waschbecken und wusch mir die Hände, dann machte ich mit dem Ausräumen weiter.