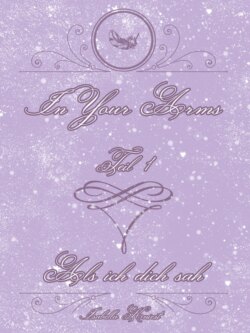Читать книгу In Your Arms - Isabella Kniest - Страница 8
ОглавлениеProlog – Regen in meinem Herzen
Liebe ist so zerbrechlich wie die Flügel eines Schmetterlings
»Kannst du irgendwann etwas richtig machen?«, entgegnete Anna genervt. »Ich habe dir das schon zweimal gezeigt! Bist du so blöd, oder tust du nur so?« Mit einer überschwänglichen Geste warf meine Arbeitskollegin das blondierte Haar zurück, welches von der häufigen Färberei bereits unnatürlich strohig aussah.
»Hörst du mir überhaupt zu?«
Ihre schrille Stimme tat mir in den Ohren weh.
»Ja, tue ich.«
»Dann sieh mich nicht so blöd an, sondern rechne das noch einmal vernünftig aus!«
Mit einem bedrückenden Gefühl fasste ich nach dem Bleistift.
Jedes Mal musste sie mir helfen. Jedes Mal machte ich Fehler. Wann würde ich endlich in der Lage sein, meine Arbeit richtig zu machen?
»Hier musst du die Ausgaben eintragen, nicht in der linken Spalte!« Mit ihrem rot lackierten Fingernagel klopfte Anna auf die rechte Seite des Hefts. »Das ist doch nicht so schwer! Jedes Kindergartenkind kriegt das besser hin!«
Nickend wollte ich die Summe eintragen, da legte eine beschämende Erkenntnis sich über mich: Ich hatte sie abermals vergessen.
Eine das Herz zum Klopfen bringende Furcht krampfte mir den Magen zusammen. Zitternd legte ich den Stift zur Seite und zog nochmals den Kassenbeleg hervor.
»Meine Fresse!«, hörte ich Anna keine Sekunde darauf schimpfen, wodurch ich mich nicht davon abhalten konnte, leicht zusammenzuzucken. »Du hast den Betrag schon wieder vergessen? Das kann doch nicht wahr sein! Wo bist du immer mit deinen Gedanken? Kriegst du eigentlich irgendetwas auf die Reihe?«
Das beklemmende Gefühl des Versagens kroch in eine jede einzelne Faser meines Körpers – lähmte mir den Geist, raubte mir meine ohnehin winzige Selbstsicherheit.
Anna hatte recht.
Es gelang mir partout nicht, etwas richtig zu machen … nicht ein einziges Mal.
Gab es etwas, das ich gut konnte?
Tausendmal hatte ich mir darüber den Kopf zermartert – stets mit demselben zermürbenden Ergebnis: Ich besaß kein Talent. Für gar nichts.
Aufkommende Tränen unterdrückend trug ich die fünfunddreißig Euro neunzig ein.
»Und jetzt«, ordnete Anna weiter an. »Schreibst du die Nummer, die du auf den Beleg notiert hast, hier hinein.« Sie zeigte auf die links befindliche leere Spalte. »Sonst weiß die Buchhaltung ja nicht, welcher Beleg gemeint ist.«
»Ja, in Ordnung.«
Eben war ich dabei, Annas Forderung zu entsprechen, da rief Letztgenannte lautstark durch den Büroraum: »Hey Saskia! Lisa bringt es wieder nicht fertig, die Buchhaltung richtig zu machen.«
Allein mit äußerster Mühe hielt ich mich davon ab, vor Schreck hochzuspringen.
Ein mokierendes, kratzendes Kichern erklang. »Ach ja?«
In meinen Augenwinkeln bemerkte ich, dass Saskia zu uns stolzierte. Wie üblich trug sie viel zu viel Make-up und einen zu knappen Rock. Die ewig langen schwarzen Haare hatte sie zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden.
Sie musterte mich abschätzig. »Ist unser Mauerblümchen mit ihren Gedanken wieder einmal ganz wo anders?«
»Wahrscheinlich denkt sie an ihren eingebildeten Freund«, vermutete Anna lachend. »Welcher Mann würde sich auch für die interessieren?«
Betroffenheit und Scham schnürten mir die Kehle zu.
Weshalb mussten sie solche gemeinen Dinge sagen? Ich regte mich schließlich nicht auf, wenn ihnen Fehler passierten – obgleich dies so gut wie nie geschah.
Schluckend hob ich den Blick an. »Warum interessiert dich das überhaupt?« Ich klang genauso unsicher, wie ich mich tagein, tagaus fühlte. »Mich interessiert es ja auch nicht, ob du einen Freund hast oder nicht. Oder, wie viele du bereits hattest.«
Es überraschte mich, wie leicht diese Äußerung aus mir drang. Doch gleichermaßen schnell, wie ich mich an meinem Mut erfreute, überfiel mich eine Welle Panik, ausgelöst durch Annas ebenmäßiges Gesicht, welches sich zu einer zornerfüllten Fratze verzog.
»Was mich das interessiert?! Ich muss schließlich deine Fehler ausbessern!« Ihre braunen Augen funkelten. »Also halt den Mund und schreib die richtigen Beträge auf, anstatt dich aufzuregen!«
Aufwallende Furcht unterdrückend setzte ich meine Arbeit fort.
Es hatte keinen Sinn, etwas Weiteres zu entgegnen. Sie fand andauernd Widerworte – ob sie im Recht lag oder nicht. Darüber hinaus war mein Mut längst verschwunden.
»Wahrscheinlich ist sie bloß frustriert, weil sie keinen abbekommt«, hörte ich Saskias Kratzstimme verlauten. »Das musst du ihr schon durchgehen lassen … Sie hat halt niemanden. Da bleiben ihr nur Fantasien übrig.«
Anna kicherte. Es klang weniger schadenfroh, als vielmehr böswillig. »Wie viel Fantasie kann ein unerfahrenes Ding, wie die, haben? Die weiß bestimmt nicht mal, wie ein Männerschwanz aussieht.«
Mir wurde es übel.
Wie ich solche Bezeichnungen verachtete! Dermaßen aufgestylt und ladylike sich diese zwei Frauen gaben, derart taktlos klangen sie, alsbald sie den Mund aufmachten.
»Die weiß ja nicht einmal, wie eine richtige weibliche Brust aussieht!«, flötete Saskia.
»Ja, genau«, gab Anna sarkastisch zurück. »So flach, wie die ist.«
»Und damit wäre geklärt, weshalb sie keinen Macker abkriegt.«
Ein Kichern beiderseits folgte.
Das Zittern meiner Hände nahm an Intensität zu.
Ihre Worte taten mir unbeschreiblich weh.
Warum mussten sie sich ausgerechnet über das lustig machen, was ich mir so sehr wünschte, aber niemals bekam?
»Also, Kitty.« Säuselnd lehnte Anna sich zu mir. Ein Schwall an ekelerregendem süßen Parfum kroch mir in die Nase. Zugleich durchbohrte ein Stich mein schmerzendes Herz. »Du kommst jetzt alleine zurecht oder?«
Auf diese erniedrigende Weise nannte sie mich, seitdem sie ein Gespräch zwischen mir und einer Kollegin aufgefangen hatte, in welchem wir über Haustiere unserer Kindheit gesprochen hatten.
Von meinen Eltern hatte ich im zarten Alter von acht Jahren eine Katze geschenkt bekommen. Lieber wäre ihnen ein Hund gewesen. Bedauerlicherweise fehlte dazu das nötige Geld. Mir selbst war es komplett egal. Ich war einfach glücklich, ein Haustier mein Eigen nennen zu dürfen. Schließlich hatte ich keine Freunde oder Geschwister, und mit dieser kleinen süßen Katze fühlte ich mich bedeutend weniger allein. Sie war ein wunderbarer Spielgefährte gewesen. Und oft, wenn sie sich zu mir ins Bett gekuschelt hatte, hatte ich mir meinen Kummer von der Seele geweint … Das Mobbing, die Ängste, das Gefühl der Unfähigkeit …
Da ich der Kollegin damals von den vielen Abenteuern mit meiner kleinen Katze erzählte – unter anderem, wie niedlich sie in meinem Bett geschlafen oder in der Wiese herumgetollt hatte – nahm Anna dieses Gespräch selbstredend zum Anlass, sich über mich lustig zu machen. Erst hatte sie darüber gespottet, wie ich ein schmutziges Tier, das weiß Gott, wo überall herumstreunte, in meinem Bett schlafen lassen könne. Dann meinte sie, eine Katze sei kein Spielgefährte. Ein Tier wäre schließlich bloß ein dummes Tier – ohne Emotionen oder Intellekt. Und zu allem Überfluss folgte der Spitzname »Kitty«.
Anfangs hatte ich die Spöttelei mit dem Hintergedanken ignoriert, dass Anna irgendwann ihre Freude daran verlieren würde. Alsdann selbst nach mehreren Wochen keine Veränderung eintreten wollte, hatte ich ihr zu erklären versucht, nicht auf diese Weise genannt werden zu wollen. Ihre Antwort kam prompt: »Du magst doch Katzen, oder hast du gelogen?« Ich verneinte. »Na, dann passt der Name ja perfekt. Was regst du dich auf? Außerdem kann ich mir diesen Namen besser merken.« Es hatte eine Pause gefolgt, ehe sie mit gerümpfter Nase fortgefahren hatte: »Liza … Wer heißt schon so? Deine Mutter muss damals in einer ganz großen Krise gesteckt haben, als sie dir diesen abscheulichen Namen gegeben hat.«
Damit hatte ich mein Brandzeichen erhalten – einen Spitznamen, der überhaupt nicht zu mir passte. Schließlich besaß ich kein Haustier mehr. Wie denn auch! Die Verantwortung war viel zu groß und die Zeit dafür fehlte mir ebenfalls, immerhin arbeitete ich dreißig Stunden in der Woche.
War es bereits schmerzlich genug, auf eine solche Weise genannt zu werden, hörte der herablassende Ton, mit welchem Anna dieses Wort andauernd aussprach, sich noch tausendmal fürchterlicher an.
»Hast du mich gehört?!«, drang Annas polternde Stimme mir ins Ohr.
Ich schreckte hoch. »Ja.«
»Na dann, Kitty.« Sie zeigte mir ein verzogenes Lächeln, dann drehte sie sich um und schritt von dannen – Saskia ihr wie ein treuer Hund nachtrottend.
…
Gott sei Dank waren sie weg.
Lautlos, deshalb nicht minder erleichtert ausatmend drehte ich mich zum Fenster.
Der Herbst war hereingebrochen. Dunkle Regenwolken zierten den Himmel. Ein heftiger Wind wehte, welcher die Zweige der hochgewachsenen Pappeln bedrohlich tief Richtung Boden bog.
Die kriegt doch nie einen ab, echote es mir durch den aufgewühlten Verstand.
Ja, es stimmte. Ich hatte keinen Freund … Ich hatte noch nie einen gehabt.
Weshalb auch? Männer interessierten sich nicht für mich. Das hatten sie nie. Weder im Teenageralter noch jetzt mit dreißig. Weder als ich mit Jeans und Shirts herumgelaufen war noch mit Kleidern. Unbedeutend was ich tat – es hatte nie gereicht.
Vielleicht lag es tatsächlich an meiner Oberweite? Oder an der Brille? Vielleicht auch bloß an meiner Art?
Lange Zeit hatte ich gegrübelt. Jetzt war es mir gleichgültig geworden. Ich war mir im Klaren darüber, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte. Lediglich was genau es war, wusste ich nicht. Wahrscheinlich war ich – wie Anna stets zu sagen pflegte – ein Mauerblümchen und darum uninteressant.
Einen entstehenden Weinkrampf hinunterschluckend richtete ich den leicht getrübten Blick auf die Buchhaltung.
Ich musste die Aufgabe fertigstellen und mich bemühen, einen anderen Posten zu erhalten. Ursprünglich war ich für die Ablage, Datensicherung und Rechnungslegung aufgenommen worden, allerdings hatte Saskia es vermocht, sich meinen Posten anzueignen, wodurch ich mich nun gezwungen sah, eine Arbeit zu machen, die mir bereits in der Schule ärgste Probleme bereitet hatte.
Ich atmete tief durch, fasste nach dem Stift und fuhr damit fort, die restlichen Belegsummen einzutragen.
Um vierzehn Uhr dreißig packte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg nach draußen. Während ich das großräumige mit beigen Marmorfliesen ausgelegte Foyer durchquerte, erblickte ich meinen Arbeitskollegen Tobias. Die linke Hand lässig in die schwarze Hosentasche gesteckt, stand er alleine neben dem Kaffeeautomaten.
Unwillkürlich beschleunigte sich mein Puls.
Tobias war der einzige Mann, mit dem ich mich längere Zeit unterhalten durfte, ohne dabei veräppelt, schief angesehen oder in einer anderen Form beleidigt zu werden. Dies war ein Grund, weshalb ich ihn sehr mochte. Dazu gesellte sich sein unglaublich gutes Aussehen, ebenso sein Kleidungsgeschmack. Er trug ausnahmslos elegante Outfits – Hose, Hemd, Sacco – Winter wie Sommer.
Mittlerweile hatten wir einige Mittagspausen zusammen verbracht und dabei über unsere Trailermusic-Leidenschaft gesprochen. Als ich ihm einige Male Filmtrailer vorgespielt hatte, dessen Lieder ich nicht kannte, hatte er mir auf eindrucksvolle Weise bewiesen, wie unendlich sein Wissensschatz darüber ausfiel. Tobias benötigte keine zehn Sekunden, um Interpret und Produzent zu nennen sowie in welchem Internetshop man den Song käuflich erwerben konnte oder ob dieser überhaupt für den offiziellen Markt freigegeben war.
Seine hellblauen Augen sahen in meine Richtung. Manchmal machten sie auf mich den Eindruck, mir bis in die entlegensten Winkel meiner Seele blicken zu können.
»Hallo Lisa!«, rief er mir freundlich zu. »Schon Feierabend?«
Lächelnd trat ich zu ihm. »Ja.«
Es tat unsagbar gut, wenigstens von einer Person unbefangen angesprochen zu werden.
»Und du? Auch fertig für heute?«
Er bejahte.
Ein sanfter Adrenalinausstoß brachte mein Herz erneut in Schwung.
Sollte ich ihn heute fragen?
Dutzende Male hatte ich es wagen wollen, es im letzten Moment jedoch stets einen Rückzieher gemacht. Immerzu aus demselben Grund: der Angst vor einer Zurückweisung. Der Angst, infolgedessen ignoriert zu werden.
Wie damals … im Kurs. Und die Male davor …
Mit ihm auf ein Getränk gehen.
Gedanklich schüttelte ich den Kopf. Weshalb sollte er es nicht wollen? Schließlich tranken wir auch in der Mittagspause zusammen. Wieso dann nicht einmal außerhalb der Dienstzeiten?
»Tobias?«
Er lächelte. »Ja?«
»Hast du Lust, nach der Arbeit mit mir etwas Trinken zu gehen?«
Das Lächeln verschwand abrupt – und mein Herz hielt für den Bruchteil einer Sekunde inne. »Nein. Für so was habe ich leider keine Zeit.«
Ich hatte die Situation noch nicht gänzlich realisiert, bog plötzlich Anna um die Ecke.
»Hey, Schatz!« Sie warf sich ihm um den Hals und gab ihm einen innigen Kuss. »Wir gehen doch heute ins Kino, oder?«
Er strahlte sie an. »Natürlich, Hase. Um neunzehn Uhr?«
»Nun ja –« Mit dem Zeigefinger malte sie Kreise auf seine Brust – mir krampfte es das Herz zusammen. »Du könntest auch früher vorbeikommen … dann können wir gemeinsam duschen.«
Mich überkam ein heftiger Schwindel. Durch die Seele jagte mir ein solch schmerzhafter Stich, es raubte mir für ein paar Sekunden die Luft.
Anna drehte sich zu mir. »Was glotzt du so? Ist dein Dienst nicht schon vorbei?«
Ohne mein Zutun setzten meine Beine sich in Bewegung.
»Geh nach Hause und verkriech dich dort unter deine Bettdecke«, hörte ich sie nachrufen. Darauf folgte irgendetwas Unverständliches, das Tobias zu ihr sagte. Was es war … es war mir egal geworden. Das Einzige, das mich noch beschäftigte, war, meine Tränen erfolgreich zurückzuhalten.
Alsbald ich in den strömenden Regen hinaustrat, verließen mich meine Kräfte.
Die durch das Kleid dringenden kalten Regentropfen nahm ich bloß am Rande wahr – zu sehr schmerzte mir das Herz.
Was hatte ich verbrochen? Warum passierten solche Dinge stets mir? Warum hatte ich kein Glück mit Menschen? Weshalb gab es keinen Mann, der sich mit mir abgeben wollte?
Tropfnass stieg ich in meinen alten Fiat, startete durch und fuhr los. So wie der Regen erbarmungslos auf die Frontscheibe peitschte, wollten meine Tränen nicht mehr zu fließen aufhören. Gleichgültig wie sehr ich mich bemühte, an etwas anderes zu denken, diese schreckliche, sich hartnäckig um meine Seele geschlungene Traurigkeit gedachte nicht mehr abzunehmen. Im Gegenteil. Je stärker ich mich gegen sie auflehnte, desto größere Ausmaße nahm sie an.
Wie lange dauerte es dieses Mal, bis der Schmerz zur Gänze vorübergezogen war?
Ich lenkte in den Hinterhof des Wohnblocks, parkte den Wagen auf den Parkplatz mit der Nummer sechs – stets einen prüfenden Blick in den rechten Seitenspiegel, ob ich wohl kerzengerade dastand – fasste nach der Tasche und stieg aus. Flott schloss ich die Tür ab und eilte zum Eingang, unter dessen glasüberdachter linken Seite Frau Maier stand und genüsslich an einer Zigarette zog.
Das dämmrige Licht ließ ihre verzwickten Gesichtszüge um einiges verbissener erscheinen, als sie für gewöhnlich wirkten. Die fahle, höchstwahrscheinlich von zu intensivem Sonnenliegen herrührende wie gegerbt aussehende Gesichtshaut, kurze dunkelgraue Haare, Schlupflider, ein spitzes Kinn und eine knochige Nase komplettierten ihre ausgemergelte vom Leben verbitterte dürre Statur.
Sie warf mir einen giftigen Blick zu, von dem mir noch ein wenig unwohler wurde. »So ein weißes Kleid ist nicht gerade vorteilhaft bei Regenwetter.« Ihre tiefe rauchige Stimme unterstrich ihre ohnehin gut sichtbare und in den letzten Monaten oft zur Sprache gebrachte Abneigung gegenüber meinem Kleidungsstil. »Und rote Unterwäsche um einiges weniger.«
Beschämt wie kein Wort über die Lippen bringend huschte ich an ihr vorbei ins Innere des Wohnblocks. Ich wandte mich zum rechts gelegenen Aufzug, entschied mich letztlich aber gegen dessen Benützung. Bis dieser im Erdgeschoss ankam, hätte Frau Maier womöglich fertig geraucht und sich zu mir gesellt.
Mir wurde es mulmig zumute.
Nein.
Weitere Belehrungen und beleidigende Aussagen ertrug ich nicht mehr. Es war genug für heute.
Ich drehte mich nach links. Drei Stockwerke lagen vor mir und einer heißen, entspannenden Dusche …
Mit der letzten Kraft, die ich mir von irgendwoher zusammenkratzte, hechtete ich die Stufen hoch.
Hoffentlich begegnete ich keinen weiteren Mietern. Mein durchnässtes Kleid mit der durchscheinenden Unterwäsche musste nicht jeder sehen. Darüber, da war ich mir sicher, würde sowieso Frau Maier berichten.
Eine jäh in meinem Rücken ertönende, nach mir rufende weibliche Stimme vernichtete jegliche Hoffnung, um stattdessen eine frische Welle Schamgefühl über mich hereinbrechen zu lassen.
Wieso jetzt? Wieso musste ausgerechnet jetzt jemand ins Stiegenhaus treten?
Ich drehte mich um.
Frau Müller mit ihrer wasserstoffblonden lockigen Mähne stand in der Haustür, die Arme vor ihrer Brust verschränkt. »Frau Hirter! Was habe ich Ihnen gesagt?«
Ich verstand nicht …
Genervt über meine verzögerte Reaktion und die daraus entstandene Unfähigkeit, ihr Antwort zu geben, wölbte sie eine Augenbraue. »Sie wissen, Sie sind heute mit der Stiegenhausreinigung dran! Aber bis jetzt ist noch nichts in dieser Richtung passiert.«
Die Reinigung des Stiegenhauses übernahmen wir Mieter. Jede Woche wurde gewechselt. Diese Woche war ich dafür eingeteilt. Und wie jedes Mal liebte Frau Müller es, mich darauf aufmerksam zu machen. Sie selbst sah sich als die Ordnungshüterin des Hauses. Wenn es beispielsweise Beschwerden gab – gleichgültig welcher Art – war sie es, die dies an die Vermietung weiterleitete.
»Ich war Arbeiten«, verteidigte ich mich, wohl wissend, dass ich die Reinigung vor Antritt meines Dienstes hätte erledigen können. Allerdings fühlte ich mich seit mehreren Tagen nicht fit genug, um irgendwann zwischen fünf und sechs Uhr morgens eine solche anstrengende Tätigkeit durchzuführen.
»Alle Leute hier arbeiten«, fuhr sie mich an. »Das hält sie aber nicht davon ab, ihren Pflichten nachzukommen.«
Es wurde mir kalt – ob von meiner regennassen Kleidung oder ihrer unheilschwangeren Bemerkung wusste ich jedoch nicht. »Keine Sorge … das mache ich noch.«
»Ich habe keine Sorge«, gab sie schnippisch zurück. »Sie sollten sich eher Sorgen um sich machen. Wenn Sie so weitermachen, verlieren sie nämlich das Wohnrecht.«
Eine ungleich frostigere Kälte jagte mir über den Rücken.
Mit einem knappen »In Ordnung« verabschiedete ich mich und eilte die letzten Stufen hoch zu meiner Wohnungstür.
Ich musste die Arbeit schnellstmöglich erledigen. Wenn sie sich bei der Vermietung über mich aufregte, hatte ich richtige Probleme.
Bereits des Öfteren war mir zu Ohren gekommen, wie Mieter von heute auf morgen aus ihren Wohnungen geworfen worden waren.
Sollte ich in diesen Genuss kommen … es war nicht auszudenken.
Das Problem lag auf der Hand: Ich kannte niemanden in Klagenfurt oder Umgebung, bei dem ich kurzzeitig unterkommen konnte. Die einzige Möglichkeit der Obdachlosigkeit zu entgehen, wäre somit gewesen, wieder bei meinen Eltern einzuziehen, welche knapp drei Autostunden entfernt von mir lebten. Dies wiederum bedeutete, meine Arbeit aufgeben zu müssen. Und davor fürchtete ich mich weit mehr, als vor einem Wohnungsverlust.
…
Ewig hatte ich gebraucht, um eine Arbeit zu finden – und dann sollte ich meine im Anwachsen befindliche Selbstständigkeit von einem Tage auf den anderen verlieren, alleine aufgrund der Gegebenheit, das Stiegenhaus nicht gewischt zu haben?
Hochzüngelnde Sorgen verdrängend sperrte ich die Tür auf und trat in meine Fünfzig-Quadratmeter-Wohnung.
Ein an Quittenblüten erinnernder, von meinen langsam verblühenden Surfinien, welche ich vor der Herbstkälte vom Balkon gerettet und in den kleinen Vorraum gestellt hatte, herrührender und mit Rosenduft meiner Duftlampe vermischter Geruch wehte mir entgegen, erweckte sanfte Geborgenheit und erlaubte mir die bleierne Traurigkeit der letzten Ereignisse für einen kurzen Moment zu verscheuchen.
Ehe ich etwas aß oder die Wäsche machte, sprang ich erst einmal unter die Dusche.
Mir war furchtbar kalt. Eine Erkältung war das Letzte, das ich jetzt brauchte.
Sobald meine kalte Haut das heiße Wasser empfing, mich allmählich in eine innige Umarmung nahm, brach eine weitere Welle Melancholie über mich herein, welche in Form neuer Tränen einen Weg aus meiner Seele fand.
Weshalb war es so schwer geworden, sich glücklich zu fühlen?
Immerhin besaß ich alles, was ich brauchte: eine Wohnung, gutes Essen, warmes Wasser, schöne Kleidung … Dennoch tat mir der grobe Umgang meiner Mitmenschen jedes Mal in der Seele weh.
War ich zu verweichlicht? Zu empfindlich? Zu sensibel?
Das Stiegenhaus.
Eine Hitzewelle brauste mir durch den Leib, veranlasste mich, mich flott abzutrocknen, in meinen einzigen, alten, dafür unbeschreiblich bequemen Trainingsanzug zu schlüpfen und einen Eimer mit Wasser zu befüllen. Ich schüttete etwas Allzweckreiniger hinzu, fasste nach dem Wischmopp und eilte nach draußen.
Wie jedes Mal brauchte ich eine gute Stunde, bis ich das Erdgeschoss erreichte – müde, mit Kreuzschmerzen und schwachen Armen. Ich drehte mich zurück und blickte zum glänzenden Marmorboden.
Hoffentlich würde es den Mietern passen …
Eine sich schlagartig ausbreitende brutale Müdigkeit verwandelte meine Extremitäten in Blei. Ich drückte die Nach-Oben-Taste des Aufzugs. Es dauerte lange, bis die Türen sich öffneten und ich eintreten durfte. Während der Fahrstuhl nach oben fuhr, wischte ich dessen Boden, ehe ich völlig erschöpft meine Wohnungstür aufsperrte.
Für so was habe ich leider keine Zeit, hallten Tobias’ Worte mir durch den Kopf.
Ohne es zu wollen, kamen mir die Tränen.
Wann waren die beiden ein Paar geworden? Nie hatte ich die zwei zusammen gesehen.
Ich schniefte.
Wie er Anna angelächelt hatte … Würde auch mich irgendwann einmal jemand auf eine solche zärtliche Weise anlächeln wollen?
Einen Kloß hinunterwürgend spülte ich den Eimer aus und stellte ihn hinter die Badtür.
…
Jemand, der mit mir ausging … mit mir verbringen wollte – miteinander lachen, Spaß haben, reden …
Nachdem ich eine Kleinigkeit gegessen hatte, verkroch ich mich ins Bett. Normalerweise las ich gerne ein paar Seiten eines Romans oder sah ein wenig fern. Heute hingegen sehnte ich mich einzig nach Schlaf – einschlafen und nicht mehr über diesen schrecklichen Tag nachdenken. Doch sosehr ich es mir wünschte, der Schlaf wollte sich nicht einstellen … Ich drehte mich von einer Seite auf die andere, tausend Gedanken durch meinen Geist irrend.
Wer will dich schon sehen?!
Spaßbremse!
Zieh dir was Vernünftiges an! Wie läufst du rum!
Bei dir hat man die Nachgeburt aufgezogen.
Seht euch die an … seht sie euch genau an! Die ist verrückt. Mit der dürft ihr euch nicht abgeben.
Tränen quollen aus meinen geschlossenen Augen hervor, benetzten mein Kissen, brachten meinen Körper zum Beben …
Wie viel mehr hatten sie mir an den Kopf geworfen? Wie viel hatte ich verdrängt? Wie viel musste ich noch zu hören bekommen?
…
Die Beleidigungen waren hart – doch gab es da tausendmal fürchterliche Geschehnisse: die Ausgrenzungen, das Stehenlassen, das Ignoriert-Werden, die kalten verächtlichen Blicke.
Schniefend kuschelte ich mich inniger in die Decke.
Wann endlich würden mir ihre Aussagen egal werden? Wann würde ich darüber stehen und ihnen mit einem Lächeln antworten können?
Du kannst es sowieso nicht. Also lass es besser gleich bleiben!
Da wo nichts ist, da kann auch nichts werden!
Gott, ist die blöd!
Ein heftiger Weinkrampf erfasste mich. Ich presste die Lippen aufeinander und betete, dass der brutale Seelenschmerz schnell verschwinden möge.
…
Weshalb wuchsen andere an Schwierigkeiten, hingegen ich an ihnen zu zerbrechen drohte? Woher nahmen andere Menschen diese Stärke? War es möglich, selbst dergestalt stark zu werden?
Tief einatmend wischte ich mir über die nasse Wange.
Ich wünschte lediglich eines: Mich glücklich fühlen – aus vollem Herzen lachen und die kleinen Wunder wiederentdecken können, welche mich einst in ihren Bann gezogen hatten. Ich wollte mich wieder an der Natur, an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen … an der Magie der Stille … des Augenblicks …
Es dauerte endlos lange, bis der erlösende Schlaf sich endlich über mich zu legen gedachte und ich den Schmerzen zu entfliehen vermochte.