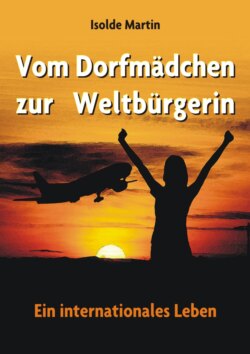Читать книгу Vom Dorfmädchen zur Weltbürgerin - Isolde Martin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIES LAND IST DEIN LAND
ОглавлениеDer fünfstündige Flug von Honolulu nach San Francisco war nur mäßig interessant. Es war mehr eine Sache des Treffens von Meer und Himmel am Horizont. Somit konnte ich meine Gedanken wandern lassen. Vor allen Dingen mein Selbstbewusstsein verlangte nach ungehinderter Aufmerksamkeit. Die polynesischen Inseln, Honolulu, San Francisco und das Land Kalifornien wurden von den Menschen, die in den kälteren Gefilden der Erde lebten, sehr romantisiert und als Traumziele angesehen. Ich, das kleine Mädchen aus Bayern, hatte nun alle diese Wunschlistenplätze besucht und respektive auch dort gelebt — sei es per Zufall oder aus Notwendigkeit. Es bedurfte einiger mentaler Arbeit, diese Tatsache in mein Selbstverständnis zu integrieren. Die Antwort zu der bedeutungsvollen Frage Wer bin ich? musste um eine Weltgereiste erweitert werden.
Bilder und Gedanken kreisten in meinem Kopf, was mich wohl erwarten würde. Die Angst hatte mich fest im Griff. Meine Bemühungen, diesem Neuland gelassen entgegenzusehen, waren vergebens.
Wild durcheinandergewürfelte Bilder und Gedanken schossen mir durch den Kopf, was mich denn dort, nach meiner Ankunft, erwarten wird. Angst hatte mich fest im Griff. Meine Anstrengungen diesem Neuland gelassen entgegenzusehen, kamen nicht dagegen an.
Im September 1972 war es in den USA noch erlaubt, die Ankommenden direkt vor dem Gate abzuholen. Unser Flug war zudem noch ein inneramerikanischer Flug, da wir ja aus dem 50. Staat der USA kamen. Die etwas ältere Dame, die hier stand, war jedoch schon einige Meter innerhalb des Tunnels. Trotz ihrer Brille schien es mir, als hätte sie einen ängstlichen Blick, der durch die vorgeneigte Körperhaltung noch verstärkt wurde. "Hallo Mutter", sagte mein Mann zu ihr. Das ist seine Mutter, fuhr mir das nun Offensichtliche durch den Kopf. Sie ist auch meine zukünftige Schwiegermutter, war als zweite mentale Feststellung erst einmal neutral ausgelegt. Obwohl sie ihren Sohn drei Jahre lang nicht gesehen hatte, wandte sie sich doch ziemlich schnell mir zu. Sie begrüßte mich freundlich, aber, wie mir schien, etwas distanziert. Ich konnte es ihr nachfühlen. Ich war ihr fremd — nicht nur als Mensch, sondern auch kulturell. Es war ja auch nur ein paar Wochen her, dass sie via Telefon aus Australien zu hören bekam, dass ihr Sohn mit seiner Frau kommen würde. Es war mir klar, dass ich in nächster Zeit beobachtet und kategorisiert werden würde, dass ich die Chance hatte, die Weichen für mein Verhältnis zu meinen neuen Verwandten zu stellen, dass ich Herzen gewinnen musste. Für den Moment wurde ich aber als Fait accompli freundlich akzeptiert.
Als wir die Ankunftshalle betraten, warteten meine beiden zukünftigen Schwägerinnen und der Ehemann von einer der beiden auf uns. Sie alle waren gekommen, um ihren weit gereisten Bruder zu empfangen. Natürlich war ich die zweite, noch größere Sensation — eine ausländische Frau in der Familie! Meine ältere Schwägerin kam aus Arizona angereist, was eine eineinhalbtägige Autofahrt, meist durch Wüste, für sie bedeutet hatte. Der Rest der Familienmitglieder musste eine zweistündige Autobahnfahrt in Kauf nehmen, um zum Flughafen von San Francisco zu kommen. In diesen Tagen wusste ich noch nicht, dass dies für Kalifornier im Besonderen und für Amerikaner im Allgemeinen keine große Entfernung war — ich maß mit deutschen Maßstäben.
Während wir auf das Gepäck warteten, machte ich meinen ersten kulturbezogenen Fehler. Ein junger Mann stellte sich neben mich und fragte, ob er mir helfen könne. Gerade hob ich an zu erklären, dass ich keine Hilfe brauche, weil … als mein Mann mit "Nein, danke" unterbrach. Der Ton schien mir etwas kurz angebunden, aber alle anderen blickten stoisch nach vorne. Während der nächsten Zeit versuchte mein Mann mir zu vermitteln, dass man nicht jemandem voll ins Gesicht blickt, wenn man vorbeigeht, anders als in Deutschland. Erst zwei Jahre später erfuhr ich dazu den Hintergrund, in meinem ersten Soziologie-Semester. Der Professor erklärte, dass das Vermeiden von Blickkontakt auf Straßen und öffentlichen Plätzen die Bedeutung von guter Absicht und friedlichem Nebeneinander hat. Das Gegenteil könnte ein Signal der Herausforderung in negativem Sinne sein. Da ich diese meine deutsche Angewohnheit, vorbeigehende Passanten ungehindert zu betrachten, aber nicht über Nacht ablegen konnte, erfuhr ich noch viele kleine Probleme dieser Art während meines folgenden Jahres in Berkeley.
Auf dem Flughafenparkplatz luden wir unsere Koffer in das größte Auto, in dem ich je gefahren bin. Es war mindestens vier Meter lang, fuhr sanft und mit einem ganz leisen Geräusch. Erschöpft von der langen Reise, dem Stress des Neuen und Unbekannten und der vielen Eindrücke, sank ich in die Polster des Rücksitzes. Niemand erwartete von mir Small Talk. Dankbar dafür, konnte ich die vorbeiziehende Stadt und das freie Land ungestört betrachten. Zudem hatten wir schon festgestellt, dass mein seltsames Gemisch von britischem und australischem Englisch für die Familie schwer verständlich war. Das wiederum erzeugte ein Déjà-vu-Gefühl. Ich war wieder neu, Ausländerin und sprachlich auf Kinderniveau. Aber ich nutzte die Gunst der Stunde.
Schon nachdem wir auf die Ostseite der San Francisco Bay kamen, wurde die Landschaft braun beziehungsweise golden, wie mein Mann auch heute noch diese Farbe bezeichnet. Die Gegend blieb so vertrocknet — nicht nur bis Sacramento, sondern bis zum nächsten Frühling. Kühe standen auf einer Wiese, auf der Heu zu wachsen schien. Was sind das für Tiere, die so was fressen? Unsere bayerischen Kühe würden bei dieser Ernährung vermutlich sterben, vermittelte ich meinem Mann augenzwinkernd. Er brüllte vor Lachen und erklärte, dass diese Kühe Steakproduzenten seien und keine Milchkühe.
Meine Erinnerung an diese ersten Eindrücke zwischen Flughafen, San Francisco und Sacramento ist sehr selektiv. Keiner von meinen ersten Eindrücken der Traumstadt ist noch vorhanden. Ich nehme an, dass eine Überladung meiner Sinne am Werk war.
Ein Wort zu ersten Eindrücken
Manche Psychologen haben uns gelehrt, dass sogenannte 'erste Eindrücke' nicht zu unterschätzen sind. Dieser Behauptung stimme ich mit Einschränkungen zu. Ich habe am eigenen Leibe erfahren, dass man mit einem getrübten Urteilsvermögen operiert, wenn man gerade einen Langstreckenflug mit einem Wechsel von Klima- und Zeitzonen hinter sich gebracht hat und der Körper dehydriert ist. In diesem Falle scheinen mir 'zweite Eindrücke', nach einem mehrstündigen Schlaf und ein paar Gläsern Wasser, die objektiveren zu sein. Verschiedene Enttäuschungen und depressive Verstimmung hätte ich vermeiden können, wenn ich erst nach einem zweiten Blick geurteilt hätte.
Als wir in Sacramento ankamen, bestimmte meine Schwiegermutter, erst meinen Schwiegervater an seinem Arbeitsplatz zu besuchen, bevor wir zu ihrem Haus fuhren. Ein etwas korpulenter Mann mit einem sehr freundlichen Gesichtsausdruck kam auf uns zu. Er sah seinen Sohn immer wieder an, als ob er nicht genug bekommen könne. Nicht nur die lange Abwesenheit und die Freude, ihn wieder gesund vor sich zu haben, schienen der Grund dafür gewesen zu sein — schließlich hatte sich sein Sohn äußerlich etwas verändert: Er trug nun einen Vollbart und Haare, die gerade noch über den Schultern hingen. "Heute Abend nach der Arbeit muss ich zum Friseur gehen. Willst du mitkommen?", fragte er seinen Sohn. Aus dem spöttischen Ton seiner Frage schloss ich, dass er keine zustimmende Antwort erwartete.
Die folgenden Tage mit der Familie meines zukünftigen Ehemannes verliefen zwar harmonisch, waren aber doch von einer Atmosphäre vorsichtiger Annäherung geprägt. Später erzählte mir eine meiner Schwägerinnen, dass ich schwer zu verstehen gewesen sei. Meine Sprache wäre eben mit drei verschiedenen Akzenten gespickt gewesen, woran sie alle nicht gewöhnt waren. Ich glaube, dass meine sprachlichen Eigenheiten mich aber noch zusätzlich fremder machten, als meine Nationalität, beziehungsweise die Kulturunterschiede alleine. Ersteres hatte aber auch Vorzüge, denn es wurde benutzt um meine unschuldigen Fauxpas zu erklären. Einen solchen hatte ich schon nach meinem ersten Schnuppertrip in die Umgebung geliefert. Ich fragte die Familie nach dem Grund für die vielen Flaggen, die auf Schulen, Banken, Geschäften und Tankstellen flatterten. War ein Feiertag? Fragende Augen starrten mich an. Mein Mann war lange genug in Deutschland gewesen, um zu wissen, dass eine solche Beflaggung in meiner Heimat nicht üblich war. Er erfasste das heikle Thema sofort und erklärte den Hintergrund meiner Frage. "Na ja, sie ist neu und die Sprache halt …" Ich wusste, dass ich in ein Fettnäpfchen getreten war, das nichts mit Sprachkenntnissen zu tun hatte.
Aber diese Familie war imstande die meisten Dinge mit Humor zu sehen. Als ich in diesen ersten Tagen einmal in der Küche des Hauses stand und bügelte, fragte mich meine Schwiegermutter: "How are you coming through — kommst du klar?" Ich verstand den Sinn der Frage nicht. Mein Mann rief vom Wohnzimmer: "Are you almost finished — bist du bald fertig?" Das Gesicht meiner Schwiegermutter verzog sich zu einem breiten Grinsen: "Are you almost finished — bist du bald fertig?", wiederholte sie folgsam. "Ja, gleich", rief ich.
Nach jenem verlängerten Wochenende in Sacramento war es Zeit für meinen Mann und mich, unser zukünftiges Studentenleben einzurichten. Wiederum stiegen wir alle in das gewaltig große Auto meines zukünftigen Schwiegervaters, um damit nach Berkeley, einer hübschen Universitätsstadt, deren Campus über die Hügel der östlichen San Francisco Bay ausgebreitet lag, zu fahren. Drei Erwachsene — meine zukünftigen Schwiegereltern, die ältere Schwester meines Mannes und deren Baby — begleiteten uns. Eigentlich wollte ich diese schützende Familienenklave noch nicht verlassen. Gerne hätte ich mehr Zeit gehabt, mich in das tägliche Leben einzuleben. Da draußen wäre ich dann auf mich selbst gestellt.
Die nordkalifornische Landschaft, die während dieser neunzigminütigen Fahrt an mir vorbeizog, holte Erinnerung an ein Buch über das Leben von Johann August Sutter, das ich vor langer Zeit gelesen hatte, hervor. Er hatte die Schweiz verlassen, landete 1839, nach einem Umweg über Santa Fe und Oregon, in San Francisco. All das Land, das ich sah, hatte er einmal besessen. Was mich aber viel mehr beschäftigte war die Frage, wie er es geschafft hatte sich von seiner Mutter zu verabschieden, wohl wissend, dass er sie mit größter Wahrscheinlichkeit nie wiedersehen würde. Welche Motivation, welche Verzweiflung, welche Entschlossenheit, welches Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und welchen Glauben an eine positive Zukunft in einem unbekannten Land musste ein Mensch aufbringen, um einen solchen Abschied ertragen zu können? Das hätte ich nicht gekonnt, fuhr es mir durch den Kopf. Flugzeuge, Luftpost und Telefongespräche waren das Glück meiner Zeit. Technologie verkürzte die Entfernung zu meiner Mutter. Sutters Briefe nach Hause waren etwa ein Jahr unterwegs. Somit musste er zwei Jahre auf Antwort warten, sollte sie überhaupt ankommen. In diesem Sinne lebte ich nicht in Pionierzeiten. Dies ist eine moderne Welt, dachte ich und hielt so eine drohende Panik in Schach. Her war ich nicht auf Besuch, hier würde ich ein Studium und eine Ehe beginnen.
Das erste Quarter (die Universität von Kalifornien hatte kein Semester- sondern ein Quartalsystem) würde in einer Woche beginnen, zumindest für meinen Mann. Ich war noch damit beschäftigt, mein Gleichgewicht zwischen Selbstzweifel und Selbstvertrauen herzustellen. War ich verrückt, im reifen Alter von 28 Jahren ein Psychologiestudium zu beginnen, dazu noch in einer Fremdsprache? Konnten wir zwei Studenten eine Familie finanzieren?
Solche Gedanken und die Anstrengung, mich diesem Land und dieser Kultur anzupassen, verursachten genug Stress, dass ich mein erstes Quartal verpasste. Zusätzlich musste unsere Eheschließung vorbereitet werden, denn für mein spezielles Visum war es Bedingung, innerhalb von drei Monaten zu heiraten. Dies war für sich genommen eine monumentale Sache für mich, die ich erstmal verdauen musste.
Ich hatte eigentlich nie vorgehabt mich überhaupt zu verehelichen, ganz besonders nicht mit einem Mann aus einer anderen Kultur. Dieser Mann allerdings, hatte alle meine Grundsätze in dieser Beziehung verändert. Er war mein Traummann. Ich wollte bei ihm bleiben, zu ihm gehören und mein Leben mit im teilen.
Obendrein hatten wir zwei verschiedene Pässe, die in Abwesenheit einer Ehe das Leben durchaus schwieriger gestalten könnten.
Demzufolge empfand ich unsere Eheschließung als Formalität, von wenig Romantik begleitet. Jahre später allerdings mussten wir uns beide eingestehen, dass die ganze Sache uns im Stillen doch mehr beeindruckt hatte, als wir annahmen: Wir heirateten ohne die Anwesenheit von Familienmitgliedern, weißem Kleid oder anderem Tamtam und hatten demnach vor, einfach nur auf das Standesamt zu gehen und dort die vorgeschriebene Zeremonie über uns ergehen zu lassen.
Dies jedoch war nicht ganz so einfach. Das County, in dem Oakland lag, schrieb das Tragen einer Krawatte vor. Aber es waren die 70er — in der Nähe von San Francisco! Die Hippies, Flower Power! Es war das Establishment und Konventionen bekämpfende, progressive, kreative Berkeley, Kalifornien. Keiner unserer Bekannten, die als Trauzeugen fungieren konnten, besaßen eine Krawatte. Deshalb heirateten wir schließlich in der Unitarian Church. Ein Freund meines Mannes aus Wehrdienstzeiten wurde zusammen mit seiner Krawatte und seiner Freundin unser Trauzeuge.
Als wir in das Büro des Geistlichen kamen, wo die Trauung stattfinden sollte, war dieser nicht anwesend. Wir hatten unseren Termin verwechselt und kamen eine Stunde zu spät. Somit hatten wir unser Hochzeitsessen vor der Trauung, die nun am selben Tag am Nachmittag vollzogen werden sollte. Unsere Trauzeugen hatten uns eingeladen. Ihr Haus lag hoch auf den Hügeln und präsentierte uns vom Fenster aus die Bay in ihrer malerischen Schönheit. Sie präsentierten uns auch eine wunderschöne Hochzeitstorte. Endlich war es romantisch! Als schließlich die Trauung vorbei war, verabschiedeten wir uns herzlich voneinander. Mein Mann lud mich ein, mit ihm zur Bibliothek im nördlichen Teil des Campus zu kommen. Seitdem nennen wir den schönen Spaziergang über das herbstliche Gelände unsere Hochzeitsreise.
Zwei Tage nach unserer gelungenen Hochzeit erhielten wir einen Telefonanruf von einem der vier Firmenchefs aus Sydney. Er war der Mann, welcher uns zu jenem Neujahrsempfang in sein Haus eingeladen hatte. Seine Frau und er waren auf einer Reise um den Erdball und wollten uns in unserer Studentenwohnung besuchen. Wir waren beide hocherfreut.
Sie wussten nichts von unserer Vermählung. Erst als ich als Nachspeise den Rest unseres weißen Hochzeitskuchens servierte, erklärten wir uns. Das Ehepaar hatte ich immer als prinzipiell traditionsgebunden erfahren, aber mit sehr viel Toleranz. Deutlich war die Erleichterung auf ihren Gesichtern zu lesen, dass wir uns verehelicht und damit ihren Glauben an unsere anständigen Charakter bestätigt hatten.
Dass ich die beiden so früh wiedersah, kam völlig unerwartet. Vielleicht war die Welt doch nicht so groß, wie ich angenommen hatte? Wir verbrachten nur ein paar Stunden miteinander, aber die Gefühle, die aus diesem Besuch resultierten, sind heute noch wach. Wir hatten Freunde in Australien zurückgelassen, wurden geschätzt, waren nicht vergessen.
Von uns aus traten die beiden die lange Heimreise an. Sie mussten den gewaltigen Pazifik überfliegen, also etwa 13 Stunden sitzen! Der Mann überlies uns ein Buch, welches er gerade auf dieser Globusumrundung gelesen hatten: Die Tyrannei der Entfernung (The Tyranny of Distance). Er scheint sie besiegt zu haben.
Während unserer ersten Wochen in Berkeley mussten wir in einem Studentenmotel wohnen, bis unsere Wohnung, die wir angemietet hatten, bezugsfertig war. Durch Zufall sah ich die Eröffnung des alljährlichen Münchner Oktoberfestes im Fernsehen. Obwohl ich grundsätzlich nicht von Heimweh geplagt war, traf mich dieses Dokumentarstück völlig überraschend und zu einem Zeitpunk der allgemeinen Unsicherheit. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten und meine Gefühle nicht verdrängen. Kein Zweifel, dass ich lieber zu Hause und nicht noch mal neu sein wollte. Schon wieder — war ich denn verrückt erneut ein neues Leben in einem neuen Land, in einer neuen Stadt zu beginnen? Obendrein hatte ich auch noch geheiratet und ein Studium begonnen! Ebenfalls kein Zweifel bestand aber, dass die Unterstützung meines Mannes und mein Stolz mein Durchhaltevermögen stärkten. Verrückt, oder?
Offensichtlich war meine Fähigkeit Neues zu akzeptieren beinahe aufgebraucht. Dennoch wurde eben gerade diese Eigenschaft nach meiner Eheschließung schwer auf die Probe gestellt. Nach meiner Ankunft in San Francisco, beziehungsweise Berkeley, musste ich zum deutschen Konsulat, um meinen Wohnort im Pass ändern zu lassen. Nun musste mein Name, den ich 28 Jahre getragen hatte, gestrichen und mein neuer Name eingesetzt werden. In dem Pass, mit dem ich vor einem Jahr Deutschland verlassen hatte, war nun nur noch die Staatsbürgerschaft original. Ich fühlte mich nicht mehr von diesem Papier repräsentiert. Ich war nicht mehr aus München und hatte meinen Familiennamen verloren. Es schien mir, als ob ich eliminiert worden wäre und eine andere Person meiner Statt im Pass stünde. Dieses Problem meiner Identität war so groß, dass mein Mann mich mit blasser Gesichtsfarbe fragte, ob ich mir noch mal alles überlegen wolle.
Ein weiterer Test meiner Widerstandskraft erfolgte in den ersten Wochen nach unserer Ankunft in Berkeley. Wir wohnten noch in jenem Studentenmotel und mussten deshalb abends jeweils in einem der vielen kleinen, gemütlichen Restaurants essen. Ich mochte das gerne, da ich so das Nachtleben meines neuen Domizils kennenlernen konnte. Als wir uns eines Abends auf dem Rückweg von einem solchen Lokal befanden, wurde die angenehme Atmosphäre jäh gestört. Das Ereignis erinnerte mich daran, dass Berkeley auch der Platz der Studentenunruhen und Proteste gegen alles Mögliche war und eine aggressive Subkultur hatte. Als wir gerade an einem wartenden Citybus vorbeigingen, kamen drei junge Männer angestürmt, die schnell in den Bus sprangen, bevor er die Türen schloss. Danach wischte mein Mann mit seiner Hand den Ärmel meines Mantels ab. Ich realisierte, dass ich gerade angespuckt worden war. Erst am nächsten Morgen aber, als mein Mann schon zur Uni gegangen war, wurde mir die Bedeutung des Vorfalls klar. Ein Schock setzte ein. Ich hatte einen Patchwork-Ledermantel getragen, den ich mir vor Jahren in München gekauft hatte. Solche Kleidung signalisierte die Zugehörigkeit zum Establishment. Zu dieser Zeit war Understatement gefragt. Arm und etwas schmutzig musste man aussehen. Ich hatte meine Lektion gelernt!
Dem Schock folgte panikartiges Verhalten: In diesem Land kann ich nicht leben. Während mein Mann in der Universität war, suchte ich die Telefonnummer der Lufthansa, um einen Flug nach Hause zu buchen. Der Gedanke, dass ich mich mit meinem Mann besprechen sollte, kam mir nicht in den Sinn. Glücklicherweise war die Lufthansanummer ständig besetzt. Auf solche Weise blockiert, beruhigte ich mich so weit, dass realistisches Denken zurückkehren konnte: Ich muss meinen Mann von meinem Vorhaben informieren, ich kann ihn nicht einfach verlassen … gerade bei ihm möchte ich auf jeden Fall bleiben, wir sind ja eigentlich noch nicht mal verheiratet … Langsam bekam ich wieder stabilen Boden unter meine Füße.
Am Abend bemühte sich mein Mann, mir die lange Geschichte zwischen der schwarzen und der weißen Bevölkerung in seinem Land detailliert nahezubringen. Es half mir, den Vorfall im Zusammenhang zu sehen. Aber die Erkenntnis, dass ich nun als weiß galt, sozusagen eine Rasse hatte, musste ich erst verdauen. Noch nie hatte ich mich so gesehen.
Letztlich nahm ich eine abwartende Haltung ein. Schock und Panik verflüchtigten sich. Jedoch ein Rest von paranoidem Verhalten, welches ich mit Vorsicht umschrieb, blieb das ganze Jahr bestehen. Ich trug meinen Patchworkmantel mutig weiter, aber nie mehr ohne Angst. Er ist noch heute in meinem Besitz.
Ein weiteres Indiz meiner unbewältigten, neuesten Vergangenheit, war mein Bemühen nicht gut auszusehen, wenn ich auf die Straße ging. Jedes Mal, bevor ich die Wohnung verließ, prüfte ich mich in diesem Sinne. Die sicherlich richtige Erklärung, dass solche Dinge überall passieren könnten und der statistische Faktor der Wiederholung gering war, hielt ich mir zur Bewältigung der Angst auf der Straße immer wieder vor Augen. Es half sehr im täglichen Trott. Aber auf einer anderen, emotionalen Ebene, vertraute ich der Theorie nicht. Dieses Gefühl wurde noch durch Dinge, die ich beobachtete, bestärkt.
Nachdem unser Studentenbudget den Besitz eines Autos ausschloss, musste ich täglich zu Fuß gehen oder den Bus benutzen, um zu meinem College zu gelangen oder einzukaufen. Oft wurde ich mit der Frage, ob ich zehn Cents übrig hätte, angepöbelt. Einmal rief mir eine junge Frau aus etwa fünf Metern Entfernung etwas zu. Prompt verstand ich den Zuruf nicht. Naiverweise blieb ich vor ihr stehen, entschuldigte mich für mein ungenügendes Englisch und bat sie zu wiederholen, was sie gerufen hatte. Sie sah mich aus glasig glänzenden Augen an und ging dann schweigend weiter. Auf meinem Weg zur Bushaltestelle dämmerte mir, dass sie wahrscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden hatte und mich provozieren wollte. Ein andermal, als ich über den Uni-Campus lief, sagte mir ein junger Mann im Vorbeigehen, dass er vermute, ich käme aus einer Klasse für Models. Das war dort damals nahezu verachtenswert.
Durch solch stete Erlebnisse erfuhr mein paranoides Verhalten immer wieder neue Daseinsberechtigung. Einmal, als ich schon auf dem Weg zum Bus war, ging ich noch mal zurück zu unserer Wohnung, um mich umzuziehen. Ich trug einen Kunstfellmantel und meinte, dass er zu viel beachtet wurde. Somit tauschte ich ihn gegen eine wesentlich leichtere Jacke aus, in der ich fror. Wenigstens aber sah sie etwas schlabbriger aus.
Solches Verhalten meinerseits war meiner emotionalen Stabilität nicht förderlich. Mir war klar, dass meine Selbstverleugnung, um Konfrontationen auf der Straße zu vermeiden, begrenzt werden musste. Jedoch schien ich reichlich empirische Daten zu sammeln, die zu bestätigen schienen, dass ich in dieser Umgebung vorsichtig sein musste. Ein paar solcher Bestätigungen sind mir noch lebhaft in Erinnerung:
Ich sah zwei junge Mädchen ein anderes Mädchen die Straße hinunterjagen, um sie dann an ihren langen Haaren zu ziehen. Minuten später fragte ich das Opfer nach der Ursache. Sie erzählte mir, dass die beiden sie um Geld gebeten hatten, was sie ihnen verweigerte. Die beiden traten dann mit aggressivem Gesichtsausdruck auch an mich heran. Mein Nein ließ sie aber friedlich abziehen. Glück gehabt, dachte ich erleichtert.
Weiter beobachtete ich einmal im Bus einen jungen Mann, der aus einer Tüte Klebstoffdunst inhalierte. Obwohl ich den typischen Geruch eines solchen Stoffes schon beim Einstieg wahrnahm, war ich doch unbedarft genug, keinen Argwohn zu schöpfen. Aber mein Mann kannte Berkeley schon seit langen Jahren und klärte mich auf.
Ein andermal saß mir ein Mann gegenüber, ebenfalls im Bus, der einen silbrigen Koffer auf seinem Schoss hielt. Er hatte an beiden Seiten Vasen angeklebt, aus denen Kunstblumen ragten. Er selbst trug einen goldenen Helm und machte einen verstörten Eindruck.
Als ich mit meinem Mann in einem Restaurant zu Abend aß, saßen am Nachbartisch zwei Frauen, die eine Menge süßer Speisen aßen und sich dann über den Tisch erbrachen. Zu der Zeit nahm man an, dass sie Drogensüchtige waren.
München war damals auch nicht immun gegen die Hippiezeit, die Anti-Establishment-Einstellung der Jugend oder Drogen, aber in dieser Intensität hatte ich das noch nie erlebt. Ich stand sozusagen unter Subkulturschock.
Die meisten dieser Erlebnisse erzählte ich unserem langsam wachsenden Freundeskreis. Als Einheimische gaben sie mir diverse Ratschläge: ignoriere die Menschen, sieh ihnen nicht ins Gesicht, sei nicht schüchtern, sieh nicht europäisch aus … Daraus entwickelte ich ein Konzept, das es mir ermöglichte mich anzupassen und mein Selbstwertgefühl zu erhalten. Obwohl ich meinen Kleidungsstil im Understatement-Bereich hielt, konnte ich meine Integrität halbwegs bewahren. Ich hatte auch eine Grenze der Anpassung gesetzt. Sie hielt mich davon ab, Löcher in meine Jeans zu schneiden. Das tägliche Dilemma, gut aussehen zu wollen, wie jede normale Frau, aber es nicht zu dürfen, blieb bestehen. Aber ich konnte es mit Humor und Fassung tragen. Mit anderen Worten: Ich habe die Grenzen meiner Anpassungsfähigkeit erkannt, habe eine Strategie und Philosophie erstellt, die es mir ermöglichte, meine Integrität und damit auch meinen Respekt vor mir selbst zu bewahren.
Ein Wort über innere Spannung und Konfliktlösung
Ambivalenz, Ungewissheit und innere Konflikte sind unvermeidliche Teile des menschlichen Lebens. Jeder von uns hat seine individuellen Methoden damit umzugehen. Auf die Dauer aber, sind sie schwer zu ertragen und müssen bewältigt werden, wollen wir bei emotionaler Gesundheit bleiben. Der Sozialpsychologe Leon Festinger erforschte diese Phänomene und stellte 1975 folgende Theorie der 'kognitiven Dissonanz' auf: "Um diese Dissonanz zu reduzieren, muss man die Geisteshaltung in einem gegebenen Fall so verändern, dass sie mit dem Verhalten oder Benehmen übereinstimmt." Mit anderen Worten: Man ändere entweder sein Verhalten, damit es mit der Ansicht oder Meinung übereinstimmt, oder man ändere das Denken, um es dem Verhalten anzupassen. In meinem Fall, passte ich bis zu einem gewissen Maß mein Verhalten an, aber mein innerer Widerstand dazu blieb weitgehend erhalten. In einem Leben in fremden Kulturen muss man sich dieser Herausforderung häufig stellen.
Als das zweite akademische Quartal nahte, war es Zeit für meine Immatrikulation. Mein Mann erfüllte sein Versprechen, mit mir zum erstenClass Sign-up zu gehen. Mit dem Bus fuhren wir zum Merritt College, welches malerisch auf dem Gipfel eines der Hügel um die San Francisco Bay lag und eine herrliche Aussicht über die Bay Area bot.
In der Halle fanden wir den Tisch für Englisch als Fremdsprache.
"Haben Sie noch etwas frei für diesen Kurs?", fragte mein Mann den Professor.
Ich stand in sicherer Entfernung, etwas schräg hinter ihm.
"Welcher Berater hat ihnen diesen Kurs empfohlen?", wunderte sich der Professor.
"Es ist nicht für mich", sagte mein Mann. "Es ist für sie!" Er schob mich nach vorne.
Wir erklärten, lachten und trugen mich ein. Für die nächsten zwei Quartale kam ich dreimal pro Woche mit etwa 20 ausländischen Studenten in diesen Kurs. Sie kamen aus mindestens drei Erdteilen. Uns verbanden nicht nur die gleichen Ziele und die gleichen Ambitionen, sondern auch die Erlebnisse in diesem fremden Land. Diese solidarische Stimmung unter uns half mir, weiter Stabilität und Identität zu entwickeln. Ich war nicht allein mit meinen Erlebnissen und Ängsten.
Es gab noch zwei weitere Quellen der moralischen Unterstützung, die Verständnis hatten, aber kaum Kritik übten. Die erste war mein Mann. Geduldig versuchte er, die Hintergründe für die sozialen Gegebenheiten in Berkeley zu erklären, soweit er konnte. Über die Zeit hinweg lernte ich damit die Menschen in diesem Stück Land besser verstehen. Weitere Inspirationen flogen mir geradezu von den Architekturstudenten zu, mit denen ich zusammenkam, wenn mein Mann abends zur Uni musste und ich ihn begleitete. Sie verhielten sich mir gegenüber tolerant und schienen mich problemlos als weitere ausländische Studentin zu akzeptieren. Ihr großartiger Intellekt, ihre Fragen, ihre generell lockere Lebensweise, ihr Enthusiasmus, mit dem sie ihr oft sehr hartes Studentenleben genossen, zeigte mir die andere Seite der Berkeley-Medaille. Sie, zusammen mit meinem Mann, standen als Beispiel für Balance und rationelles, objektives Denken. Sie waren großartige Menschen und fungierten für mich als Vorbilder, zur Nachahmung empfohlen.
Mein Mann vollbrachte die gewaltige Leistung, ein zweijähriges Master-Programm in einem Jahr zu absolvieren. Ich hatte die Ehre seine Masterarbeit, die Thesis, auf einer etwa sieben Jahre alten Schreibmaschine zu tippen, durch die Nacht durch versteht sich. Als ich in den frühen Morgenstunden aufgab, machte sich der Kandidat bereit, die letzten Absätze noch selbst hinzuzufügen. Dabei merkte er, dass ich die britische Rechtschreibung benutzt hatte. Leider war es zu spät, die vielen Seiten noch einmal in amerikanisches Englisch zu ändern. In etwa drei Stunden musste das Ding eingereicht werden, nachdem es gebunden worden war. Letzteres was kein Problem, da die Buchbindereien dieser Studentenstadt während der Examenszeiten fast 24 Stunden geöffnet waren. Die Thesis wurde mit ein paar sarkastischen Bemerkungen akzeptiert. Ich wurde in kleinem Kreis als die Frau, die die Mastersthesis mit britischem Akzent schuf, berühmt. Welche Toleranz diese Universität besaß!
Meine Schwiegereltern erschienen zur Graduation Ceremony in demselben riesigen Auto, in dem wir vor etwa zehn Monaten vom Flughafen abgeholt worden waren. Doch Berkeley war nicht San Francisco. Als mein Schwiegervater geparkt und ein paar Meter vom Auto weggegangen war, traf ihn ein faustgroßer Stein am Hals. "Es ist gut, dass mein Sohn fertig ist", sagte er. "Ich werde nie wieder nach Berkeley kommen."
Wir applaudierten und jubelten, als mein Mann über die Bühne schritt. Studenten saßen auf Fensterbrettern, über mehrere Stockwerke von Wurster Hall verteilt, und ließen ihre Beine nach draußen baumeln. Sie johlten, klatschten und pfiffen, als ihr Studienkollege das Diplom erhielt. Welche andere Universität hätte eine solch fröhliche, unorthodoxe Zeremonie erlaubt? Gab es noch eine andere Studentenschaft, die ihren Hausmeister bestimmte, die Ansprache zu halten? "Er kennt uns am besten, er weiß unsere Namen, er war immer da, er hörte uns zu, wenn wir jammerten oder wütend waren", erklärten sie ihre Wahl. Ich fühlte mich solchem Geist verwandt. Am Ende schätzte ich mich glücklich und fühlte sogar Stolz, dass ich Teil von diesem Ganzen sein konnte. Meine Ambivalenz war groß. Ich hatte genug von der San Francisco Bay Area und Berkeley, aber ein Teil von mir wollte auch bleiben. Aber es war Zeit die kognitive Dissonanz zu lösen und weiter zu ziehen.