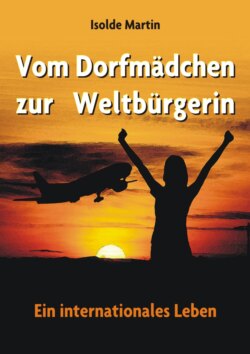Читать книгу Vom Dorfmädchen zur Weltbürgerin - Isolde Martin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DER FÜNFTE KONTINENT
ОглавлениеGleich nach unserer Ankunft in unserem Hotel in Sydney schickten wir ein Gut-angekommen-Telegramm an meine Mutter, um ihr wenigstens diese Sorge zu nehmen. Auf unserem Weg zur Post erhielt ich die erste Lektion der Überlebensstrategien in diesem Land des Linksverkehrs: Nicht erst nach links und dann nach rechts schauen, sondern umgekehrt, erst rechts, dann links. Mein Gehirn an diese Änderung zu gewöhnen, sollte ein Kampf werden, der die gesamte Dauer unseres Aufenthaltes in Australien anhielt.
Ich gewöhnte mich wenig an den Linksverkehr und hatte einige Male Glück, nicht überfahren zu werden. Die verlässlichste Strategie meinerseits bestand darin, erst in die Richtung zu blicken, die mir falsch erschien. Es gab ein Kaufhaus, welches ich gerne mochte und häufig auf dem Heimweg von meinem Arbeitsplatz besuchte. Wenn ich dieses Geschäft verließ, testete ich meine Theorie: Erst ging ich ein paar Meter zur doppelt falschen Bushaltestelle, also die für den Rechtsverkehr. Dort überquerte ich dann die Straße zu der Haltestelle die ich wirklich brauchte, um meinen Bus zu erwischen. Aber auch als ich dann in die Richtung unserer Wohnung fuhr, hatte ich die halbe Strecke lang das Gefühl, dass es falsch war. Allmählich begriff mein Gehirn, dass ich dem Gefühl falsch nachgehen musste, um richtig zu liegen.
Aber nicht nur der Verkehr schien mir paradox. Auch das Meer in all seiner Schönheit war nicht dort, wo ich es gewöhnt war. Wenn jemand die ersten 26 Jahre des Lebens die Nordsee im Norden und den Atlantik im Westen wusste und nun der Pazifik im Osten lag, war das eine höchst verwirrende geografische Referenz der Orientierung. Wiederum weigerte sich mein unflexibles Gehirn diese Tatsache zu integrieren und schickte mich deshalb häufig auf Irrwege in der Stadt. Ich bewunderte meinen Verlobten, der keinerlei Orientierungsprobleme zu haben schien und deshalb zum Beispiel nie vor ein herannahendes Auto lief.
Einige Tage nach unserer Ankunft erschien er wie selbstverständlich mit einem Mietauto. Er erklärte, dass unsere Wohnungssuche wesentlich einfacher und komfortabler sei, wenn wir uneingeschränkte, vom städtischen Bussystem unabhängige Mobilität besäßen.
"Du möchtest mit diesem Auto fahren?", fragte ich.
"Uhm", antwortete er.
"Jetzt?"
"Yep!"
Er setzte sich ans Steuer auf der rechten Seite des Autos, schaltete mit der linken Hand, begleitet von gelegentlichen Ups-Ausrufen. Humor ist die beste Medizin, sagt man, wenn es gilt angsterregende Situationen zu meistern: "Well, dann schick' mal ein Stoßgebet zum Himmel!"
Wir fuhren, unsere Ängste ignorierend, los.
Wie selbstverständlich saß er auf der falschen Seite des Autos und fuhr auf der falschen Seite der Straße, als ob er linksseitig geboren wäre. In unserer gesamten Zeit auf australischen Straßen hat er keinen Kratzer in unser Auto gebracht. Leichter Neid nagte an mir. Scheinbar hatte ich in meiner Jugend versäumt eine wichtige Fähigkeit zu erlernen. In der gesamten Zeit fuhr ich kein einziges Mal selber in Sidney. Meine räumliche Orientierung blieb marginal. Später half ich mir selbst mit der Theorie, dass Architekten visuell besonders ausgebildet werden und Männer im Allgemeinen über besseres räumliches Sehen verfügen.
Aber mein Tag der Selbstdarstellung und des Sieges über neue Probleme kam, als wir endlich in unsere hübsche Wohnung eingezogen waren, etwa drei Wochen nach unserer Ankunft. Das Gebäude lag auf einem Hügel, der eine schöne Aussicht über Paddington und Elizabeth Harbor bot. Jeder von uns besaß zwei Koffer voll von persönlichen Dingen. Alle weiteren Sachen, die wir benötigten, um ein halbwegs gemütliches Zuhause zu schaffen, mussten gekauft werden. Unser begrenztes Budget bestimmte, was wir erwerben konnten. So kauften wir Holzplatten, aus denen wir eine Art Plateau herstellten. Darauf kamen unsere Matratzen. Sie waren mit unserem einzigen Betttuch überzogen. Ebenso zimmerte mein Verlobter einen Wohnzimmertisch, der auch als Esstisch dienen musste. Um beide Funktionen zu erfüllen, musste er mittelmäßig hoch sein. Die zwei Stühle, die wir in einem Geschäft kauften, das mich an einen Flohmarkt erinnerte, mussten in der Höhe angepasst und deshalb abgesägt werden. Küche und Bad waren vom Besitzer schon eingebaut. Somit war das La-Boheme-Apartement fertig.
Unser Budget erlaubte uns nicht, ständig in Restaurants zu speisen. Jedoch hatte noch keiner von uns daran gedacht, den Kühlschrank zu füllen. Als mein Verlobter auf einem unserer geschätzten Stühle stand, um eine Lampe aufzuhängen, war es gerade Mittagszeit und mein Magen knurrte. Er aber war ein Mann, der Hunger und Essen vergaß, wenn eine Arbeit erledigt werden musste. Somit war die Ernährung von uns beiden meine Aufgabe. Ich war allerdings keine begeisterte Köchin und meine Fähigkeiten in diesem Fach beschränkt. Unschuldig dachte ich, ob ich denn wirklich kochen musste und was um alles in der Welt es sein sollte. Es musste auf jeden Fall eines sein, wozu ich kein Rezept brauchte, denn ich hatte keines mitgebracht. Die bayerische Küche rettete mich. Ich sah zu diesem geduldigen, toleranten Mann auf dem Stuhl hoch und fragte: "Möchtest du abgebräunten Leberkäse mit Spiegelei, Kartoffelsalat und grünem Salat zum Mittagessen?"
Seine Antwort kam in lässigem Stil, sachlich und ohne Anzeichen von Spott: "Weißt du, wie man es zubereitet?" Er hatte sich definitiv nicht wegen meines kulinarischen Expertentums in mich verliebt.
Den deutschen Emigranten sei es gedankt, dass ich am anderen Ende der Welt Leberkäse finden konnte. Ich ging Einkaufen, kam zurück und kochte. Es war ein herrliches Mahl! Ich kam, sah und siegte!
Am nächsten Tag jedoch traf mich die Erkenntnis, dass diese Notwendigkeit, ein Mahl zu bereiten, nun jeden Tag und für immer im Raum stehen würde. Was tun? Als ich 15 Jahre alt war, wurde ich einmal für ein Jahr in eine Kochschule in den bayerischen Alpen gesteckt. Nun versuchte ich mich an Rezepte zu erinnern. Aber ich sah nur die Bilder von Gerichten vor meinen Augen. Mein Verlobter schrieb an eine Bekannte, die wir in München zurückgelassen hatten. Sie schickte zwei Seiten Rezepte für Anfänger wie mich, liebevoll handgeschrieben. Von meiner Mutter erhielt ich ein Kochbuch mit dem Titel Bayerische Spezialitäten. Für sie war ich eben ihr bayerisches Mädchen, deren kulinarische Geschmacksrichtung sie gut kannte. Abgesehen von der Tatsache, dass man für bayerisches Kochen etliche Stunden pro Mahlzeit benötigt, war es auch schwer, in Sydney die richtigen Zutaten dafür zu bekommen. Ich bat um ein anderes Buch: Die schnelle Küche. So weit, so gut. Als ich müde vom Umrechnen der metrischen Maße wurde, erstellte mir mein Verlobter eine Liste jeglicher Maße, die man in einem angelsächsischen Leben brauchen könnte: Quarts, Pints, Unzen, Pfund, Yards, Zoll, Fuß, Meilen, Temperatur in Fahrenheit und, jawohl, die britischen Stones. Diese mit liebender Hand produzierte Liste habe ich von Kontinent zu Kontinent mit umgezogen. Ich hütete sie, wie der Homo sapiens das Feuer, das er zu Urzeiten errang. Meine Küche hat aber seit damals immer zwei Sets von Maßen und Geräten zum Messen, sowie Rezepte in deutscher und englischer Sprache enthalten. Über die Jahre hinweg habe ich Rezepte aus allen Ländern, in denen ich gelebt habe, gesammelt, meist nur als Souvenir.
Mit Geduld für Recherchen und der Hilfe meines Verlobten erlernte ich langsam, uns in Australien kulinarisch akzeptabel zu versorgen. Wir hatten einen ungarischen Metzger gefunden, der Fleisch auf meine gewohnte Art schneiden und auch die australisch-englische Art erklären konnte. Die Bäckerei von französischen Einwanderern versorgte uns mit wohlschmeckendem Brot.
All dies schien mir zu helfen, den berühmten Kulturschock zu vermeiden. Es gab allerdings Anzeichen, dass hier der Wunsch der Vater des Gedankens war. Mein Ego wurde arg gestresst und konnte mein Selbstvertrauen und mein Selbstwertgefühl noch nicht heben. Mein gestörter Orientierungssinn und die Gewöhnungsbedürftigkeit des linksseitigen Autofahrens, sollte ich das lernen müssen, nagten an meinem Stolz. Aber es würde noch mehr dieser Sorte auf mich zukommen.
Da war zum Beispiel das Problem der Sprachauffassung, die durch den australischen Akzent sehr erschwert wurde: Mit zwei Jahren amerikanischem Business-Englisch und zwei Jahren britischem Englisch kam ich in Deutschland gut zurecht. Allerdings hatte ich bis dato mit keinem muttersprachlich Englisch sprechenden Menschen außerhalb akademischer Kreise gesprochen, außer während meiner einzigen Woche in London. In Australien zeigte sich bald, was mir fehlte. Das führte zu Hemmungen und schüchternem Vermeiden zu sprechen. Wie erwähnt: Der australische Akzent machte es zusätzlich schwer, einer Unterhaltung zwischen mehreren Beteiligten zu folgen. Als Neuankömmlinge wurden wir von freundlichen und verständnisvollen Australiern häufig eingeladen. In solchen Runden verlor ich den Faden der Konversation meist schnell. Manchmal saß ich schweigend dabei. Schnell merkte ich auch, dass meine Fragen den Unterhaltungsfluss sehr störten. Allmählich zog ich sogar vor, nicht angesprochen zu werden, da immer Erklärungen und Übersetzungen und häufig schallendes Gelächter folgten. Außerdem gab es manche empfindliche Seele, die mein Problem nicht nachvollziehen konnte und leicht beleidigt fragte: "Sprechen wir denn so schlecht?" Dieses ganze Szenario belastete meine Psyche sehr.
Ein Wort zu mangelnder Sprachbeherrschung
Das Erlernen der Sprache ist eine der frühesten Aufgaben der Kindheit. Im Allgemeinen sind sich Kleinkinder ihrer lückenhaften Ausdrucksweise und des mangelnden Redeflusses nicht bewusst. So stolpern sie unbedarft durch den Wörterwald, in der Methode des Versuches und Fehlens, begleitet von den entzückten Ausrufen der Erwachsenen als Belohnung. Wenn aber ein Erwachsener auf sprachliches Kinderniveau zurückfällt, ist das eine ganz andere Sache. In meinen ersten Monaten in Australien konnte ich dies an mir selbst beobachten. Nachdem ich mich nicht wie ein Erwachsener — der das benötigte Vokabular und die Sprache nicht flüssig beherrschte — fühlen konnte, fühlte ich mich zwangsläufig eben wie ein kleines Mädchen. Es manifestierte sich durch die vielen Wiederholungen einzelner Ausdrücke, die ich erbitten musste, durch die Übersetzungen, die ich benötigte, durch das Lachen, das ich auf meine holprigen Versuche der Konversation hin erntete, und durch die oft kindische Sprache, die andere mir gegenüber anwandten. Der Verlust sprachlicher Kompetenz kann in Gefühlen der Verletzbarkeit und der verbalen Schutzlosigkeit enden. Viele, mit denen ich dieses Thema besprochen und erforscht hatte, die sich in solchen Situationen befanden oder befunden hatten, bestätigten, dass sogar eine leicht paranoide Verhaltensweise entstehen kann. Indizien dafür sind Misstrauen in die Absichten der einheimischen Sprecher und Argwohn, dass sie unaufrichtig sind. Mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen und mein Selbstverständnis waren durch die psychologische Wirkung der Sprachschwierigkeiten sehr gefordert.
Dieses Dilemma war aber nicht von Dauer. Zum einen musste ich auf der Universität New South Wales weitere Englischkurse belegen, wie vom Gesetz gefordert, zum anderen verbesserte sich meine Sprachkompetenz sehr, als ich anfing in einem Import-Export-Großhandel zu arbeiten, wo ich die deutsch-englische Korrespondenz erledigte. Plötzlich hatte ich auch einen Vorteil durch meine Muttersprache, und nicht nur einen Nachteil. Mein Selbstbewusstsein kehrte zurück. Aber ich fühlte mich auch generell besser, nachdem ich einen Arbeitsplatz gefunden hatte, nach Wochen von Jobinterviews, die immer in Ablehnung geendet hatten. Die Gründe dafür reichten von unter- bis überqualifiziert. Seltsamerweise schienen meine sprachlichen Fähigkeiten nicht besonders wichtig zu sein.
Der Mann, der mich als zweisprachige Sekretärin anheuerte, war ein Emigrant aus Deutschland. Während des Krieges ist er nach Australien ausgewandert, da er als Jude nicht in Deutschland bleiben konnte. Er beherrschte seine Muttersprache noch sehr flüssig und doch klang er nicht mehr ganz ungetrübt wie ein Deutscher. Wegen seiner Nationalität, so erklärte er, wagte er es anfänglich nicht, in den Straßen von Sydney seine heimatliche Sprache zu benutzen. Als Folge waren seine Kinder der elterlichen Sprache kaum mächtig.
Wie dem auch sei, der Weg zurück, zu psychologischem Gleichgewicht und Selbstsicherheit war steinig und passierte sicher nicht in einer linearen Form. Meine Ignoranz den Details dieser Kultur gegenüber bewirkte oft, dass mich meine Kollegen und andere Menschen verständnislos anstarrten oder sich gar verletzt fühlten. Wer hat die Behauptung erstellt, dass Unwissenheit Seligkeit bedeutet?
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an zwei Männer sehr lebhaft. Einer lehrte mich australische Kultur auf die raue Art, der andere schien das mit engelshafter Geduld zu tun. Ersterer führte ein Spirituosengeschäft, so erschien es mir jedenfalls. Es war in einem Hotel untergebracht, welches für mich in keiner Weise so aussah. Denn die Eingangtür führte direkt in eine mit Fließen ausgelegte Beerhall. Unsicher, was die ganze Einrichtung, die ich sah, bedeutete, fragte ich im Liquorstore, ob er denn hier auch Bier verkaufe. "Well, wenn ich das nicht hätte … ", fuhr er mich an. Den restlichen Satz verstand ich nicht, was wohl die Seligkeit war, die Unwissenheit hervorbringen soll. Aber ich verstand den Trend seiner Antwort, besonders nachdem er anfügte: "Wann hast du das Schiff verlassen?" Später bedauerte ich ihm nicht erklärt zu haben, dass in manchen Gegenden der Welt Bier einen zu niedrigen Status einnahm, um in einem feinen Spirituosengeschäft verkauft zu werden. Stattdessen zog ich es vor wegzugehen und meine Wunden zu lecken.
Der zweite Mann benutzte seine gesamte wertvolle Tea Time, mir eben diese schier geheiligte Tradition australischen Lebens zu erklären. Als ich im Import-Export-Lagerhaus anrief, um eine Nummer zu erfragen, meinte dieser gelassene Mann, er hätte jetzt eben gerade Pause, eben Tea Time. Er versprach danach anzurufen. "Könnten Sie nicht die Teetasse beiseitestellen und mir diese eine Nummer geben? Es dauert nur eine Minute?", fragte ich ihn und kam mir dabei nicht allzu fordernd vor. Später lernte ich, dass dieser Satz durch seine deutsche Syntax im Englischen eine leicht beleidigende Semantik mit sich brachte. Ich fühlte mich beschämt. Bis heute danke ich diesem Mann, der mein Problem verstand und meinen Fauxpas ignorierte. Geduldig erklärte er mir die Bedeutung von having tea im Australien von 1971. Es war eine Zeit, in der man sich ausruhte, mit den Kollegen sprach und alberte, eine Kleinigkeit zu sich nahm und last, not least, vielleicht eine Tasse Tee trank. Tea Time war eine Auszeit und durfte nicht gestört werden, es sei denn von einem uneingeweihten Ausländer oder Neuankömmling, fresh of the boat. Ich war sehr verlegen und vergaß diese Lektion nie.
Eine ähnliche Freundlichkeit wurde mir zuteil, als ich für den jährlichen Check-up einen Gynäkologen besuchen musste. Der Arzt wurde mir von einer der Ehefrauen der vier Firmenteilhaber, in deren Betrieb mein Verlobter arbeitete, empfohlen. Etwa eine Woche nach meinem Besuch, erhielt ich einen Brief von diesem Arzt. Ich erschrak schon beim Anblick des Umschlages, da ich wusste, dass man in meiner Heimat nur dann schriftlich benachrichtigt wurde, wenn medizinische Notwendigkeit bestand oder man eine Rechnung erhielt. Ich konnte aber kaum glauben, was ich da las: Dear Miss … Sie werden sich freuen zu hören, dass Ihr Vorsorgetest ein gutes Ergebnis erbrachte. Sollten Sie noch Fragen haben … Wir wünschen Ihnen … Das war der einzige Brief solcher Natur, den ich je von einem Arzt erhalten habe, bis — um gerecht zu sein — ich meine Gynäkologin hier in Deutschland gefunden habe. Natürlich verstehe ich, dass Ärzte wenig Zeit für solch persönliche Zuwendung haben, aber es war schön damals. Ich fühlte mich so respektiert, etwas, das ich zu jener Zeit bitter notwendig hatte.
Als mein Selbstvertrauen in der englischen Sprache wuchs, begann ich auch die Unterhaltungen zu genießen. Gleichzeitig stieg meine Lernkurve in der Cocktailparty-Etikette steil an. Die Ursache dafür war mein Verlobter. Auf einer dieser Stand-up-Partys wurde er Zeuge eines Gespräches zwischen mir und einem etwas älteren Paar. An das Thema der Konversation kann ich mich nicht erinnern, wohl aber an seine kulturelle Unterweisung:
"Liebling, nicht so scharf!" Ich verstand nicht. "Du streitest", erklärte er.
"Und warum nicht?", forderte ich ihn heraus. "Die haben ein Statement in den Raum gestellt und wollen meine Meinung dazu hören."
"Aber niemand möchte es lange diskutieren und zu Ergebnissen kommen. Niemand ist an Fakten interessiert", beharrte er.
"Aber warum schneiden sie das Thema dann überhaupt an?" Ich war konfus und wusste nicht, ob man nun auf Themen eingehen sollte oder nicht. Es kristallisierte sich aber langsam heraus, dass die Antwort irgendwo dazwischen lautete.
"Das ist nur Small Talk. Es wird keine tiefe Diskussion über das Thema erwartet."
"Bitte?"
Es folgte ein Austausch zwischen uns beiden über interkulturelle Party- und Konversationsgepflogenheiten. In den folgenden Dekaden, so meine ich, wurde ich eine Meisterin des angeregten Gespräches, in dem nicht viel gesagt wurde, wann immer die Kleidervorschrift semiformell oder formell war.
Nicht jede Fehlanpassung aber zog unangenehme Folgen nach sich. Manche Andersartigkeit ließ ich mit Neugierde und Faszination über mich ergehen. So war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich Weihnachten und Neujahr im Hochsommer erlebte. Mit viel Spaß stellte ich mir vor, was alles passieren konnte, wenn das deutsche Sprichwort Das geschieht erst, wenn das Neujahr auf den Sommer fällt! wahr werden würde. Da ich nun südlich des Äquators war, ist das am 48. Grad nördlicher Breite Unmögliche wahr geworden. Ich ließ alles, was ich in diesem Zusammenhang verweigert, verschoben oder verleugnet gehört habe, Revue passieren. Es war ein ziemlich albernes Durcheinander in meinem Kopf.
Meine Assoziation mit Nikolaus und Weihnachten aber war und ist Schnee und Eis. Sydney war sehr weihnachtlich herausgeputzt. Über den Straßenschluchten hingen Plastiktannenbäume, die im Wind schaukelten und in der Sonne blitzten. Die Auslagen der Geschäfte waren mit Santa-Claus-Figuren, die mit schweren Stiefeln in weißem Winterwunderland standen, dekoriert. Wie zu Hause! Trotzdem aber weigerte sich mein Gehirn sommerliche Hitze mit weihnachtlichen Gefühlen zu verbinden. Christbaum, Kälte und Schnee waren eine untrennbare Verbindung mit meinen Erwartungen eingegangen. So genoss ich denn einen exotischen Weihnachtstag an einem der wunderschönen Strände Australiens. Daran gewöhnte ich mich schnell. Im Sand liegend aber entwarf ich schon den Brief, den ich an meine Familie zu Hause schicken würde. Ich konnte schreiben, dass die Erde tatsächlich rund war.
Am Neujahrstag waren wir beide von einem der vier Chefs meines Verlobten zu einem Neujahrsempfang in dessen Haus eingeladen. Die Luft war an diesem Tag heiß und feucht. Alle Türen und Fenster des Hauses waren geöffnet, um es den Gästen durch eine Brise so angenehm wie möglich zu machen. Ein leichter Wind umfächelte mich. Meine Haut fühlte sich klebrig an. Meine Sommerkleidung, für mitteleuropäische Sommer durchaus das Richtige, wurde von den Kennern des Sydneysommers kritisch beurteilt. Unter all diesen lieben Menschen, die sich um uns sorgten und, siehe da, in Abwesenheit von Small Talk, vergaß ich den Grund für die Einladung. Ich fühlte mich genau wie auf einer schönen Sommerparty. In der Tat, ich musste mir ins Gedächtnis zurückrufen, dass es der Neujahrstag — 1. Januar 1972 — war, den wir feierten. Unter den exotischen Umständen, ohne Schnee und Minustemperaturen, hätte man mich leicht zum Narren halten können!
Und so wurde der steinige Weg der Anpassung langsam etwas leichter. Wir hatten die Notwendigkeiten des Lebens arrangiert, somit blieb mehr Raum anderes Interessantes Australiens zu entdecken. Flora und Fauna auf diesem ungewöhnlichen Kontinent hatten unsere volle Aufmerksamkeit. Ersteres war leichter zu beobachten als Letzteres. Es gab keine Kängurus, die durch die großen, relativ natürlichen Stadtparks hüpften. Und keiner von uns beiden war mutig genug sich in die Wellen von Bondi Beach zu stürzen, um Haie zu beobachten. Nicht mal ein Koalabär saß irgendwo oben in den Ästen der Eukalyptusbäume. Aber alle diese Tiere hielten sich im Sydney Zoo auf. Unvergesslich sind mir die Haie, die vor meinen Augen durch das riesige Aquarium schwammen. Ich schrieb einen langen Brief darüber nach Hause, um über die Reihen von spitzen Zähnen und die milchigen Augen der gefürchteten Tiere zu berichten. Völlig gefesselt beobachtete ich sie, als mich mein Verlobter plötzlich am Arm packte und aufgeregt rief: "Ich habe vergessen, dass die bald schließen. Die haben Platypus hier, wir müssen laufen!"
"Sie haben was?"
"Platypus! Du kennst keinen Platypus?"
"Nein, sollte ich das?"
"Ja! Ein Platypus hat einen Schnabel wie eine Ente, lebt im Wasser, legt Eier und säugt seine Jungen. Wir müssen einen sehen!"
Natürlich, jeder kennt Platypus, hab schon immer Platypus gekannt, besonders in Mitteleuropa. Ich fühlte mich auf den Arm genommen. (Inzwischen weiß ich natürlich, was ein Schnabeltier ist, aber in den 70ern gehörte das noch nicht zur Allgemeinbildung.)
Das Schicksal aber war gegen uns. Das Platypus-Aquarium war geschlossen. Bis zum heutigen Tag haben wir noch keinen lebenden Platypus gesehen. Aber jedes Mal, wenn einer über den Bildschirm unseres Fernsehers schwimmt, erzählen wir dieses Erlebnis und die Tatsache, dass ich dachte, mein Verlobter erfände wilde Geschichten aus dem Stegreif. Inzwischen hat mir der Lektor der englischsprachigen Version dieses Buches, der in Melbourne arbeitet, ein süßes Bild von einem äußerst gemütlich aussehenden Platypus geschickt.
Die Australier lieben ihren Platypus. Ehrensache!
Auf einem meiner kleinen Stadtentdeckungsspaziergänge besuchte ich meine erste Opal-Galerie. Sie war innen dunkel. Nur Spotlights schienen auf die Opale und ließen sie in ihren Farben erstrahlen. Auf der Stelle verliebte ich mich in diese Galerie und die Opale. Ich nannte sie die Steine von Tausend und einem Licht. Das Personal versicherte mir, dass australische Opale die besten der Welt seien. Ich schätzte die Geschichte und die Geologie dieser funkelnden, leuchtenden Steine, stellte ihre Qualität nicht infrage. Ich konnte nicht genug von dieser mineralbedingten Schönheit bekommen.
Auf meinem Heimweg vom Import-Export-Geschäft kam ich immer an einer Opal-Galerie vorbei. Oft ging ich hinein, um wieder einen Blick auf die Juwelen zu werfen. Jedes Mal bedauerte ich dabei, dass ich diese wunderbare Ansicht nicht mit meiner Juwelen liebenden Mutter teilen konnte. Sie blieb immer vor den Juweliergeschäften in München stehen, nur um das Geglitzer im Schaufenster zu bewundern. Sie kannte jeden existierenden Stein, sein Abbaugebiet und seinen Wert. Ich prüfte meine finanziellen Möglichkeiten und kaufte bunte — nicht weiße oder schwarze — Opale, die mich wegen ihrer Farben sehr faszinierten. Meine Mutter sandte einen enthusiastisch klingenden Brief zurück. Sie war begeistert. Danach fühlte ich mich glücklich und seltsam ruhig, dass ich ihr so viel Freude bereiten konnte. Es reduzierte meine Schuldgefühle, dass ich sie in München zurückgelassen hatte.
Eine andere Quelle des Staunens und Entzückens fanden mein Verlobter und ich durch Zufall an einem Sonntagnachmittag. Damals war unter der Hafenbrücke von Sydney, nahe dem brandneuen Opernhaus, eine Art Kulturzentrum. Dort fanden wir von den Aborigines hergestellte Kunst. Es handelte sich hauptsächlich um zweidimensionale Malerei, geschaffen mit den Farben, die die Wüsten Australien anboten. Gedanken über das scheinbar angeborene Bedürfnis des Menschen nach Schönheit und Ästhetik, zogen mir durch den Kopf. Von jeher hat Homo sapiens sich und seine Umgebung versucht zu verschönern oder wenigstens zweidimensional festzuhalten. Sogar in solch desolater Wildnis hatten Menschen Wege und Material gefunden, sich künstlerisch mitzuteilen, symbolisch oder konkret, und Mentales malerisch auszudrücken. Mit Büchern über Aboriginal Art und ihre Bedeutung kam ich in unser Appartement zurück. Während ich las, nahm der Gedanke das Outback, die Wüsten zu besuchen, Gestalt an.
Einen solchen Trip zu planen, führte mir die enormen Entfernungen und Dimensionen dieses Kontinents vor Augen. Nur mein Augenmaß auf einer Landkarte zu benutzen, ließ mich stets zu kurz und zu wenig schätzen. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass ich mit europäischen Augen maß. Ich war in einem dicht besiedelten Land aufgewachsen, wo nichts besonders weit entfernt lag. Dieses in meinem Gehirn verankerte Wissen schlich sich in meine Betrachtung australischer Landkarten ein. Aber weil diese Entfernungen so immens waren, kamen wir nicht weiter als bis zu den Blue Ridge Mountains oder Shell Harbor, ein von Muscheln wimmelnder Strand, einige Autostunden südlich von Sidney gelegen.
Wiederholte Male fand ich kleine, hübsche Beispiele authentischer Handwerkskunst, die ich nach Hause schickte, um meine Familie an meinen Erlebnissen etwas teilhaben zu lassen. Meine Mutter fungierte als Übermittlungsstation.
Eines Tages fand ich einen Artikel in einer Tageszeitung, welcher über eine Schafschau und einen Wettbewerb der besten und schönsten Exemplare berichtete. Das Bild in diesem Artikel zeigte den größten, mächtigsten, eindruckvollsten Schafsbock, den ich je gesehen hatte. Ich schnitt das Bild dieses Prachtkerls aus und schickte es an den landwirtschaftlichen Zweig unserer Familie. Sie schienen ebenso beeindruckt wie ich und zeigten es den Bauern, die selbst Schafzucht betrieben. Damit erinnerte man sich an mich. Meine Mutter, die Übermittlerin, teilte mir mit, dass ich teils als das arme Mädchen, welches so weit von zu Hause weg leben musste, gesehen wurde. So beratschlagten sie dann, wie man mein Los erleichtern könnte. Man könnte mir ein Fass bayerisches Bier schicken! Einer meiner Onkel machte dann jenes Statement, welches sicher humorvoll gedacht war, aber in der Tiefe doch bezeugte, was meine Familie über meine Abwesenheit und den Ort meines Aufenthaltes dachte: "Da ist sie zu weit von der Brauerei weg."
Meine Zeit in Australien war nicht nur die Summe von neuen oder aufregenden Erlebnissen. Es war auch nicht nur ein Test meiner Beziehung zu meinem Verlobten. Ich habe Deutschland verlassen, nicht nur weil ich andere Teile der Erde sehen wollte, sonder auch weil ich mit mir selbst nicht im Reinen war. Manchmal fühlte ich mich sogar als Außenseiterin. Ich war auf der Suche nach einer Zukunft, für die ich mich noch entscheiden musste. Durch einen drastischen Wechsel der äußeren Umstände hoffte ich auf Klarheit und darauf, meinen Weg zu erkennen. Dieser Prozess, so meine ich, wurde durch ein Buch, das mir eine Freundin aus Deutschland schickte, ins Rollen gebracht. Es hatte den Titel Der Mensch und seine Symbole, geschrieben von dem Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung. Ich las es von der ersten bis zur letzten Seite, langsam, um alles deutlich aufzunehmen. Mein Verlobter hörte meinen Reden darüber geduldig zu und verhielt sich auch herausfordernd, was die Theorien, die Jung aufstellte, betraf. Zum ersten Mal realisierte ich, dass ich ein tieferes Interesse an Psychologie hatte, als mir bisher bewusst gewesen war. Ob der Inhalt dieses Buches oder mein neues Leben in einer anderen sozialen und natürlichen Umgebung der Grund für eine Serie von ungewöhnlichen Träumen war, muss dahingestellt bleiben.
Die Frau, die mir Jungs Buch geschenkt hatte, insistierte, dass alle meine Träume archetypisch seien. Obwohl mir dieses Konzept des Archetypus damals noch schleierhaft war, merkte ich mir ihre Behauptung, denn intuitiv maß ich diesen Träumen Bedeutung bei. Sie waren zu außergewöhnlich für mich. Schließlich hatte sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich war auf der Suche nach meiner Zukunft, meiner Berufung sozusagen, und ich mühte mich ab, mein emotionales Gleichgewicht zu halten. Am wichtigsten aber, so glaubte ich, war die physische und soziale Distanz, die sich zwischen mein heimatliches Ursprungsland, meine Vergangenheit und die Gegenwart gelegt hatte. Dieser Zustand verringerte die Notwendigkeit, meine Gefühle über mich selbst und bestimmte Wahrheiten zu verleugnen oder zu unterdrücken, denn die kritischen Stimmen waren weit weg. Unterstützt wurde ich dabei von meinem Verlobten. Er akzeptierte mich wie ich war, versuchte nicht, mich in eine Form zu pressen, in die ich nicht passte.
Mit der aufrichtigen Rückendeckung von ihm und Carl Gustav Jungs Theorien hielt ich einige meiner Träume schriftlich fest und fertigte für zwei sogar Bleistiftskizzen an. Die vier, an die ich mich erinnere, reflektierten nach meiner Interpretation mein neues Leben (die Haie), meine Herkunft (die märchenähnliche Szene, wie bei den Gebrüdern Grimm), die Suche nach mir selbst (der Wald und das alpine Haus, an dem ich vorbeiging):
Ich befand mich in einem Haus. Dort schlenderte ich durch einen breiten, langen, mit dickem, weichem Teppich belegten Gang. Dabei kam ich an drei oder vier Zimmern vorbei, die nur auf drei Seiten Wände hatten, aber zum Gang hin offen waren. Eines dieser Zimmer war vollkommen rot ausgelegt. Die Farbe war sehr stark. Die Szene, die ich sah, war eine Märchenszene. Eine Frau stand in der Mitte des Zimmers. Sie trug Kleidung im Stil des Mittelalters. Das Haar zierte eine spitz zulaufende Kappe, von der ein Schleier hing. Weiter reicht meine Erinnerung nicht.
In einem anderen Traum lag ich bäuchlings auf einem Steg, der über Wasser führte. Es schien das Meer zu sein. Es war ein schönes Bild und die Luft war angenehm warm. Im Wasser schwammen mehrere Haie vorbei und machten mir Angst. Diese Szene träumte ich, so glaube ich, bevor ich im Aquarium des Zoos in Sydney echte, lebende Haie sah.
Mein Verlobter hatte damals ein Zitat entwickelt, welches er auch heute noch gerne anwendet, wenn die Situation danach ruft: Man kann meine Frau aus Bayern rausnehmen, aber nicht Bayern aus meiner Frau. Die folgenden beiden Träume scheinen dies zu bestätigen:
Ich befand mich in bayerischem beziehungsweise deutschem Nadelwald. Mit einem Lift fuhr ich zu den Ästen der Bäume hoch. Als sich die Tür des Liftes öffnete, musste ich auf eine Hängebrücke, die sich hoch oben zwischen den Bäumen erstreckte. Sie bestand aus Ästen der Nadelbäume und fing an zu schwanken, als ich meinen Fuß darauf setzte. Durch die Äste hindurch konnte ich den Waldboden unter mir sehen. Angst packte mich und ich entschied, diese Brücke nicht zu überqueren.
Dieser Letzte der vier Träume folgte mir in meinem Gedächtnis durch die Dekade, denn immer wieder schien er sich in meinem wirklichen Leben zu bestätigen:
Das Land war mit glitzerndem Schnee bedeckt. Der Himmel war azurblau, ohne eine Wolke. Ich fuhr auf Skiern einen sehr steilen Abhang hinunter, der in einer schmalen, rinnenähnlichen Mulde endete. Eine Menge Geschwindigkeit war notwendig, um den gegenüberliegenden, ebenso steilen Hang wieder hinaufzukommen. Ich schaffte es beinahe, aber eben doch nicht ganz, sodass ich im 'Grätschschritt mühsam die letzten Meter bewältigen musste. Oben angekommen, präsentierte sich das Land flach und wunderschön, schneebedeckt und mit sonnigem, blauem Himmel. Schneekristalle funkelten wie Diamanten. Rechter Hand stand ein Haus im alpenländischen Stil. Ich entschied, an ihm vorbei und in die blaue, unbekannte Ferne zu fahren.
Oftmals fühlte ich, dass dieser Traum sich immer und immer wieder bewahrheitete. Wo immer ich auch gewesen sein mag in der Welt, so besuchte ich auch immer wieder meine bayerische Heimat. Entfernung und Finanzen bestimmten die Intervalle von meist ein oder zwei Jahren. Bei jedem Besuch wusste ich, dass ich wieder abreisen würde. Die unausweichliche Frage, besonders von meiner Mutter, wann ich denn dableiben würde, war mir immer höchst unangenehm. Die Antwort, die sie und die anderen Familienmitglieder hören wollten, konnte ich ihnen nicht geben.
Die meisten Australier hatten uns mit offenen Armen und vielen Einladungen empfangen. Sie blieben weiterhin hilfsbereit und tolerant. Letzteres hat sicherlich den Prozess meiner Anpassung ans australische Leben gefördert. Irgendwann fühlte ich mich aufgenommen und ein Gefühl der Sicherheit kehrte zurück. Aber, wie man so sagt: Nichts ist perfekt. Unvorhergesehene Dinge geschahen und störten meinen fragilen Frieden sehr leicht.
Als an einem Abend mein Verlobter nach Hause kam, konnte ich an seinem Gesicht ablesen, dass etwas vorgefallen war. Er erklärte: "Heute Morgen war ein Zettel an meiner Bürotür befestigt, auf dem stand Yankee go home." Einer der vier Partner der Firma erfuhr von der Sache und entschuldigte sich bei meinem Verlobten. Dieser sprach nie wieder davon, nach dem Motto: Es gibt immer einen, versuchten wir die Provokation zu ignorieren. Im Stillen jedoch argwöhnte ich, ob die freundliche Einladung an der Bürotüre nicht maßgeblich daran beteiligt war, dass mein Verlobter sich um einen Studienplatz für sein Masters-Degree bei seiner alten Uni in Berkeley, Kalifornien bemühte.
Aber dies blieb nicht der einzige Vorfall. Sehr bald nach unserer Ankunft in Sydney wurden wir von einem Ehepaar in ihr Heim eingeladen. Es lag weit außerhalb der Stadt, fast schon im Busch. Es war eine warme Frühsommernacht und die Grillen zirpten sehr laut. Ich genoss die exotische Romantik. Am Ende eines wohlschmeckenden Abendessens mit angeregter Unterhaltung, wandte sich die Gastgeberin an mich. Sie sagte mir, dass ihre Mutter Jüdin wäre, aus Deutschland hätte fliehen müssen und nie wieder dorthin zurückgehen möchte. Den letzten Punkt wiederholte sie mehrere Male. Dabei zeigten ihre Mundwinkel scharf nach unten. Ihre Augen funkelten so aggressiv, dass sie mich beinahe das Fürchten lehrte. Obwohl ich die Tragödie, die hinter ihren Worten stand, natürlich nachvollziehen konnte, so traf mich ihr offensichtlich vorhandener Hass bezüglich des Zweiten Weltkrieges doch unvorbereitet. Es schien, als ob sie die Gelegenheit, eine Deutsche in ihrem Haus zu haben, benutzen wollte, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Auf all meinen europäischen Reisen hatte ich keine solche Erfahrung machen müssen. Somit wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. So hörte ich denn einfach zu und kam zu der Erkenntnis, dass ich für diese Frau ihre persönliche Geschichte live verkörperte. Später, als ich mit meinem Verlobten über das Verhalten unserer Gastgeberin sprach, erinnerte ich mich an einen Trost, den die Australier gerne spendeten: Du wirst dich daran gewöhnen! Aber diesmal musste ich sie Lügen strafen.
Ein anderes, völlig unerwartetes Gefühl, manifestierte sich allmählich mehr und mehr. Als ich es schließlich erkannte, schwankte ich zwischen Annahme und Ablehnung. Jeder, nicht nur Psychologen, weiß, dass sich Platzangst beziehungsweise Klaustrophobie auf schmale, enge, womöglich geschlossene Orte bezieht. Genau dieses Phänomen schien ich auf diesem riesigen Kontinent mit seinen weiten Flächen im Landesinneren zu fühlen. Jahre später noch versuchte ich Laien und Psychologen zu erklären, dass Platzangst allein von einem Gefühl des Eingeschlossenseins oder Gefangenseins resultieren kann. Und dazu braucht es nicht unbedingt einen schmalen, kleinen Ort.
Jene Tage der Jahre 1971-1972 kannten noch kein Internet, keinen PC oder E-Mail, wodurch täglicher Kontakt mit Angehörigen auf fernen Kontinenten möglich gewesen wäre. Es gab keine Satellitenantennen auf Dächern, womit man heimatliche Fernsehsender hätte empfangen können. Briefe, die über drei Kontinente hinweg reisen mussten brauchten lange, sogar mit Luftpost. Zeitungen und Zeitschriften von zu Hause waren drei Monate alt, wenn sie bei mir ankamen. Diese Zustände bewirkten, dass ich mich langsam vom zentralen Fluss des Geschehens, der für mich natürlich in Europa lag, ausgeschlossen fühlte. Sydney war lebhaft genug, aber für mich lag das Zentrum der Erde im Norden, wo ich aufgewachsen war.
Ich entwickelte eine gewisse Wachsamkeit, nicht ausgelassen oder übergangen zu werden. Eine zugegebenermaßen etwas unrealistische Angst, in Australien festzusitzen, wuchs. Folglich wurde der Wunsch das Land zu verlassen immer stärker. Als Gegenmaßnahme für diese Entwicklung hielt ich mir all die Dinge, die ich hier schätzte und liebte, vor Augen: das wunderbare Klima, die schönen, allzeit von Haien besuchten Meeresbuchten und Strände, die bunten Vögel, der entspannte Lebensstil, das freundliche Wesen der Australier, die exotische Umkehr der Jahreszeiten, die Kunst der Aborigines. Sie alle waren auf meiner Positivliste. Aber mit der Zeit verloren die Argumente an Einfluss und machten dem Gefühl Platz, zu weit weg und draußen zu sein. Last, but not least: Flugtickets für Langstrecken kosteten eine Menge Geld, welches erst erspart werden musste.
An einem jener Tage kam ich mit einem etwas älteren Mann zu ins Gespräch, irgendwo in einer Straße der Stadt. Auch er stellte mir die Frage aller Fragen: "Wie finden Sie Australien?" Er schien ein warmherziger Mann mit einer ehrlichen Art. Ich vertraute ihm und erzählte ihm unter anderem von meinen klaustrophobischen Ängsten. Er war fassungslos. "Aber das ist ein riesiges, weit offenes Land!", meinte er. Ich erklärte ihm, dass Deutschland wenig weit offenes Land besaß und solche gewaltigen Entfernungen wie in Australien für mich etwas entmutigend waren. Da er so nett und ernsthaft war, erwähnte ich das zusätzliche Gefühl von down and out (dieses Gefühl downunder nichts mehr von der Welt mitzukriegen) nicht. Aber er akzeptierte meine Einstellung. "Sie verlassen uns dann", sagte er, "und dann werden Sie nach Australien zurückkommen." Triumphierend und überzeugt schaute er mich an. Ich räumte diese Möglichkeit ein, denn wir hatten noch nicht einmal einen Bruchteil dieses faszinierenden Kontinents gesehen. Ein Bisschen sollte dieser Mann auch recht behalten. Die Erfahrung Australien blieb bis heute in meinem Gedächtnis. Ich war sozusagen mit diesem Land noch nicht fertig, als ich es verließ. Zusammen mit meinem Mann und unserem Sohn kam ich 31 Jahre später nach Brisbane und auf Hamilton Island, vor dem Great Barrier Reef gelegen. Jahre später würde ich immer noch gerne Australien besuchen, vielleicht auch, weil ich dort ein sehr signifikantes Jahr meines Lebens verbracht hatte. Mein Mann und ich begannen dort unser gemeinsames Leben, weit weg von jeglicher Familie. Es war der Anfang einer wunderbaren Verbindung, die mein inneres Wachstum gefördert und meinen geistigen Horizont auf eine Art erweitert hat, die ich andernfalls vielleicht nicht erlebt hätte.