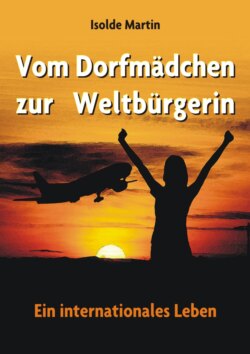Читать книгу Vom Dorfmädchen zur Weltbürgerin - Isolde Martin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE SONNE, DIE WÜSTE, DIE BLAUEN BERGE — ARIZONA
ОглавлениеErneut plagten mich Schuldgefühle über das Verlassen meiner Mutter, obwohl ich sie in der Obhut meines Bruders und meiner Schwägerin wusste. Aber die Liebe zu meinem Mann, seine enthusiastische Freude seinen ersten Arbeitsplatz nach der Uni anzutreten, meine Ambitionen mein Psychologiestudium durchzuziehen und ein exotisches Leben in der Sonora Wüste, hatten das emotionale Duell gewonnen.
Nachdem wir uns von dem elfstündigen Flug und der insgesamt sechszehnstündigen Rückreise aus München erholt hatten, begannen wir unsere Habseligkeiten einzupacken. Es passte alles in einen Truck von der Größe eines Kleinbusses, den wir gemietet hatten.
Am folgenden Morgen verließen wir Oakland, wo wir zuletzt gewohnt hatten, in Richtung Oakland Bay Brücke. Noch einmal fuhren wir zum Campus, zur Wurster Hall, dem College für Architektur, wo mein Mann insgesamt fünf Jahre verbracht und schließlich sein Diplom erhalten hat, sahen über das schöne, am Berghang gelegene Gelände, erinnerten uns an die Menschen, die wir getroffen hatten, die guten und die weniger guten Erlebnisse. Unsere Kirche, in deren Büro wir unzeremoniell geheiratet hatten, musste auch zurückbleiben. Es war ein signifikantes, turbulentes, reiches akademisches Jahr gewesen. Nun war es vorbei.
Kurioserweise spürte ich ein Gefühl der Traurigkeit in mir. Es bezog sich auf das Ende eines bedeutungsvollen Lebensabschnittes, nicht auf das Verlassen einer Umgebung, die mir eine Menge Angst beschert hatte. Aber ich fühlte auch Traurigkeit stellvertretend für meinen Mann. Ich erinnerte mich an die vielen Erlebnisse, die er während seiner frühen Jahre erfahren musste, von denen er mir berichtet hatte. Da waren die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, die Rassenkrawalle, die Polizei, die Hubschrauber, der Stacheldraht, über den er hinweg steigen musste, um zu seinen Vorlesungen zu kommen. Die San Francisco Bay Area und diese Universität in der Stadt Berkeley waren seine geistige Heimat. Er hat hier, so empfinde ich es, weitere Jahre der Reifung durchwandert. Ich beobachtete sein Gesicht von meinem Beifahrersitz aus, suchte nach Anzeichen von Gefühlen. Er sah vorwärts, geradeaus. Die tiefe Bedeutung dieses Blickes hat seither mein Leben mit ihm begleitet.
Viele Jahre später standen wir wieder einmal in einem Park in San Francisco. Mein Mann sagte, sollte er eine Stadt wählen müssen und München würde nicht existieren, dann würde es diese sein. Er hat damals eben viel mehr zurückgelassen als ich. Aber mein Mann war ein Entdecker. Er wollte immer wissen, was es um die Ecke gab.
Es war Sonnenuntergangszeit, als wir Los Angeles erreichten. Dort trafen wir uns mit einem Freund aus Berkeley, der schon seinen ersten Arbeitsplatz in dieser Metropole angetreten hatte. Dieses Treffen tat meiner Seele gut, da es ein bisschen Kontinuität darstellte. Er hatte meinem Mann zu seinem ersten Arbeitsplatz in Phoenix, Arizona, verholfen. Nun besprachen beide die bevorstehende Durchquerung der Wüste während unseres Abendessens. Da wäre die gefährliche Strecke durch die Mojavewüste, wo weder Mensch, Baum, Strauch, Tankstelle oder Wasser zu finden seien. Wir müssten uns dementsprechend vorbereiten, meinte er. "Und vergesst die Ersatzreifen nicht!" Plötzlich verstummte er und blickte meinen Mann an. Aus den Augenwinkeln heraus nahm ich die Gesten meines Mannes war, nicht weiter die Schrecken der Wüste zu beschreiben. Ich sollte keine Angst bekommen. Eine feine, aber nutzlose Geste, da ich schon immer von der Wüste fasziniert war und viel darüber gelesen hatte. Ich freute mich auf das Abenteuer.
Wir hatten vor, die Wüste während der Nacht zu durchqueren um die kühleren Stunden zu nutzen, denn unser Truck hatte keine Klimaanlage. Außerdem freuten wir uns, des Nachts den Sternenhimmel der Wüste beobachten zu können. Der Himmel würde mit blinkenden, leuchtenden Sternen übersät sein. Vielleicht konnte ich sogar mal wieder die Milchstraße sehen, wie ich sie seit meiner Kindheit in Bayern nicht mehr besichtigen konnte. Die klare Luft der Wüste und ein wolkenloser Himmel in einer stockdunklen Landschaft würden es möglich machen.
Wir erklommen die San Bernardino Berge, die das Los Angeles Basin abgrenzten und fuhren in östlicher Richtung abwärts. Unten im Flachland würden uns ein paar kleinere Orte erwarten, bis wir dann die Mojavewüste erreichten. Wir fühlten uns gut, der Highway war fast leer, die Dunkelheit war schön. Mein Mann sang: "I was born unter a wandering star." Plötzlich wurden die Lichter des Autos dunkel. "Hoy!", rief mein Mann. "Stop!", rief ich unnötigerweise. Sofort nach unserem Geschrei gingen die Lichter wieder an. Dieses aufregende Spiel wiederholte sich noch ein paarmal.
Etwas grantig erreichten wir Indio, eine kleine Stadt am westlichen Rand der Wüste. Dort riefen wir eine Reparaturwerkstatt an. Der Mann erklärte uns, wie wir zu seiner Werkstatt kommen würden und dass er dort auf uns warte. Als wir aber dann ankamen, war alles dunkel und die Tür abgeschlossen. Er hatte wohl die Geduld verloren und uns versetzt. Da es spät war, gab es keine andere Möglichkeit mehr, als in diesem Kaff zu übernachten. Guten Morgen, liebe Sterne, und grüßt mir die Milchstraße.
Wir schliefen in einem Motel bis in die frühen Morgenstunden. Bei Tagesanbruch waren wir schon unterwegs. Nachdem wir geradewegs aus etwas kühleren klimatischen Verhältnissen kamen, war uns klar, dass wir Phoenix erreichen mussten, bevor die Hitze unerträglich und gefährlich wurde. Außerdem hatte ich Kosmetikartikel aus Deutschland mitgebracht, die nicht schmelzen und damit unbrauchbar werden sollten. Ein Studentenbudget konnte das genauso wenig vertragen, wie meine nostalgischen Gefühle. Aus all diesen Gründen ließen wir unseren Wecker um 3:30 Uhr klingeln. Vor der Abfahrt erlaubten wir uns noch ein schnelles Frühstück.
Als wir den kleinen Truck bestiegen, war die Welt um uns herum nahezu lautlos. Die Luft war kühl, verglichen mit den Temperaturen die da kommen sollten, und rein. Sogar etwas Tau lag auf den Kakteen. Die Stille um mich rief ein Gefühl des inneren Friedens in mir hervor. Mein Mann ließ den Motor an und schaltete die Lichter ein. Sie leuchteten unschuldig! Leicht und beschwingt verließen wir den Ort.
Die Wüste präsentierte sich in all ihrer Schönheit und scheinbarer Sicherheit. In ein paar Stunden wird dieses Gelände mörderisch heiß und trocken sein, ging es mir durch den Kopf. Die Berge am Horizont bildeten im Morgengrauen eine wunderschöne, sanfte Kulisse. Kakteen zeigten über die ganze Landschaft verstreut wie Orgelpfeifen in den Himmel. Viele waren höher als jeder Busch, manche davon 100 Jahre alt. Später, als ich mein erstes Semester Biologie belegte, organisierte unser Professor sogenannte Fieldtrips in die Wüste, bei denen ich dann von der Verwundbarkeit dieses Ökosystems der Leichtigkeit, mit der man hier zerstören konnte, erfuhr.
Es dauerte nicht lange, bis die Scheinwerfer wieder dunkel wurden und uns zum Anhalten zwangen, aber wir hatten Glück im Unglück: Ich hatte vorsichtshalber meine mir so teure Kosmetik in ein nasses Handtuch gewickelt. Dieses benutzte nun mein Mann, um einen Draht oder ein Kabel unter dem Steuerrad zu kühlen. Nach einem kurzen, schlangenartigen Zischen hatten wir wieder Licht und konnten unsere Reise fortsetzen. Da wir zu diesem Zeitpunkt schon in der Mitte von Nirgendwo waren, mussten wir uns ranhalten. Diese Verdunkelungsszene wiederholte sich noch einmal, denn obwohl der erste Sonnenstrahl bereits über den Horizont lugte, ließen wir die Lichter zur Sicherheit noch eingeschaltet.
Gegen zehn Uhr morgens erreichten wir Phoenix. Unsere Kleider klebten bereits auf der Haut. Ein leichter Kopfschmerz plagte mich und ich fühlte mich seltsam schwach. Etwa 30 Minuten später konnten wir endlich in ein Motel einchecken. Die Hitze war bereits unerträglich.
Ich musste mich hinlegen. Mein Mann sah auf mich herunter und sagte: "Okay, ich bin gleich wieder da."
Ich hatte dem nicht viel Beachtung geschenkt, aber er kam tatsächlich schnell zurück. Er fütterte mich mit einer gesalzenen Honigmelone — eine Kombination, die mich fast zum Würgen brachte. Nach einer halben Stunde fühlte ich mich aber schon besser. Ich hatte meine Lektion gelernt: In der sommerlichen Wüste sollte man Salz zu sich nehmen, Vitamin C und Elektrolytpulvergetränke schlucken und viel Wasser trinken! Während der nächsten zwei Jahre, die ich im Valley of the Sun verbrachte, ermahnte mich jeder Arzt, den ich besuchen musste, genug Flüssigkeit zu mir zu nehmen.
Die folgenden zwei Wochen verließ ich unser Appartement nur, um über den Parkplatz zum Auto oder vom Parkplatz in ein Geschäft zu rennen. Um neun Uhr abends konnte ich zum Schwimmbad des Appartementkomplexes gehen. Aber auch da nahm mir die heiße Luft noch den Atem, wenn ich ins Freie trat. Ich hatte das Gefühl, als ob ich den heißen Backofen geöffnet hätte. Die Hitze zu dieser Tageszeit überraschte mich. Ich nehme an, dass mein Gehirn 21 Uhr mit mitteleuropäischer Kühle assoziierte. Die Wirklichkeit brachte mich aber schnell zum Umlernen.
Ein Wort zur mentalen Referenz
Jeder von uns, der sich einer neuen Situation gegenübersieht — sei es ein unbekanntes Land, eine neue Kultur oder ein anderes Klima — bringt ein Set von vorheriger Erfahrung und damit diesbezügliche Erwartungen mit. Beides benutzen wir, oft unbewusst, zur Einschätzung einer neuen, vermeintlich gleichen Situation. Das sind die Rahmenbedingungen, mit denen unser Gehirn das Neue vergleicht und dementsprechend interpretiert. Diese sogenannte 'Referenz' kann aber falsche Daten liefern, wenn der Mensch den Rahmen geändert hat, wie zum Beispiel nächtens in Arizona zu stehen und nicht in Deutschland. Für das Gehirn ist es ein Anpassungsprozess zu erfahren, dass die Nacht in diesem Wüstenland genauso dunkel ist, aber nicht genauso kühl wie im Voralpenland. Was die hochsommerlichen nächtlichen Temperaturen in Arizona betraf, so brauchte mein Gedächtnis nur eine Erfahrung!
Nichtsdestotrotz, nachdem ich meine ersten Lektionen in Sachen Wüstenleben absolviert hatte, passte ich mich schnell an. Ich hatte schon begonnen, dieses schöne und trockene Land zu mögen. Das Valley of the Sun verdiente diesen Namen wahrhaftig. Es war keine Frage, dass jeden Tag der Himmel gleich blau sein würde, ohne das geringste Zeichen einer Wolke. Die Umgebung schien wunderbar bizarr. Camelback Mountain war der herausragende Punkt der näheren Umgebung. Seine felsigen Berghänge waren mit Soguara-Kakteen übersät, die alle ihre stacheligen Arme in den Himmel reckten. Sie erinnerten mich an Orgelpfeifen. Von unserem Balkon aus konnte ich in der Ferne ebenfalls felsige Berge sehen. Sie sahen in der Tat blau aus, so wie ich es aus Cowboy- und Wildwestfilmen meiner Kindheit in Bayern kannte. Die Luft, so sagte man mir, war so klar, dass alles etwas näher zu sein schien, als es in Wirklichkeit war. Ob blau oder nicht, die Augusthitze ließ die Berge rundum flimmern.
Diese Hitze war auch der Grund, weshalb wir sofort ein Auto brauchten, damit wir uns in einer kühlen Zelle dahin bewegen konnten, wo immer wir Dinge zu erledigen hatten. Bei über 40 Grad an einer Haltestelle auf einen Bus zu warten, war nicht meine Sache. Meine Schwägerin, die zu dieser Zeit in der Stadt wohnte, überlies uns eines ihrer Autos. Es war ein Buick Riviera und wieder fand ich es das größte Auto, das ich je gesehen hatte. Es brauchte nine miles to the gallon — etwa vier Liter Sprit für neun Meilen; nicht gerade ein Studentenbudget-Fahrzeug. Noch hatten wir nichts verdient. Aber wir akzeptierten es dankbar. Damit konnten wir im Komfort der Klimaanlage einkaufen gehen, unser Essen würde nicht auf dem Weg nach Hause verderben und mein Mann konnte seinen Arbeitsplatz in frischem Zustand erreichen.
Dieses Problem war also gelöst. Die Antwort zu der Frage, wie ich die jeweils fünf Kilometer hin und zurück zum Scottsdale Community College bei etwa 40 Grad Hitze bewältigen konnte, stand noch offen. Wir hatten noch nicht einmal ein Auto, geschweige denn zwei, gekauft. Aber nachdem ich seit meinem siebten Lebensjahr eine passionierte Radfahrerin war, lag die Lösung offensichtlich im Zweirad- und nicht im Vierradantrieb: Wir kauften ein Fahrrad. Gottseidank bot das College ein sogenanntes Minisemester an, welches den Kurs Einführung in die Psychologie einschloss. Somit konnte ich bis zum ersten Oktober noch warten. Erleichtert und ohne Zögern lies ich mich eintragen und hoffte, dass die Temperaturen bis dahin etwas menschenfreundlicher werden würden.
Am Morgen meiner ersten Vorlesung stand mein Mann als Erster auf. In alter Gewohnheit aus meiner regnerischen Heimat und dem dazugehörigen Rahmen der Referenz fragte ich: "Wie ist das Wetter heute?" Immerhin musste ich heute mit dem Fahrrad losfahren, was immer schon bedeutet hatte, dass man für das Wetter draußen richtig angezogen sein sollte. Mein Mann aber lachte und sagte: "Das Wetter ist heute genau wie es gestern war und genauso wie es morgen sein wird."
Okay, ich hatte verstanden: Gewöhne dich an das Wüstenwetter und vergiss Wolken und Regen.
Mit einer Mischung von Angst und Erwartungsfreude trat ich schließlich in die Pedale. Es ging in östliche Richtung ins Reservat der Hopi-Indianer, wo das College lag. Zwei Gedanken schwirrten mir ganz besonders im Kopf herum: Es war mir bewusst, welch seltener Anblick ich war, denn niemand sonst war mit dem Fahrrad unterwegs. Zweitens war ich nun tatsächlich auf dem Weg, meinen Traumberuf zu verwirklichen. Nichts würde mich jetzt noch davon abhalten können. Die besondere Ironie war, dass ich das alles in einer Fremdsprache machen sollte, die mich in Deutschland vor langer Zeit einmal daran gehindert hat, das Klassenziel zu erreichen. Mein Wörterbuch hatte 619 Seiten! Es war so dick, dass mein Gepäckträger es kaum halten konnte. Mein Mann hatte es an mich weitergegeben, nachdem es ihm marginale Dienste während seines Trimesters Deutsch geleistet hatte. Heute sieht das Buch sehr mitgenommen aus. Immerhin wurde das Copyright im Jahre 1958 erteilt. Aber es steht immer noch in unseren Diensten. Ein Ruhestand ist noch nicht abzusehen.
Nachdem ich die letzten Häuser der Wohngegend auf dem Fußgängerweg durchradelt und hinter mir gelassen hatte, erreichte ich die Felder, die das College umgaben. Nun musste ich auf einer schmalen, zweispurigen, buckligen Straße radeln. Die anderen College-Kids fuhren mit ihren Autos schnell und gefährlich nahe an mir vorbei. Von den Feldern her winkten mir die Arbeiter. Sofort kamen die Erinnerung an Berkeley und damit unangenehme Gefühle in mir hoch. Würde sich Berkeley wiederholen oder war eine radelnde Frau in der Wüste einfach ein ungewöhnlicher Anblick? Würden diese Arbeiter mich morgen nach Dimes fragen?
Meine Bedenken stellten sich als grundlos heraus. Die nächsten Wochen winkten die Hopi-Feldarbeiter jedes Mal freundlich, wenn ich vorbeiradelte. Bald fing ich an ihnen zu vertrauen und winkte zurück. Schon als Kind in Deutschland las ich Indianergeschichten mit Begeisterung. Es führte zu tieferem Interesse an diesen Menschen, die in Gegenden wie der Arizonawüste leben und überleben konnten. Die freundliche Geste des Winkens schien unverbindlich und ermutigend. Mein Wissensdurst über sogenannte Indianer des Südwestens wuchs.
Ziemlich bald bekam ich Gelegenheit noch mehr über sie zu erfahren. Eines Sonntags, während dieses ersten, schicksalhaften Semesters Psychologie 101, kamen meine Schwiegereltern zu Besuch. Die gesamte Familie, organisiert von meiner Schwägerin, machte einen kleinen Ausflug. Sie meinte, dass da etwas wäre, was mich interessieren würde. Es sollte der erste Trading Post sein, den ich je betrat. Dort gab es authentische Hopi-Waren und relevante Literatur. Ich war begeistert. Eine junge, hübsche Hopi-Frau mit langem, schwarzem Haar stand hinter dem Tresen. Ihr Gesichtsausdruck war unverbindlich und nicht leserlich, vielleicht indianisch? Es war sehr still im Geschäft, wie in der Landschaft draußen. Nur meine Familie war da. Aufgeregt sprach ich mit meinem Mann und zeigte auf verschiedene Dinge.
Plötzlich drehte sich die Indianerfrau zu mir und fragte mich in fehlerfreiem Deutsch: "Sie kommen aus Deutschland?"
"Ja, sie kommt aus Deutschland", antwortete mein Mann für mich, da ich für den Moment sprachlos dastand.
"Wo haben Sie diese Sprache gelernt", fragte ich sie schließlich.
"Im College", sagte sie mit einem Hauch von Selbstverständlichkeit. Ihr Grinsen, obwohl freundlich, zeigte deutlich, dass sie wusste, dass ich das nicht erwartet hatte und eine vorgefertigte Meinung bezüglich der akademischen Ausbildung ihres Stammes hatte.
Aber das war noch nicht das Ende meines Umdenkens. Schon von Anfang an fiel mir in meinen Psychologievorlesungen ein indianisch aussehender Mann auf. In der nächsten Vorlesung nach meinem Besuch im Trading Post brachte ich den Mut auf, diesen Mann nach seiner ethnischen Zugehörigkeit zu fragen. Ja, er wäre vom Stamme der Hopi, sagte er freundlich und ruhig. Meine Neugierde und Voreingenommenheit ließ mich noch weiter erkunden, warum er denn einen Kurs in einführender Psychologie brauchte. Es wäre notwendig für seine Arbeit als aktives Mitglied von American Indian Movement. Wiederum musste ich eine Lektion einstecken.
Zu Hause, sozusagen im stillen Kämmerlein, versuchte ich mein Selbstbild mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Für zwei bis drei Trimester im Merritt College in Oakland, Kalifornien, ging ich mit einigen Black-Panther-Mitgliedern in die Vorlesungen. Nun saß ich mit Hopi-Indianern in einem Klassenzimmer in einem College in ihrer Reservation. Das war nicht Fernsehen, das war real. Würden die zu Hause in Bayern mir das glauben?
Für die nächsten zwei Jahre las und lernte ich über die Indianer des amerikanischen Südwestens. Ich bewunderte die hoch entwickelte Arbeit der Navajo-Silberschmiede. Ich bestaunte die Webkunst und Teppiche der Hopi. Natürlich war ihr Preis nicht in meiner Liga. Dasselbe galt für die Töpferarbeiten. Eine meiner geschätzten Errungenschaften aus dieser Zeit war ein Sandbild, das mit den verschiedenfarbigen Sandarten der Wüste hergestellt worden war. Es hatte den Titel Rainmaker. Ich schickte es meiner Mutter mit ein paar erklärenden Zeilen.
Seit meinem Besuch dieses Trading Posts, tiefer im Reservat gelegen, war mein Wunsch, die Geschichte und das Leben der Indianer in den Wüstengebieten des Südwestens im Detail kennenzulernen, sehr groß. Vor allen Dingen interessierte mich die Zeit vor Klimaanlage und Wasserzuleitung aus weiter Entfernung. Das harte Leben der Pioniere faszinierte mich ebenfalls.
Mein Mann und ich fuhren mit unserem kleinen VW-Käfer zu historischen Stätten in Arizona, um die Gegenden zu sehen, wo diese Menschen dereinst einmal vorbeikamen oder gelebt hatten. Die Frage, warum der Mensch willens ist, sich in solch untauglichen und für Leib und Leben feindlichen Gegenden niederzulassen, stand groß im Raum. In Tutzigoot, in einer leicht hügeligen Landschaft gelegen, befanden sich die Überreste einer typischen Behausung aus längst vergangenen Zeiten. Ein freundlicher, schweigsamer American Indian führte uns durch die Anlage. Nur der Wind, unsere Schritte und ein paar gesprochene Worte waren zu hören. Die ganze Landschaft ringsum schien menschenleer und strahlte Stille und Einsamkeit aus. Man konnte die eigenen Nerven hören. Der Horizont lag scheinbar endlos weit entfernt.
Ähnlich waren die Verhältnisse in Jerome. Das war eine sogenannte Geisterstadt, die malerisch an steilen Hügeln ausgebreitet da lag. Eine ehemalige Kupfermine bewirkte die Ansiedlung der Menschen. Vor meinem geistigen Auge sah ich reges Leben, schuftende Männer, Frauen mit Kindern in der Mitte von nirgendwo. Ich war tief beeindruckt von der menschlichen Entschlossenheit, sich ein Leben sozusagen aus dem Boden zu stampfen, allen widrigen Umständen zum Trotz. Als Spezies sind wir sehr anpassungsfähig und willig, wenn Hoffnung die Motivation beflügelt, dachte ich. Meine eigene Situation belegte diese Theorie. Ich bekam noch viel Gelegenheit, diese zu testen.
Diese bizarr-schöne Landschaft, die unglaubliche Stille und die Gelassenheit, die sie ausstrahlte, das Zeugnis der geologischen Evolution der Erde, das sie darstellte, schienen plötzlich meinen noch nicht vollendeten Anpassungsprozess leicht zu machen. Es schien kein Problem mehr zu sein, sondern nur noch eine Aufgabe. Diese Erkenntnis erstaunte mich und warf Fragen auf: Kann die natürliche Umgebung Ängste reduzieren, kann sie das Selbstwertgefühl heben, kann sie realistisches Denken fördern? Ich war geneigt diese Fragen zu bejahen. Der genaue Zusammenhang zwischen der kulturellen Anpassung und diesem scheinbar vorhandenen positiven Einfluss war mir damals jedoch noch unklar..
Um die natürliche Schönheit Arizonas zu bewundern, zu genießen und auf sich wirken zu lassen, musste man eigentlich nur aus der Haustüre ins Freie treten. In diesem Sinne kam mein Mann eines Abends heim und stürmte aufgeregt in die Wohnung: "Schnell, schnell, komm raus und schau dir das an. Es hat geschneit!", rief er. Ich folgte ihm nach draußen, dachte aber dabei, dass er mich entweder auf den Arm nahm oder verrückt geworden sei. Es war mir doch gesagt worden, dass es hier in den letzten fünf Jahren keinen Niederschlag irgendwelcher Art gegeben hätte.
Mein Mann aber zeigte nach Norden. "Schau", sagte er, "nimm es auf. Vielleicht siehst du das in der nächsten Dekade nicht wieder, oder in deinem restlichen Leben."
Man konnte die ganze Bergkette um Flagstaff und Richtung Grand Canyon sehen. Alle Gipfel trugen weiße Kappen. Die abendliche Sonne hatte zudem alles in rosa Licht getaucht. Es war ein majestätisches und sicher seltenes Bild. Es war auch der Stimulus, der uns die Idee in den Kopf setzte, höher gelegenes Gebiet zu besuchen, wie zum Beispiel das Apachen-Reservat.
"Wir gehen Skifahren in den weißen Bergen", verkündete mein Mann eines Tages.
Ich konnte nicht glauben, dass es in den Bergen Arizonas genug Niederschlag gab, um ein Skigebiet auszuweisen. Noch nie hatte ich gehört, dass die Pueblos und Navajos skigefahren sind. Arizonas Image waren Steine, Kakteen, Dürre, Skorpione und Pferde. Aber ich war willens mich eines Besseren belehren zu lassen.
Wir verließen Scottsdale nach Sonnenuntergang und fuhren ohne Unterbrechung etwa drei Stunden. Nach einer Stunde Fahrzeit gab es ringsum kein von Menschenhand eingeschaltetes Licht mehr. Es war stockdunkel. Es kamen uns nur sehr wenige Autos entgegen, keines folgte uns. Mein Mann war in guter Stimmung und sang sein Lied vom Wandering Star. Ich jedoch befand mich in einem Zustand wachsender Nervosität und fragte schließlich, ob wir uns verfahren hätten.
Überrascht antwortete mein Mann: "Nein, wie kommst du denn auf diese Idee?"
Ich meinte, dass es halt sehr verdächtig sei, wenn seit so langer Zeit kein Zeichen menschlichen Lebens erschien. Mein Mann meinte beruhigend, dass das natürlich nicht sein könnte, da wir uns ja auf dem Weg in das Apachenreservat befanden, ins Skigebiet eben. Eine Erinnerung flammte in meinem Gedächtnis auf. Das Australiensyndrom, dachte ich. Wiederum fühlte ich mich unbequem in weiter, endloser Landschaft — obwohl ich sie nicht sehen konnte. Ein interessanter Austausch über unsere Plätze der Kindheit erfolgte. Diesmal war es nicht kultureller Unterschied, der sich manifestierte sondern geografischer! Mein Mann erzählte, wie er sich in Europa beengt gefühlt hatte, ob der dichten Besiedelung dort. Genau diese einsamen Weiten, ohne Lichter sozusagen, hätte er vermisst. Für mich war genau das Gegenteil der Fall. Lachend beschlossen wir, dass wir trotz unserer unterschiedlichen Reaktionen auf Landschaft gut zusammenleben konnten. In späteren Jahren, wenn wir durch westliche oder mittelwestliche Staaten fuhren, wie Nevada, Kansas oder Oklahoma, zitierten wir, angesichts der nahezu leeren, endlosen Autobahnen, den deutschen Straßenverkehrsbericht des Bayerischen Rundfunks: "Dichter Verkehr in beide Richtungen, drei Autos in nördliche Richtung fahrend, zehn Kilometer vor uns wird ein weiteres Vehikel gesichtet, hinter uns erscheint am Horizont ein Lastwagen. Bitte vorsichtig fahren!"
Am nächsten Tag in der Frühe standen wir auf den berühmten zwei Brettern am Lift, kurz nachdem er eingeschaltet worden war. Vom Gipfel aus konnte ich flaches, weites, weißes Land bis zum Horizont sehen. Es war wunderschön, wie konnte ich mich davon in der Nacht zuvor nervös machen lassen! Die Berge schienen angesichts des Flachlandes nicht sehr hoch zu sein. Überraschenderweise fühlte ich mich nach zwei Abfahrten so ausgepumpt, als ob ich zehn gefahren wäre. Meine Knie zitterten. Als mein Mann sich zu mir gesellte, gestand ich ihm, dass meine heutige Kondition beschämend schlecht wäre.
"Well, du fühlst die Höhe und den Sauerstoffmangel", erklärte er.
"Den Sauerstoffmangel? Diese Berge können nicht höher als 2.000 Meter sein!", rief ich.
Nachdem ich mich vorher nicht weiter über das Skigebiet informiert hatte, musste ich wiederum feststellen, dass ich automatisch alpine Verhältnisse angewandt hatte, wo im Allgemeinen die Skigebiete 2.000 Höhenmeter niedriger lagen als hier.
"Du fährst hier auf über 3.000 Metern", schätzte mein Mann.
Am nächsten Tag fühlte ich Schmerzen in meinem Brustkasten, wenn ich auch nur Treppen hochstieg. Vielleicht hatte sich mein Mann ja verschätzt und ich bin eigentlich auf 5.000 Metern gefahren. Aber ein späterer Blick auf die Landkarte bestätigte ihn. Schon das Flachland lag auf 2.000 Metern Höhe.
Was meinen Wissensdurst über indianisches Leben anbetraf, konnte ich ein weiteres Kapitel dazuschreiben. Es war ein zeitgenössisches Bild. Diese Apachen betrieben ihr Skigebiet effizient aber mit wenig Wärme dem Gast gegenüber. Verschlossenen Gesichtern stand ich gegenüber, ob ich einen Tee bestellte oder nach der Toilette fragte. Kein Lächeln und kaum Blickkontakt. Aber ihr Land war sehr schön.
Eines Tages, allen gegenteiligen Vorhersagen zu Trotz, kam doch der lebensspendende Regen über das ausgetrocknete Land. Da es so unerwartet geschah, kam ich an jenem Tag mit ziemlich feuchtem Haar und nassen Kleidern zu meiner Vorlesung. Ich wurde bewundert, als ob ich eine Gefahr überstanden hätte. Einige Studenten bedauerten mich wegen meines schwierigen Lebens mit dem Fahrrad. Eine junge Frau, geboren und aufgewachsen im Valley of the Sun, bot mir an, mich nach Hause zu fahren. Das Fahrrad, schlug sie vor, sollte ich einfach auf dem Campus lassen. Niemand würde es stehlen. Am nächsten Tag würde sie mich wieder mit zum College nehmen. Eigentlich, meinte sie, sollte niemand mit dem Fahrrad unterwegs sein müssen, weder bei Regen noch bei Sonnenschein.
"Schau", sagte sie, "von jetzt ab hole ich dich immer ab. Ich muss sowieso an deinem Wohnkomplex vorbeifahren."
Ein großzügiges Angebot, fand ich, und nahm dankbar an. Daraus entstand eine wunderbare Freundschaft, die heute, nach 33 Jahren und durch alle Trennungen über Meere und Kontinente hinweg, noch anhält. Ich hatte Glück, dass sie ein Psychologiesemester belegte. Sie war eine Berufswechslerin. Ihre offene, wissbegierige Art und ihr großes Interesse an der Welt harmonierten mit meinem Lebensstil und meiner Denkweise. Meine ausländische Fremdartigkeit machte sie nicht misstrauisch, wie viele andere, sondern neugierig. Ihre Freundschaft hat natürlich meiner Anpassung ebenfalls sehr auf die Sprünge geholfen.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass andere Studenten, ähnlich wie sie, aufgeklärt und anspruchsvoll wären. Damit aber demonstrierte ich Naivität. Bis heute kann ich noch mein Erstaunen spüren, das ich empfand, als mich eine Studentin mal fragte, wie ich denn nun meine Freiheit genießen würde. Ich verstand ihre Frage nicht. Nach einigem Nachhacken meinerseits wurde mir klar, dass sie nichts über die Teilung Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg wusste. Als ich erklärte, dass ich aus Westdeutschland, dem demokratisch-kapitalistischen Teil, käme, glaubte sie mir nicht. Am nächsten Tag aber suchte sie mich auf, um zu bestätigen, dass ich doch recht hatte mit den unterschiedlichen Staatsformen in Deutschland. Sie hatte jemand gefragt, nachdem sie, wie sie sagte, nicht glauben konnte, dass sie das nicht wusste. Ich habe sie ob ihres Mutes zu so viel Ehrlichkeit bewundert.
Ein weiteres Mal war die Ungläubigkeit ganz meinerseits, als mir eine andere Studentin mitteilte, dass sie noch nie von der Deutschen Mark gehört hatte. Bislang hätte sie geglaubt, dass die deutsche Währung auch der Dollar sei. Was mich am meisten beeindruckte, war die Selbstverständlichkeit und ihr offensichtlich gesundes Selbstbewusstsein, mit dem sie solche Ignoranz eingestand. Freundschaftlich vertieften wir uns in ein Spiel, in dem wir die gegenseitige Unwissenheit über des anderen Land testeten. Neben herzlichem Gelächter konnte man immer wieder den erstaunten Ausruf: "Oh, wirklich?" hören. Wer da ohne Mangel ist, der werfe den ersten Stein!
Manchmal, wenn ich auf dem Campus alleine war, stand ich still, um die frische, reine Wüstenluft zu atmen und meine gehetzten, zielorientierten Gedanken rasten zu lassen. In solchen Momenten konnte ich meine eigenen Nerven singen hören. Ich war mir bewusst, dass um mich herum, in jede Himmelsrichtung, 1.000 Meilen bizarre, schöne, aber auch gefährliche Sonora Wüste lag. American Samoa kam mir in den Sinn. Dort war ich inmitten einer gigantischen Wasserwüste, wenn man so will. Jetzt stand ich in einer schier endlosen Sand- und Steinwüste. Aber anders als in Samoa landeten und starteten hier täglich viele Flüge. Außerdem hatten wir ein Auto, mit dem man ja auch losfahren konnte.
Diese Vorstellung wurde allerdings jäh gestört, als Arizona 1973 die erste Ölversorgungskrise erlebte. Sie machte mir klar, dass ein Motor alleine die Mobilität nicht sichern konnte und dass dieser Fleck Erde von funktionierender Versorgung von außen abhängig war. Meine Vorstellung lief kurze Zeit Amok, da ja auch Lebensmittel ohne Lastwagen nicht ankommen konnten.
Unter Freunden und Bekannten war Humor das Vehikel, mit dem wir versuchten, unsere unterschwellige Angst vor dem leeren Benzintank zu unterdrücken. Da sie alle mit einem Auto auf den Campus kamen, hatten sie Grund zu bangen. Ein Pferd, meinten einige, würde uns Benzinfreiheit verschaffen. Sicher, meinten andere, man könnte an jeden Laternenpfahl, der auf dem College-Gelände stand, ein Tier anbinden. Das wäre mal etwas Abwechslung vom täglichen Einerlei. Ich schlug vor, dass ein Kamel wohl der Gipfel der Freiheit wäre, denn es bräuchte nur alle zwei Wochen zum Wassertank geführt werden. Mit anderen Worten, wir hatten viel Spaß, unsere Fantasie spielen zu lassen. Ich fühlte mich in diese Solidarität völlig mit eingeschlossen. Das Gefühl der Zugehörigkeit war während dieser Tage sehr präsent. Sicher wäre es stärker geworden, wenn nicht einige immer wieder auf meine ausländische Herkunft zurückgekommen wären, egal ob aus positiven oder negativen Gründen.
Einer meiner Kurse, Entwicklungspsychologie, wurde von einer weiblichen Professorin geleitet. Sie war eine hervorragende, enthusiastische, unkonventionelle Rednerin und ein warmherziger Mensch. Mit jedem ihrer Studenten versuchte sie eine persönliche Verbindung herzustellen. Ich mochte sie sehr. Eines Tages kam im Rahmen der menschlichen Sprachentwicklung das Thema der bilingualen Erziehung auf die Agenda. Sie benutzte mich, um den Unterschied zwischen doppelter Muttersprache und dem Erlernen von Fremdsprachen als Erwachsener zu demonstrieren, denn Letzteres resultiert in einem Akzent, nebst anderen Fakten, betonte sie. Aber, so dozierte sie, solch ein Akzent würde von den Amerikanern im Allgemeinen als sexy empfunden. Diese Möglichkeit hatte ich noch nie bedacht! Tatsächlich — machte mich mein holpriges Englisch sexyer? Neben meinen anderen Schwierigkeiten mit Grammatik, Semantik und Kultur hatte ich da ja ein ausgleichendes Attribut, das mir bisher keine Dienste geleistet zu haben schien.
Aber die Tatsache, dass ich Ausländerin war, wurde beileibe nicht immer positiv gesehen. Während einer Vorlesung in einführende Soziologie, bemerkte eine Studentin, dass die amerikanische Kultur als eine sehr junge zu verstehen wäre. Ohne lange Überlegung schloss ich an, dass man diese Kultur auch als Fortsetzung oder Weiterentwicklung einer älteren sehen könnte, da die Einwanderer ja kulturelles Erbe aus ihren Ursprungsländern mitgebracht hatten. Danach herrschte für ein paar Sekunden vollkommene Stille im Raum. Sofort war mir klar, dass ich in irgendein Fettnäpfchen getreten war. Eine Studentin klärte mich schließlich auf: Man könne da nicht zurück bis zur Mayflower gehen, meinte sie. Außerdem würden Ausländer dieses Thema sicher nicht nachvollziehen können. Nachdem ich verstand, dass man hierzulande eine junge und nicht eine mitgebrachte Kultur sein wollte, ging ich schnellstens zu meinen Freunden, um die Theorie zu prüfen und mich beruhigen zu lassen.
Während ich noch damit beschäftig war, meine Anpassung voranzubringen, zeichnete sich schon das Ende vom Abenteuer Arizona ab. Die Arbeit meines Mannes in Phoenix war beendet. Er war nun in Iowa und später in Pennsylvania beschäftigt. Tausende von Kilometern lagen nun zwischen uns. Wir sahen uns nur in unregelmäßigen Abständen an Wochenenden. Ich fühlte mich wie in der Wüste gestrandet. Dass wir diese Situation nicht lange aufrechterhalten wollten, war uns klar. Mein Mann suchte nach einer anderen Firma, die uns wieder zusammenführte. Er wurde bald fündig, in Washinton, D. C., an der Ostküste. Er war begeistert und wir beschlossen, nachdem ich mein Sommersemester beendet hatte, dorthin umzuziehen. Wir konnten wieder zusammenleben. Dass der Unterschied zwischen unserem jetzigen Domizil und dem zukünftigen groß sein würde, war für mich erstmal nebensächlich.
Wie schon bei früheren Umzügen, wurde der Gedanke, mein Leben in Arizona abzuschließen, von gemischten Gefühlen begleitet. Auf einer Seite des Spektrums waren die Erleichterung und die Freude, dass mein Mann und ich wieder zusammen sein konnten. Andererseits aber trauerte ich der riesigen Sonara-Wüste nach, an die ich mich so gewöhnt hatte und die ich liebte. Auch das Naturwunder des Grand Canyon konnte nicht mehr einfach erreicht werden, wenn man wollte. Das Flair des amerikanischen Südwestens mit der bizarren Landschaft, der einheimischen Bevölkerung und der Pioniergeschichte würde mich nicht länger umgeben.
Aber nicht nur die physische Umgebung mit ihrer heilsamen Wirkung auf mich musste zurückgelassen werden. Meine Freunde zu verlassen war mir ein schmerzhafter Verlust. Sie waren nicht nur angenehme Begleiter in meinem dortigen Leben, sondern auch verlässliche Stützen gewesen. Ihre Toleranz, ihr Verständnis, ihre Weitsichtigkeit hatten mich sehr beeindruckt. Ich hatte mich mit ihnen pudelwohl gefühlt. Sogar jetzt noch versuchte eine von ihnen, mich auf positive Gedanken hinsichtlich meiner Veränderung zu bringen: "Es wird dir dort drüben gefallen. Es ist grün dort und sie haben vier Jahreszeiten", meinte sie.
Ich hatte viel von ihnen gelernt und bekommen. Jetzt fühlte ich, dass ich ihnen etwas schuldig bleiben musste. Das Versprechen, mich zu melden sobald ich eine neue Adresse hatte, ließ ein kleines Hintertürchen nach Arizona offen. Es minderte den Abschiedsschmerz und gab Hoffnung, dass wir uns nicht total verlieren würden. Es wurde eine komplizierte Runde von Goodbyes.