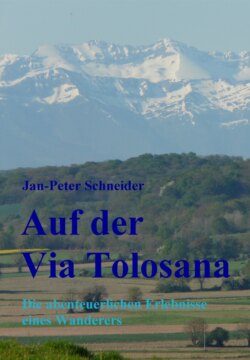Читать книгу Auf der Via Tolosana - Jan-Peter Schneider - Страница 5
Kapitel 3 3. Vauvert – Gallargues-le-Montueux: Bis zum Pont Ambroix
ОглавлениеAm nächsten Morgen bei Tageslicht verlasse ich die Kammer und stelle überrascht fest, dass die Kammer, in der ich übernachtet habe, allem Anschein nach früher eine Pferdebox war, die zu einer kleinen Unterkunft umgebaut wurde. Auf Nachfrage lacht Eric, der Inhaber der Herberge: „Der Vorbesitzer hat in den Pferdeboxen einst Pferde gehalten, um seinen eigenen Kindern und den Kindern seiner Freunde und Nachbarn Reitunterricht zu ermöglichen.“ Später beim Frühstück erzähle ich ihm über meine Eindrücke von der zweiten Etappe: „Gestern Abend bin ich in der Altstadt einem pensionierten Militärseelsorger, der früher beim Euro-Korps gearbeitet hat, begegnet. Der alte Mann hat mir dann bei der Suche nach einer Unterkunft geholfen.“ Eric, das merke ich schon, ist ziemlich unzufrieden mit den politischen Verhältnissen in Frankreich, denn er beginnt sogleich zu schimpfen: „Schon seit Jahren geht es in Frankreich bergab. Jetzt kürzlich hat der Verteidigungsminister tatsächlich beschlossen, einen Standort des Euro-Korps zu schließen, um eine Kürzung des Verteidigungsetats auszugleichen.“ Eric schüttelt verärgert den Kopf. „Gerade beim Euro-Korps wird der Rotstift angesetzt.“ „Das ist nun tatsächlich vollkommen unverständlich.“ stimme ich ihm zu. „Gestern – auf der Etappe von St. Gilles du Gard nach Vauvert – habe ich ziemlich viele Weingüter, Apfel-, Pfirsich-, Aprikosen- und Kirschplantagen gesehen.“ wechsele ich das Thema. „Ja, die Region ist ein wichtiges Obst- und Weinanbaugebiet.“ erklärt mir Eric. „Die Pflückarbeiten in den Obstplantagen und die Weinlese auf den Weingütern sind natürlich sehr arbeitsaufwendig. In der Erntezeit sind die Landwirte daher auf Unterstützung durch Saisonarbeitskräfte angewiesen. Insgesamt arbeiten hier jedes Jahr etwa 2.000 Erntehelfer. Viele von denen kommen schon seit vielen Jahren, um bei der Obst- und Weinernte etwas hinzuzuverdienen.“ Nach einer kurzen Pause fügt Eric hinzu: „Während der Weinlese wird hier in der Stierarena übrigens auch ein traditionelles Stierfest veranstaltet.“ „In Vauvert gibt es eine Stierarena?“ frage ich erstaunt. „Bei deiner Ankunft in Vauvert musst du eigentlich an der Arena vorbeigelaufen sein.“ erwidert Eric. „Die Stierarena befindet sich nämlich am Rande der Altstadt an einem großen Platz.“ „Ja, das mag sein, dass ich daran vorbeigelaufen bin.“ räume ich ein. „In der Dämmerung ist mir die Arena aber nicht aufgefallen.“ „In der Camargue hat eigentlich fast jede Stadt eine solche Stierarena. Bei den traditionellen Stierrennen werden die Hörner der Stiere mit Kokarden geschmückt, die die Raseteurs mit Hilfe eines Hakens innerhalb einer Viertelstunde abreißen müssen. Nach dem Stierrennen erhalten die Raseteurs dann die für die Kokarden festgesetzten Preisgelder.“ Eric holt ein Buch über Stierrennen in der Camargues herbei und zeigt mir verschiedene Illustrationen, die die schwarzen Camargue-Rinder sowie die weißgekleideten Raseteurs und ihre Helfer, die Tourneurs, bei der Jagd auf die Kokarden zeigen. Während ich einen Café au lait schlürfe, stellt Eric fest: „Europa bietet jungen Leuten während Ausbildung und Studium viele Möglichkeiten mit dem ERASMUS-Programm. Meine Tochter hat während ihrer Schulzeit selbst ein Jahr an einem College in England verbracht.“ „Wo denn?“ erkundige ich mich neugierig. „In Brighton, an der englischen Südküste.“ „Ach, in Brighton steht doch der Royal Palace, der nach dem Vorbild indischer Mogul-Paläste erbaut und im Inneren im chinesischen Stil eingerichtet wurde.“ rufe ich aus. „Und mit den Vergnügungsparks auf den Piers.“ ergänzt Eric. „Genau.“ „Und der College-Besuch hat im Rahmen eines schulischen Austauschprogramms stattgefunden?“ „Nein, das war eine private Organisation, die diesen College-Aufenthalt vermittelt hat. Die Gasteltern aus Brighton haben sich bereit erklärt, meine Tochter für ein Jahr in ihrem Haus aufzunehmen. Ihre englischen Mitschüler haben sich aber ziemlich garstig gegenüber meiner Tochter verhalten und sie bei jeder Gelegenheit aufgezogen und gehänselt – so bösartig, wie Kinder in diesem Alter eben sein können.“ Eric schweigt einen Moment nachdenklich, bevor er fortfährt: „Meine Tochter hat während dieses College-Jahres ziemlich leiden müssen.“ „Ja, manchmal fehlt denen ein Gespür für die Grenzen des Humors.“ „Auf jeden Fall hat sie während dieses College-Aufenthaltes ihre englischen Sprachkenntnisse deutlich verbessern und nebenbei einige wertvolle Lebenserfahrungen sammeln können.“ Eric nimmt einen Schluck Wasser zu sich. „Die EU erlaubt die Gasförderung mittels Fracking.“ empört sich Eric, kurz nachdem er das Wasserglas abgesetzt hat. „Obwohl beim Fracking ein giftiges Chemikalien-Cocktail unter Hochdruck in den Untergrund gepresst wird, damit sich das Gas aus dem Schiefergestein lösen kann.“ „Ja, neulich habe ich auf ARTE eine Dokumentation über die Auswirkungen der Förderung von Schiefergas mittels Fracking auf Mensch und Natur in den USA gesehen.“ erzähle ich Eric. „Beim Fracking bilden sich im Untergrund bis zu 800 Meter lange Risse im Gestein. Neuste Untersuchungen haben ergeben, dass diese Fracking-Methoden bereits mehrere Erdbeben in den USA ausgelöst haben.“ „Nicht zu glauben!“ schüttelt Eric mit dem Kopf. „Das Chemikalien-Gemisch, das beim Fracking in das Schiefergestein gepresst wird bzw. das für die Wartung von Bohrköpfen und Röhren genutzt wird, besteht aus unzähligen giftigen Substanzen. Etwas ein Drittel des Chemikalien-Gemisches bleibt dauerhaft im Boden, die übrigen zwei Drittel müssten eigentlich aufwendig auf Sondermüll-Deponien entsorgt werden, aber in der Praxis verdunstet dieses Chemikalien-Gemisch in aller Regel in Sammelbecken, wodurch die Giftstoffe in großen Mengen ungefiltert in die Atmosphäre entweichen.“ „Unfassbar!“ ruft Eric aus. „In der Tat.“ stimme ich ihm zu. „Dazu kommt, dass die Chemikalien-Flüssigkeit, die im Boden verbleibt, in vielen Fällen das Grundwasser vergiftet. Das „Wasser“, das dort aus dem Wasserhahn fließt, teilweise tiefschwarz, teilweise bräunlich getrübt, aber auf jeden Fall übelriechend und ungenießbar, kann überhaupt nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden.“ Eric schüttelt erschüttert den Kopf. „Wenn dort Einwohner zu Hause den Wasserhahn aufdrehen, können die Leute das im Wasser gelöste Methangas mit einem Feuerzeug entzünden, so dass eine riesige Stichflamme entsteht.“ Eric nickt mit dem Kopf: „Das Video habe ich auch schon im Internet gesehen.“ „Außerdem werden anscheinend immer wieder Vorfälle dokumentiert,“ fahre ich fort „in denen hochkonzentrierte Gasgemische aus dem Erdboden austreten und zu einem Massensterben bei Fischen, Kaninchen und Vögeln führen. Und bei Menschen führen das vergiftete Trinkwasser, die Gasaustritte sowie die verdunsteten Chemikalien zu Übelkeit, Schwindelgefühlen, Kopfschmerzen, Asthma sowie Verlust des Riech- und Geschmacksvermögens. Aufgrund der krebsauslösenden Inhaltsstoffe des ChemikalienCocktails besteht zudem der Verdacht, dass Fracking im Zusammenhang mit Krebserkrankungen in den Gasfördergebieten steht.“ Nachdenklich hält Eric sein Wasserglas in der Hand: „Und dabei ist das Schiefergas-Vorkommen relativ gering. Berechnungen der förderbaren Schiefergasvorkommen in Europa haben ergeben, dass die Schiefergas-Vorkommen – außerhalb der Wasserschutz- und Naturschutzgebiete – gerade einmal wenige Jahre zur Deckung des Gasbedarfs ausreichen würden – und das bei sehr hohen Kosten für die Förderung des Schiefergases. Im übrigen zeigt sich mittlerweile in den USA, dass das förderbare Schiefergasvorkommen lange Zeit maßlos überschätzt wurde.“ „Ich glaube, die geringe wirtschaftliche Bedeutung des Schiefergases steht in keinem Verhältnis zu den potentiellen Schäden, die mit Fracking-Methoden verbunden sind.“ meint Eric. „Das EU-Parlament sollte wirklich ein eindeutiges Verbot von Fracking aussprechen.“ Nach dem Frühstück ist es an der Zeit, endlich zur heutigen Etappe aufzubrechen. Eric, der selbst vor einigen Jahren mit seiner Tochter auf der Via Podiensis unterwegs war, verabschiedet mich: „Bonne route! Ultreia!“ „Merci bien! Bonne journée!“
Schon wenige Minuten später habe ich die Kleinstadt Vauvert hinter mich gelassen. In der Nacht ist ein kräftiger Regenschauer über der Gegend niedergegangen und die Temperaturen sind spürbar gesunken. Auf dem Weg herrscht eine tiefe morgendliche Stille. Fröstelnd stapfe ich an frisch gepflügten Ackerflächen und kahlen Weinstöcken vorbei, sobald ich aber in die Nähe von Aussiedlerhöfen gelange, erhebt sich hinter den Hofmauern lautes Hundegebell. „Vielleicht sollte ich mir,“ denke ich bei mir, „doch noch einen Wanderstock zulegen.“ In der Nähe von Codognan tummeln sich zahlreiche Kaninchen vor ihrem ausgedehnten Bau unmittelbar am Wegesrand. Auf regennassen Feldwegen stiefele ich durch feuchten Erdboden, und bald schon klebt ein fetter Erdklumpen an der Sohle meiner Wanderschuhen. Mit Blick auf die noch ausstehende Wegstrecke durch ausgedehnte Weingüter versuche ich erst gar nicht, die Wanderschuhe von den lehmigen Klumpen zu säubern. Die Hitze ist – schon am Vormittag – unerträglich. Es ist daher wenig verwunderlich, dass ich trotz des flachen Terrains fürchterlich ins Schwitzen gerate. Gegen Mittag erreiche ich endlich den heutigen Etappenort, die kleine Ortschaft Gallargues-le-Montueux. Auf dem Marktplatz herrscht ein erstaunlich reges Treiben. Auf der vollbesetzten Terrasse eines Restaurants unterhalten sich die Gäste ausgesprochen lebhaft, und auf den Sitzbänken am Rande des Marktplatzes treffen immer wieder Anwohner zu einem kurzen Plausch zusammen. In der Nähe des Marktplatzes finde ich dann – zu meiner großen Erleichterung – auch die Herberge.
Nach einer Ruhepause in der Gîte unternehme ich noch am selben Nachmittag einen kurzen Ausflug zum nahegelegenen Pont Ambroix, die Ruine einer bedeutenden römischen Brücke, die einst den Fluss Vidourle überquerte. An dieser Stelle befand sich die Via Domitia, eine wichtige Fernstraße im Römischen Reich, die einst den Alpenübergang am Col de Montgenévre und den Pyrenäenübergang am Col de Panissars miteinander verband. An der Via Domitia lagen einige wichtige Handelszentren wie Nemausus, das heutige Nîmes, und Narbo Martius, das heutige Narbonnne. Der Pont Ambroix stand hier ursprünglich auf 12 Brückenpfeilern und hatte eine Länge von insgesamt 180 Metern. Durch Verfall und Abriss ist heute leider nur noch ein Rundbogen mit einer Länge von 10 Metern zu sehen. Tief beeindruckt stehe ich vor dem Querschnitt des Pont Ambroix, an dem sich der Aufbau einer römischen Straße leicht nachvollziehen lässt. Die römischen Bautrupps stabilisieren zunächst den Untergrund mit groben Steinen, dann brachten sie Schotter und Sand auf, um Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen. Zum Abschluss ordneten die Bautrupps die stabilen Pflastersteine jeweils mit einer leichten Neigung zum Straßenrand an, damit das Regenwasser auf beiden Seiten der Straße ablaufen konnte. Mit anderen Worten: Eine ingenieurstechnische Meisterleistung! Zurück in der Gîte öffne ich eine Flasche Wein, um bei einem Glas die herrlichen Erlebnisse des heutigen Tages noch einmal Revue passieren zu lassen, vor allem aber den Pont Ambroix, das formidable Bauwerk, das über 2000 Jahre in den Fluten des Vidourle überdauert hat und immer noch ein beredetes Zeugnis für die bautechnischen Fertigkeiten der römischen Bauingenieure ablegt.