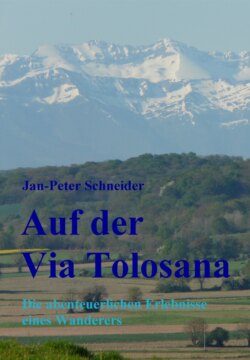Читать книгу Auf der Via Tolosana - Jan-Peter Schneider - Страница 8
Kapitel 6 6. Montarnaud – St.-Guilhelm-le-Désert: Über die Teufelsbrücke ins Kloster
ОглавлениеAm frühen Morgen setze ich mich vor der Herberge auf der Treppe, um – bei angenehmen Frühlingstemperaturen – die letzten Vorbereitungen für die heutige Etappe zu treffen. Wenige Minuten später verlasse ich das beschauliche Montarnaud. Bereits am Rande der Ortschaft wartet eine kurze, aber heftige Steilstufe. In engen Serpentinen kämpfe ich mich den kräftezehrenden Steilanstieg empor. Auf dem Schichtkamm atme ich erst einmal tief durch und blicke verschwitzt auf das über 100 Meter tiefer gelegene Montarnaud hinab. Gut aufgewärmt steige ich auf der anderen Seite auf verlassenen Waldpfaden talabwärts, bevor ich nach La Bossière, einem kleinen Cevennen-Dorf, hinaufsteige. „Eigentlich merkwürdig, dass die zwei Pilger mit der Prozessionsstandarte und die beiden Wanderer aus Florenz noch nicht vor mir auf der Strecke aufgetaucht sind.“ denke ich bei mir. Nach einer kurzen Pause am Dorfbrunnen, auf dem Place Hipolyte Negrou, folge ich dem Schotterweg einer aufgegebenen Eisenbahntrasse. Die Sonne brennt mittlerweile erbarmungslos auf mich herab. In sengender Hitze quäle ich mich über die Schotterpiste, während nur wenige Meter entfernt ein kühler Baggersee Abkühlung verspricht. Nach Unterquerung einer unscheinbaren Eisenbahnbrücke darf ich endlich die Schotterpiste verlassen und biege nach links auf einen Feldweg ab, der mich ein kleines Tal aufwärts führt. Auf Fußpfaden durch einen Eichen- und Lorbeerwald gelange ich in ein Weinanbaugebiet, in dem Winzer gerade dabei sind, Schnittarbeiten an den Weinstöcken durchzuführen. Während dunkle Regenwolken den Himmel zunehmend verfinstern, steige ich zum Dorf Aniane hinab. Kaum habe ich den Ort durchquert, setzt schon leichter Nieselregen ein. Eilig haste ich durch Weinfelder und Olivenhaine, denn schließlich möchte ich nicht unbedingt auf freiem Feld in ein heftiges Unwetter geraten. Bald überquere ich die Landstraße D27EE1, laufe im Eiltempo einen Weinberg hinauf und schlage dann den Feldweg in Richtung Jean-de-Fos ein. Zwischen den Weinfeldern lässt der Nieselregen dann unvermittelt nach, stattdessen kommt mir eine Hundebesitzerin mit ihrem Bordercollie entgegen. „Die Strecke bis St.-Guilhelm-le-Désert ist nicht mehr weit.“ verspricht sie mir. „Bei Jean-de-Fos müssen Sie die Teufelsbrücke über den Hérault überqueren und auf der anderen Seite der Schlucht flussaufwärts folgen.“ Wie sich herausstellt, wohnt die Hundebesitzerin selbst im Dorf. „In der Hochsaison ist St.-Guilhelm-le-Désert ein touristischer Anziehungspunkt, vor allem das Kloster Gellone aus der Zeit von Charlemagne.“ schwärmt sie mir vor, während ihr Bordercollie übermütig herumtollt. „Stop!“ ruft sie ihrem Hund zu. „Down!“ Ich blicke leicht verdutzt. „Mein Bordercollie ist mehrsprachig.“ erklärt sie mir. Und ich befürchte beinahe, das meint sie ernst. Wir verabschieden uns und ich ziehe weiter auf Jean-de-Fos zu, das unmittelbar am Eingang der Hérault-Schlucht liegt. Der Hérault hat sich dort bereits tief in das zerklüftete Felsgestein eingegraben und rauscht wild schäumend durch das enge Flussbett. Auf dem Pont du Diable, einer eleganten, zweibogigen Brücke aus dem 11. Jahrhundert, überquere ich den Hérault und steige auf der anderen Seite flussaufwärts in die enge Felsschlucht. Auf beiden Seiten ragen karg bewachsene Felswände steil empor. Auf winzigen, von Menschen angelegten Terrassen klammern sich kleinwüchsige Olivenbäume verzweifelt an das nackte Felsgestein. Auf engen Fußpfaden, am Rande der steil abfallenden Felswände, wanke ich vorwärts, immer weiter in die Hérault-Schlucht hinein. Die bislang zurückgelegte Strecke steckt mir bereits in den Knochen, an jeder neuen Flussbiegung erwarte ich ungeduldig St.-Guilhelm-le-Désert. Stattdessen marschiere ich an einer romantischen Burgruine vorbei, die auf einem, von dem Hérault umspülten Felsblock thront, und steuere auf die nächste Flussbiegung zu. Doch anstelle von St.-Guilhelm-le-Désert entdecke ich den Eingang zur Grotte du Clamouse, einer Tropfsteinhöhle, die sich im Inneren des Berges versteckt. Dann endlich, bei Einbruch der Dämmerung, erreiche ich das mittelalterliche Dorf St.-Guilhelm-le-Désert.
Die (einzige) enge Gasse des Dorfes, mit seinen dicht gedrängten Steinhäusern, die sich von der Hérault-Schlucht in ein schmales Seitental erstreckt, liegt um diese Zeit bereits wie ausgestorben da. Lediglich winzige Blumenbeete an den steinernen Hauswänden jämmerlich kleiner Höfe und dezente Ladenschilder der ansässigen Kunsthandwerker deuten darauf hin, dass St.-Guilhelm-le-Désert überhaupt bewohnt ist. Weiter oben im Dorf, hinter einem kleinen Klostergarten, versteckt sich die romanische Abteikirche Gellone, die Guillaume d'Aquitaine, ein Cousin von Charlemagne, nach Feldzügen auf der iberischen Halbinsel, mit einigen anderen Mönchen gegründet hat. Bald darauf schenkte Charlemagne höchstpersönlich dem Kloster eine Kreuzreliquie, die St. Guilhelm-le-Désert in der Folge zu einem beliebten Wallfahrtsort machte. Ein Teil des Kreuzganges der Abteikirche Gellone wurde, das entnehme ich aus meinem Wanderführer, einige Jahrhunderte später von einem Sammler aufgekauft und nach New York verschifft, und steht dort mittlerweile – zusammen mit anderen Originalen europäischer Klöster – in den Ausstellungsräumen des Metropolitan Museum of Art. Neugierig stoße ich das Kirchentor auf, um einen Blick in das Innere der historisch bedeutsamen Abteikirche zu werfen. Zu meiner Überraschung stelle ich fest, dass im schon ziemlich dunklen Kirchenraum gerade eine Abendmesse gefeiert wird. Vor dem hell erleuchteten Altar haben sich die wenigen Kirchgänger soeben – gemeinsam mit dem Pfarrer in seiner weißen Soutane und einigen Karmeliter-Nonnen in cremefarbener Ordenstracht – im Kreis versammelt. Feierlich hebt der Pfarrer den kleinen Korb mit den Hostien in die Höhe und spricht die liturgischen Formeln, bevor er den Korb weiterreicht. Während die Kirchgänger, einer nach dem anderen, noch andächtig ihre Hostie entnehmen, ergreift der Pfarrer bereits den Kelch, der auf dem Altar abgestellt ist, hebt ihn ebenfalls in die Höhe und fährt mit den traditionellen liturgischen Formeln fort. Unauffällig verlasse ich die Abteikirche wieder.
In der Pilgerherberge des Abbaye Carmel St. Joseph, wenige Meter weiter, empfängt mich eine Karmeliter-Nonne. Nach den Formalitäten drückt sie mir noch einen stilvollen, ovalen Stempel in mein Créanciale. Der Stempel bildet einen Pilger im Umhang ab, der – mit Pilgerstab (natürlich mit Jakobsmuschel) und Tasche ausgestattet – auf die Abteikirche Gellone zustrebt. Darüber ist in eleganten Lettern zu lesen: Carmélites de Saint Joseph. Unterhalb der Abbildung steht: St.-Guilhelm-le-Désert. Daneben enthält der Stempel – ganz zeitgemäß – sogar noch Internet- und Email-Adresse des Karmeliter-Kloster. Nachdem ich das Créanciale wieder verstaut habe, erkundige ich mich nach den zwei Pilgern mit der Prozessionsstandarte und den beiden Wanderern aus Florenz. „Nein,“ lächelt die Karmeliter-Nonne freundlich „die sind hier nicht eingetroffen.“ Im Innenhof steige ich – wie von der Karmeliter-Nonne beschrieben – die enge Steintreppe zu dem im Dachgeschoss gelegenen Schlafsaal hinauf, wo ich erst einmal den Rucksack verstaue. Wenig später, schon etwas munterer, treffe ich unten in der Küche zwei weitere Gäste, die, wenn ich mich recht entsinne, vorhin in der Abendmesse zu den wenigen Kirchgängern gezählt haben, bei der Vorbereitung des Abendessens. Der schlaksige Mann mit dem spitzbübischen Lächeln, Bernard, spricht französisch, während der kleine Mann mit dem nachdenklichen Gesicht, Hans, sich auf deutsch vorstellt. Es dauert eine Weile, bis ich realisiere, dass die Jugendfreunde beide aus Nancy stammen. „Wie kommt es, dass Sie so gut deutsch sprechen?“ erkundige ich mich neugierig bei Jean. „Während meiner Tätigkeit als Französisch-Lehrer habe ich – auf eigenen Wunsch – an Schulen in Alsace und in Lorraine unterrichtet, um die deutsche Sprache zu erlernen. Ich habe mich häufig mit Schülern, Eltern und alten Leuten unterhalten.“ Gleich darauf gibt Jean einige – sehr überzeugende – Kostproben des elsässischen Dialektes. „Hervorragend.“ Beim Abendessen im Aufenthaltsraum stoßen wir erst einmal mit einem Glas Wein an. „À la santé.“ „Prost.“ „In der Altstadt von Nancy“ stellt Jean seine Heimatstadt vor „liegt der Place Stanislas, der erst vor ein paar Jahren vollständig restauriert wurde. In der Mitte dieses Platzes steht eine Statue zu Ehren von Stanislas.“ „Stanislas? Wer ist denn das?“ erkundige ich mich. „Stanislas wurde 1704 zunächst zum polnischen König gewählt, musste aber wenige Jahre später aus Polen flüchten. Zuerst hielt er sich mit seiner Familie im Fürstentum Deux-Ponts auf, dann im Herzogtum Lorraine und schließlich in Wissembourg im Alsace."erwidert Jean. „Im Jahr 1725 heiratete Louis XV. dann überraschend seine Tochter Maria. Als Stanislas wenige Jahre später endgültig auf die polnische Königskrone verzichten musste, erhielt er dafür vom französischen König zum Ausgleich die Herzogtümer Lorraine und Bar als Geschenk. In seiner Zeit als Herzog von Lorraine und Bar gründete Stanislas – ganz im Sinne der Aufklärung – die Bibliothèque Royale, die Societé Royale des Sciences et des Belles-Lettres sowie zahlreiche öffentliche Schulen, um Bildung, Wissenschaft und Künste in den Herzogtümern zu fördern. In sozialer Hinsicht ließ Stanislas zudem öffentliche Krankenhäuser und öffentliche Kornkammern bauen und richtete eine Unterstützung für die Bedürftigsten ein.“ „Das hört sich ja außerordentlich spannend an.“ „Das ist es auch.“ bestätigt Jean. „Nancy, insbesondere Place Stanislas und Place de la Carrière, musst du unbedingt einmal besuchen.“ „Ach, Nancy ist doch gar nicht so eine schöne Stadt.“ wirft Bernard ein, während er den Rotwein ausschenkt. „Die gotische Kathedrale in Metz mit seinen farbigen Kirchenfenstern hat eine besondere spirituelle Atmosphäre. Damit kann Nancy doch überhaupt nicht mithalten.“ „Ja, durch den Kontrast zwischen relativ dunklem Innenraum und strahlend-leuchtenden Kirchenfenstern herrscht in der Kathedrale von Metz tatsächlich ein besonders stimmungsvolles Ambiente. Das ist sicherlich richtig.“ Für eine Weile ist am Tisch nur das Klappern des Besteckes zu hören.
„Glaubst du denn an Gott?“ fragt mich Jean unvermittelt. Ein wenig überrascht druckse ich herum, bevor ich antworte: „Ich bin katholisch.“ Jean und Bernard schauen mich erwartungsvoll an, warten aber vergeblich auf weitere Erklärungen. „Das können heutzutage nicht mehr viele von sich behaupten.“ kommentiert Jean schließlich trocken zu Bernard gewandt. „Bei Hiob – du kennst doch Hiob?“ fragt mich Bernard. „Ist das der, der mehrere Tage im Bauch eines Wales zubringt.“ frage ich leicht naiv. „Nein!“ antwortet Bernard entsetzt, „Das mit dem Wal ist Jonas, ein eher zweifelhafter Charakter.“ „Warum denn das?“ „Jonas erhält von Gott den Auftrag, die Stadt Ninive aufzusuchen, um den Einwohnern ein Strafgericht Gottes anzudrohen. Doch Jonas gehorcht dem Auftrag Gottes nicht und flieht stattdessen auf einem Schiff in die entgegengesetzte Richtung.“ „Ach so. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder.“ „Hiob dagegen ist ein frommer Mann. Aber der Satan vermutet, dass Hiob vielleicht nur deswegen so gläubig ist, weil er in guten Verhältnissen lebt, und schlägt daher Gott vor, Hiob ins Unglück zu stürzen, um seinen Glauben auf die Probe zu stellen. Gott lässt also zu, dass Hiob sein gesamtes Vermögen verliert, dann sterben alle seine zehn Kinder. Doch Hiob schwört seinem Gott immer noch nicht ab. Dann darf Satan – mit der Erlaubnis Gottes – sogar dafür sorgen, dass Hiob an einem bösartigen Geschwür erkrankt. Hiobs Frau fordert ihn dazu auf, endlich diesem verdammten Gott abzuschwören. Doch selbst unter diesen Umständen weigert sich Hiob, Gott zu verfluchen.“ „Ich verstehe.“
Während ich auf dem Teller die letzten Reisbrocken aufkratze, naschen Bernard und Jean bereits an ihrer selbst zusammengestellten Käseplatte. „An den Rohstoffbörsen sitzen Spekulanten,“ schimpft Bernard, während er mit seiner Gabel gerade ein Käsestück aufspießt „Spekulanten, die nur darauf aus sind, Profite zu machen. Die Spekulanten kaufen in großem Maßstab Grundnahrungsmittel auf und treiben damit die Preise in die Höhe – auf Kosten der Ärmsten, die nicht mehr in der Lage sind, ihre täglichen Mahlzeiten zuzubereiten.“empört sich Bernard. „Das ist unmoralisch!“ „Im letzten Jahr ist es deswegen ja in einigen afrikanischen Ländern bereits zu heftigen Protesten gekommen, weil die einfache Bevölkerung nicht mehr die Preise für einfache Grundnahrungsmittel zahlen konnte.“ bestätigt Jean. „Die vier weltweit größten Rohstoffhändler, die die Rohstoffmärkte dominieren, haben ihren Sitz ja in Genf. Sobald die Rohstoffhändler feststellen, dass sich irgendwo auf der Welt größere Missernten abzeichnen, weil Dürreperioden oder andere Wetterkapriolen das Pflanzenwachstum auf den Feldern beeinträchtigen, kaufen diese Händler in großem Stil Grundnahrungsmittel auf.“ ergänze ich „Und nutzen dann die steigenden Nahrungsmittelpreise aus, um Gewinne zu machen.“ „Das ist unmoralisch!“ empört sich Bernard erneut. „Das sind rücksichtslose Profiteure von Hunger und Elend. Diese Rohstoffspekulation müsste man verbieten.“ „Auf dem Börsenparkett gibt es heutzutage ja kaum noch Aktienhändler, die Handel mit Aktien treiben. Beim Hochfrequenzhandel sind es stattdessen Computerprogramme, die im Bruchteil einer Sekunde große Aktienpakete kaufen und verkaufen. Bei der hohen Geschwindigkeit des Börsenhandels kann es für eine Investmentbank heute bereits von entscheidender Bedeutung sein, ob das eigene Rechenzentrum einige Hundert Meter näher am Rechenzentrum der Börse liegt als das Rechenzentrum der Konkurrenz, damit überhaupt ein Deal zustande kommt. Und die Computerprogramme nutzen bereits kleinste Preisunterschiede an der Börse aus, um Gewinne zu erzielen.“ „Das ist absoluter Wahnsinn!“ schüttelt Jean verständnislos mit dem Kopf. „Börsenspekulation, die nur auf die Profite schaut, ist unmoralisch!“ bekräftigt Bernard. „Ich denke, man muss zwischen Bankern und Bankiers unterscheiden.“ erklärt Jean. „Während Bankiers die Spareinlagen ihrer Kunden nach Treu und Gauben und zu günstigen Konditionen verwalten, wollen Banker jedes Jahr um jeden Preis 15-20 % Eigenkapitalrendite für ihr Bank erwirtschaften und sind dafür bereit, hochriskante Spekulationsgeschäfte zu tätigen und ihre Kunden mit Provisionen und Gebühren über das Ohr zu hauen.“ „Das ist unmoralisch!“ stimmt Bernard zu. „In letzter Zeit sind viele skrupellose Banker unterwegs, die – in Zusammenarbeit mit betrügerischen Rating-Agenturen – Anleihen mit drittklassigen Hypothekendarlehen auflegen und als erstklassige Wertanlagen auf den Finanzmärkten verkaufen. In den Finanzzentren manipulieren Banker verschiedener Banken – in krimineller Absicht – die EURIBOR-Zinssätze, um privaten Kreditnehmern überteuerte Zinssätze abzuknöpfen und diese beim unerlaubten Insiderhandel – natürlich auf Kosten der Verbraucher – für Spekulationsgeschäfte auszunutzen.“ „Das ist unmoralisch!“ empört sich Bernard erneut. „Bankiers hingegen“ fügt Jean hinzu „stellen sich ausschließlich in den Dienst ihrer Kunden.“ „Das kommt aber selten vor!“
Später, bei einem Stück Birnenkuchen und Expresso, erfahre ich, dass Bernard erst kürzlich ein Haus am Rande vom St.-Guilhelm-le-Désert gekauft hat. „Die spirituelle Atmosphäre in St.-Guilhelm-le-Désert finde ich wirklich inspirierend.“ schwärmt Bernard. „Dann hat sich unerwartet die Gelegenheit ergeben, hier ein Haus zu erwerben, und da habe ich sofort gesagt: Ja, klar. Wo ist der Vertrag?“ Jean schüttelt missbilligend mit dem Kopf. „An Marias Verkündigung habe ich den Kaufvertrag unterzeichnet und einen Tag vor Weihnachten wurde das Grundstück übereignet. Wenn das kein gutes Omen ist!“ lächelte Bernard verschmitzt. „Das Haus in Nancy habe ich mittlerweile verkauft.“ Jean schüttelt mit dem Kopf. „Ich lasse mich da ganz von Gottes Willen leiten. Ich brauchte einen Dachdecker, um das Dach auszubessern. Da hat mich ein Nachbar angesprochen, ob er mir bei der Renovierung des Daches helfen könnte. Ja, sagte ich, ja. Ich brauchte einen Maurer, um das Mauerwerk zu erneuern. Da hat mich ein anderer Nachbar angesprochen, ob er das Mauerwerk instandsetzen könnte. Ja, sagte ich, ja.“ lächelt Bernard glücklich: „Jetzt habe ich einen Dachdecker und einen Maurer.“ Auch wenn Bernard immer wieder versucht, seinen Freund davon zu überzeugen, ebenfalls ein Haus in St.-Guilhelm-le-Désert zu erwerben, lehnt Jean ein solches Ansinnen entschieden ab: „Wenn ich eine solche Entscheidung treffe, dann muss ich doch die Vor- und Nachteile durchdenken und kann nicht – im fortgeschrittenen Alter – spontan ein derartiges finanzielles Risiko eingehen. Das muss man doch erst einmal gründlich durchrechnen.“
Zu später Stunde, auf den Kuchentellern liegen nur noch Krümel, die Expresso-Tassen sind schon längst erkaltet und in der Küche klappern die abgeräumten Teller, schüttelt Jean niedergeschlagen den Kopf: „Ich war immer fest im Glauben, aber in letzter Zeit bin ich – contrastive – ich weiß nicht, wie ich sagen soll – flatterhaft und wankelmütig.“ Jean legt eine Pause ein. „Contrastive – flatterhaft, wankelmütig.“ Ja, Jean beherrscht die deutsche Sprache wirklich hervorragend. „Mein Cousin sagt, er glaubt nicht.“ Jean hält einen Moment inne. „Und dann besucht er zu Weihnachten oder Ostern wieder die Kirche.“ erklärt er sichtlich irritiert über dieses inkonsequente Verhalten und verharrt nachdenklich schweigend. „Morgen“ erklärt Jean nach einer langen Pause „werde ich per Anhalter ein paar Freunde in der Gegend besuchen, Freunde, die ich längere Zeit nicht mehr gesehen habe, um mich im Glauben zu stärken.“