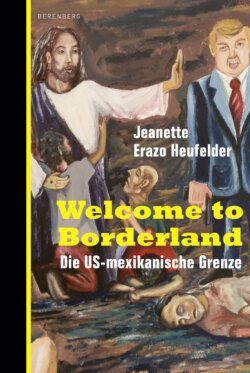Читать книгу Welcome to Borderland - Jeanette Erazo Heufelder - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung Biographie einer Grenze
ОглавлениеThey go north, to get south
(Terry Allen: Dialogue. The Characters. A simple story. Juárez)
Die Geografie des Rio-Grande-Tals ist ein wenig verwirrend: Roma liegt in Texas, USA, am nördlichen Ufer des Rio Grande. Miguel Aleman, die Ortschaft direkt gegenüber, befindet sich in der fronteriza-Region der Provinz Tamaulipas, Mexiko. Auf mexikanischer Seite wird aus dem Rio Grande der Rio Bravo. An dessen Südseite beginnt der mexikanische Norden, an seiner Nordseite endet der Süden der Vereinigten Staaten. Und auf beiden Seiten des Flusses breitet sich das Rio-Grande-Tal aus. The Valley, sagen die Texaner zu ihrer Hälfte. La frontera chica, die kleine Grenze, die Mexikaner zu der ihren, beziehen sich aber nur auf jenen Teil, der die Provinz Tamaulipas streift. Das Valley auf der amerikanischen Seite zieht sich hingegen über 330 Kilometer von Brownsville bis nach Laredo.
Die topografische Verwirrung setzt sich in den Ortsnamen fort. Südlich der Grenze begann man nach 1848 neuen Siedlungen die Namen von Ortschaften zu geben, die auf der nördlichen Seite des Rio Bravo bereits existierten. Nur gehörten sie, nachdem das Land die Hälfte seines Staatsgebiets an die Vereinigten Staaten verloren hatte, plötzlich nicht mehr zu Mexiko. Die nordamerikanischen Städte spanischen Ursprungs sind deshalb in jedem Fall älter als ihre Gegenstücke auf mexikanischer Seite. Das zeigt exemplarisch der Fall der beiden Laredos, bei dem das ursprüngliche Laredo am Nordufer durch eine Siedlungsneugründung auf der mexikanischen Seite des Flusses einfach gedoppelt wurde. Außerdem ging man in Mexiko nach 1848 dazu über, Städte auf die Namen von Unabhängigkeitskämpfern und Staatspräsidenten umzubenennen. Die alten Städte und Gemeinden, die schon zu Zeiten des spanischen Vizekönigreichs gegründet wurden, sind also nicht unbedingt verschwunden, wenn sie nicht mehr zu finden sind. Sie heißen nur anders. Wie zum Beispiel Miguel Aleman. Der Ort hat 1950 zu Ehren des damals amtierenden mexikanischen Präsidenten dessen Namen erhalten und dafür seinen historischen – nämlich San Pedro de Roma – aufgegeben, weshalb sich nicht mehr automatisch die enge Verbindung zu Roma auf der gegenüberliegenden Flussseite erschließt. Beide Ortschaften gingen aus ein und derselben hacienda hervor, die im Zuständigkeitsbereich einer Gemeinde namens Mier lag. 1871 wurde aus dieser Gemeinde, die sich auf mexikanischer Seite zehn Kilometer westlich des heutigen Miguel Aleman befindet, eine Stadt, worauf sie so stolz war, dass sie darauf sogar in ihrem Namen aufmerksam machte: Mier hieß fortan offiziell Ciudad Mier.
Der mexikanische Autor David Toscana schreibt in seinem Essay Fronteras movedizas1, dass Grenzen nur so lange ein Gegenstand der Geografie blieben, wie sie stillhielten. Sobald sie sich bewegten, würden sie zu einem Gegenstand der Geschichte. In der Geschichte Mexikos hat sich die nördliche Grenze gleich mehrmals gen Süden bewegt. Das erste Mal 1836, nachdem sich Texas von Mexiko abgespalten hatte, wenngleich Mexiko die politische Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz offiziell nie anerkennen sollte. Das nächste Mal 1848 nach der Niederlage gegen die USA, als Mexiko die Hälfte seines Staatsgebiets verlor. Und schließlich 1853 beim sogenannten Gadsden-Kauf, durch den die USA auch noch die südlichen Gebiete des heutigen Arizona erwarben. Damit hatte die Grenzlinie ihren gegenwärtigen Verlauf erreicht: Auf ihrem ersten Drittel folgt sie dem Rio Grande/Bravo flussaufwärts. Hinter Ciudad Juárez und El Paso führt sie westlich in Richtung Yuma weiter. Südlich von Yuma läuft sie schließlich in gerader Linie auf den westlichen Rand des amerikanischen Festlandes zwischen Tijuana und San Diego zu.
Im Unterschied zu einer rein geometrischen Linie oder geologischen Barriere ist eine historische Grenze eine politische Erfindung. Sie hat zur Voraussetzung, dass es irgendeine Art von Beziehung zwischen den beiden angrenzenden Ländern gibt. Im Fall der US-mexikanischen war die Herausbildung einer überaus komplexen Grenzbeziehung auf 3144 Kilometer Länge keineswegs so zwingend wie es heute im Rückblick erscheint. Denn die gemeinsame Grenze, die von ihrem Ausgangspunkt am Golf von Mexiko quer über den Kontinent durch Wasser, Schluchten, endlose Plains und ausgetrocknetes Land bis zum Pazifik verläuft, hätte beide Länder räumlich ebenso gut voneinander trennen können. Eine Möglichkeit, die von Sebastián Lerdo de Tejada – Präsident Mexikos von 1872 bis 1876 – als Argument gegen eine transnationale Eisenbahnverbindung ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Er schlug vor, die Wüste so zu belassen wie sie war, um einen möglichst großen Abstand zum starken Nachbarn im Norden zu schaffen. Mexiko sollte in Ruhe seinen Entwicklungsrückstand zu ihm aufholen können.
Lerdo de Tejadas Überlegung, die Wüste als Puffer zwischen Stärke und Schwäche einzusetzen, geistert als oft zitiertes Aperçu durch die Geschichte. Denn tatsächlich hatten sich beide Länder zu dem Zeitpunkt schon längst auf ihre gemeinsame Grenze zubewegt. So machte der US-amerikanische Historiker Frederick Jackson Turner Ende des 19. Jahrhunderts in der Expansion Richtung frontier sogar den Wesenskern der amerikanischen Identität aus. Und für den mexikanischen Historiker Justo Sierra – ein Zeitgenosse Turners – waren die Erfahrungen mit eben dieser Grenze entscheidende Faktoren für die Herausbildung eines mexikanischen Nationalgefühls. Schon immer war die gemeinsame Grenze für beide Länder eine Projektionsfläche, auf der sich gleichermaßen symbiotische Beziehungen und mentalitätsgeschichtliche Verschiedenheiten sowie traditionelle Ängste spiegelten. Immer wieder wird vor allem das Trennende und Problematische beschworen, in Gestalt von Arbeitsmarkt- und Sicherheitsproblemen durch unkontrollierte Einwanderung sowie Drogenschmuggel und Gewalt. Mexiko und die USA haben sich dabei des Öfteren schon die Argumente des jeweils anderen zu eigen gemacht. Mexiko zum Beispiel das von dem allzu mächtigen Nachbarn, an dessen Seite man selbst zu schwach sei, um von ihm unabhängig existieren zu können. Mit genau diesem Argument hatte im mexikanisch-amerikanischen Krieg ein Teil der US-amerikanischen Öffentlichkeit die Annektierung von ›ganz Mexiko‹ gefordert.2 Und umgekehrt hatten die USA die Annektierung der einstmals nur dünn besiedelten Gebiete Kaliforniens, Arizonas und New Mexicos damit begründet, dass Mexiko das Land nicht zum Nutzen der Menschheit bewirtschaften könne.
Vor 170 Jahren hatte Mexiko tatsächlich Probleme damit, seine abgelegenen Grenzprovinzen für Siedler dauerhaft attraktiv zu machen. Inzwischen gehört die mexikanischstämmige Bevölkerung nördlich der Grenze jedoch zur am schnellsten wachsenden Minderheit der Vereinigten Staaten und gilt nun gerade deshalb als gesellschaftliches Entwicklungshemmnis. Mit dem Ruf nach einer unüberwindbaren Mauer wird von US-amerikanischer Seite also nicht nur auf eine Bedrohung von außen reagiert, sondern auch auf das als nicht minder bedrohlich empfundene erstarkte Selbstbewusstsein jener Grenzregion, die einst zu Mexiko gehörte und heute die nationale politische Hegemonie zu gefährden scheint. In Mexiko verlief der Prozess historisch genau umgekehrt: Hier entstand zuerst ein Bewusstsein für die historische Gefährdung der Nationalstaatlichkeit durch Kriegsniederlage und Landverlust, bevor daraus eine Selbstwahrnehmung als Nation erwuchs. Was heute für Spannung sorgt, ist also mitnichten das Ergebnis einer Entfremdung. Es steckt im Kern dieser Verbindung. Ob man der Grenze von Ost nach West oder von West nach Ost folgt, ob man sie von den Ufern des Rio Grande oder des Rio Bravo aus betrachtet: Sie entstand durch einen Schnitt, der einen Organismus in zwei Hälften trennte. Es ist deshalb kein bloß geografischer Perspektivenwechsel, ob man die Geschichte der Grenze mit Blick auf den Rio Bravo oder den Rio Grande erzählt, selbst wenn es sich dabei um ein und denselben Fluss und um die gleiche Geschichte handelt. Die Grenze ist die Narbe eines Konflikts, der zwar historisch ist, aber nicht bewältigt wurde. Je nachdem also, aus welcher Perspektive man auf die Grenze blickt, ist sie la frontera oder the Border – mit den damit verbundenen politischen, geschichtlichen und kulturellen Unterschieden. Die Geschichte der Grenzbeziehung zeigt aber zugleich auch, dass sich in der Betonung des Trennenden in Wirklichkeit schon immer das Wissen um die Unauflösbarkeit dieser Beziehung offenbart hat.