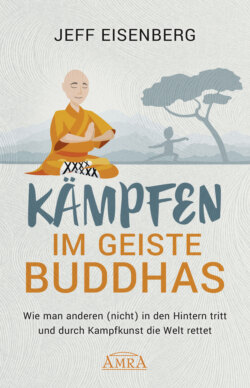Читать книгу Kämpfen im Geiste Buddhas - Jeff Eisenberg - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der komisch wirkende Dicke
ОглавлениеIch bin kein Gott. Ich bin nur ein Erwachter.
Meinen ersten Kontakt mit Buddha hatte ich als Kind. Er war überall. Es gab Buddha-Statuen im Haus, draußen im Garten, und meine Mutter schien ihn ständig in ihren Gemälden zu verewigen, die in allen Zimmern hingen. Sogar viele Möbel wirkten fernöstlich.
Ehe ihr anfangt, euch das Bild eines kleinen Blumenkindes auszumalen, das in einem buddhistischen Haushalt einer Hippie-Künstlerin nahe bei Woodstock in den wunderschönen Catskill Mountains aufwuchs oder in irgendeiner Kommune im nördlichen Kalifornien, muss ich euch verraten, dass die Wahrheit noch wesentlich verrückter ist. In Wahrheit wuchs ich in Jersey, unmittelbar außerhalb von New York City, auf und, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wir waren nicht einmal Buddhisten!
Trotz aller Darstellungen von Buddha ringsum erinnere ich mich nicht daran, dort auch nur ein einziges Mal etwas über ihn gehört zu haben, und über keine der Darstellungen wurde jemals gesprochen. Mir ist klar, dass ihr jetzt vielleicht sagt: »Also gut, sie waren keine Buddhisten, aber wahrscheinlich haben sie sich einfach mit Meditation befasst.« Falsch! Mit Medikation, ja, aber nicht mit Meditation!
Also kam ich zu dem Schluss, dass alle diese Skulpturen und Bilder von dem komisch wirkenden Dicken nur seltsame Dekorationen waren, und beließ es dabei. Als ich älter wurde, merkte ich, dass dieser komisch wirkende Dicke vielen Leuten ziemlich wichtig war. Ich war mir nicht sicher, ob er ihr Gott war oder nicht. Ich spürte zwar eine sonderbare Verbindung mit ihm, hatte aber das Gefühl, dass er nicht mein Gott war. Was mich wiederum zu der Frage bracht, wer eigentlich mein Gott war. Ich kam zu dem Schluss, es müsse der andere Dicke sein, derjenige, der einen roten Anzug trug und uns jedes Jahr die ganzen Geschenke brachte. So musste es wohl sein! Doch trotz dieser Überzeugung gefiel mir der halbnackte, dicke, chinesische Kerl immer noch besser … Ich wusste nur nicht, warum.
Etwa zu dieser Zeit entdeckte ich die Fernsehsendung Kung Fu. Von dem Moment an, als ich sie zum ersten Mal sah, war ich wie hypnotisiert – völlig gebannt davon. All diese Handlungen, in denen es um Kampfkunst ging, die anschaulichen Bilder des exotischen klösterlichen Schauplatzes mit seinen schönen Tempeln und Gärten, Kerzen und Räucherstäbchen. Die tiefe Stille und Beschaulichkeit, die dort dargestellt wurde! Nie zuvor in meinem Leben hatte ich mich so stark mit irgendetwas identifiziert. Obwohl ich damals nichts über östliche Religionen, östliche Kulturen und klösterliches Leben wusste, fand dies alles tief in meinem Inneren Resonanz, denn es hatte etwas an sich, das ich intuitiv als wohltuend empfand. Viele Menschen berichten, dass sie bei ihrem ersten Aufenthalt in einem Zendo oder Dojo das überwältigende Gefühl einer »Heimkehr« haben. Und genau das empfand ich stets, wenn ich eine Darstellung von Buddha sah, und besonders, als das alles in den Kung-Fu-Filmen zum Leben erwachte.
Zwar liebte ich die Kampfhandlungen der Filme, aber mich berührten auch die Rückblenden sehr, in denen der verwirrte junge Schüler Caine Rat beim großen Meister Po sucht. Caine sitzt dann meistens vor dem Meister und sucht nach Antworten auf seine tiefen philosophischen Fragen. Meister Po reagiert darauf stets mit einem Rätsel des Koan, das den jungen Caine erst recht verwirrt. Immer endet das Gespräch damit, dass Meister Po laut lacht und der Grashüpfer (Meister Pos Spitzname für den jungen Caine) begreift, dass die Antwort auf seine Frage darin besteht, dass er die falsche Frage gestellt hat. Egal, was passierte: Für Caine schien es schon tröstlich zu sein, wenn er sich einfach bei Master Po aufhalten durfte. Und das löste bei mir den Wunsch nach einem Ort aus, wo ich genauso hingehen konnte wie Caine zu Po. Ich wollte meinen eigenen Meister Po! Vielleicht hatte ich mich ja geirrt. Vielleicht war der komisch wirkende Dicke tatsächlich mein Gott oder hätte es zumindest sein sollen! Wie auch immer: Ich würde meinen Meister Po finden!
Ich weiß nicht, ob ich meine Eltern um Erlaubnis bat oder sie einfach mein Interesse an den Kung-Fu-Filmen bemerkten und es deshalb übernahmen, mich zu einer Kampfkunstschule zu bringen, jedenfalls ging ich eines Tages zur eigenen Verblüffung dorthin. Das war schon eine große Sache, denn in den späten 1960er Jahren gab es, anders als heute, eine solche Schule nicht gerade an jeder Straßenecke. Während meine Freunde alle in irgendeiner unteren Liga Baseball spielten, karrte meine Mutter mich durch mehrere Ortschaften zu einem winzigen Dojo. Der Leiter war ein japanischer Judomeister, der kaum Englisch sprach.
Als ich dieses Dojo zum ersten Mal betrat, war das wirklich ein Erlebnis! Die Dekorationen erinnerten mich an Caines Kloster, ich durfte genau wie Caine einen coolen Kampfanzug tragen, und natürlich gab es auch hier einen hauseigenen Meister Po! Alles war genau so, wie ich es mir gewünscht hatte – das heißt, es war so, bis der Meister damit anfing, uns lauter anzubrüllen, als ich jemals einen Menschen hatte brüllen hören. Und was noch schlimmer war: Ich konnte nicht verstehen, was er brüllte! Nachdem ich während einer höchst anstrengenden Trainingsstunde immer wieder auf die Matte geschleudert worden war, wurde mir klar, dass dieser Meister mir die Antworten auf meine Fragen, falls er überhaupt welche hatte, geradezu einhämmern würde.
Als ich etwas älter war und mich schon ein bisschen im Kampfsport auskannte, war ich nicht mehr so daran interessiert, einen Meister Po zu finden, sondern vor allem daran, zu einer Kampfmaschine zu werden. Was diesen Wunsch als Erstes nährte, waren die neu entdeckten Kung-Fu-Kinofilme am Samstagnachmittag. Und wieder war ich wie hypnotisiert! Im Vergleich zu diesen Filmen wirkten die Kung-Fu-Fernsehfilme so, als tänzelten die Schauspieler nur herum und machten »Backe, backe Kuchen«. Die Kerle in den Kinofilmen waren unglaublich! (In Wahrheit war das Meiste albern: Großartige Athleten zeigten dort Gymnastikübungen und führten dabei dank der Special Effects spektakuläre, aber nutzlose Kampfkünste vor. Ich war damals erst zehn Jahre alt, also seht es mir nach!) Einem Kind mussten diese Kerle wie übermenschliche Helden vorkommen – direkt den Comicbüchern entstiegen und zum Leben erwacht. Und natürlich wollte ich genau wie sie sein.
Das heißt … bis ich Bruce Lee sah.
Bruce war derjenige welcher! Er stellte die Typen aus den Samstagnachmittag-Kung-Fu-Filmen so sehr in den Schatten, dass sie nur noch lächerlich wirkten. Während sie maskenhaft geschminkt waren wie Kabuki-Schauspieler, seidene Pyjamas trugen, die Kimonos ähnelten, Gymnastik und routinierte Tanzschritte vollführten, die als »Kämpfe« durchgehen sollten, platzte Bruce mitten in die Szenerie hinein, stellte einen zähen, bis zum letzten Muskel durchtrainierten Körper zur Schau und brillierte in den echtesten Kampfszenen, die je gedreht worden waren. Er machte einen nicht nur glauben, dass man hier realen Kampftechniken zuschaute, sondern dass man sie sich durch harte Arbeit auch selbst aneignen konnte.
Bruce Lee zuzusehen war für mich ein erneutes Erlebnis der »Heimkehr«. Dieses Erlebnis war der Katalysator für eine tief reichende, intuitive Erkenntnis, die mich von der Theatralik der Fantasyfilme mit ein bisschen Kung-Fu-Handlung in eine andere Richtung katapultierte – auf den Weg zu einem realitätsnahen Training und zur Suche nach der wahren Kampfkunst jenseits aller falschen Vorstellungen.
Man muss es Bruce hoch anrechnen, dass er sozusagen im Alleingang und über Nacht einen Riesenaufschwung des Kampfsports bewirkte. Er war hinsichtlich seiner Auffassungen von einem effizienten Training seiner Zeit um Lichtjahre voraus. Lange vor allen anderen hatte er begriffen, dass ein Training in nur einem Kampfstil den Schüler einschränkt und einzig derjenige ein vielseitiger Kampfsportler wird, der sich das aneignet und in sein Arsenal aufnimmt, was funktioniert – egal, zu welchem Kampfstil diese Methode ursprünglich gehört hat. Ebenso war ihm schon frühzeitig klar geworden, wie wichtig allgemeine Fitness ist und welche Rolle sie beim Kämpfen spielt.
Was Bruce dazu brachte, sich vom herkömmlichen Training zu verabschieden, war ein Kampf, zu dem er herausgefordert wurde – jedenfalls ist das die Legende, die gern erzählt wird. Als Bruce von Hongkong aus zum ersten Mal in die USA reiste, um im Umkreis von San Francisco Kampfkunst zu unterrichten, erboste er die örtliche chinesische Vereinigung der Kampfsportler dadurch, dass er auch nicht-chinesische Schüler annahm. Ein ihm feindlich gesinnter Lehrer war darüber so wütend, dass er Bruce zu einem Kampf herausforderte, und Bruce ging darauf ein. Dieser Kampf wurde zum Wendepunkt in seinem Konzept von Kampfkunst.
Nach Berichten von Augenzeugen war dieser »Kampf« letztlich nichts anderes als ein alberner Tanz, bei dem die beiden Gegner einander abwechselnd durch den Raum jagten. Er endete, ohne dass einer von beiden einen erfolgreichen Angriff hatte durchführen können. Nicht ein einziger Schlag wurde ausgetauscht. Bruce führte das darauf zurück, dass sie beide versucht hatten, den traditionellen, roboterhaften, choreografierten Trainingsdrill auf diese Kampfsituation anzuwenden. Dadurch wurde ihm klar, dass sich dieses wirklichkeitsfremde Training in einer kritischen Alltagssituation als nutzlos erweisen musste. Weder sein Kontrahent noch er selbst hatten sich auf »echte« Kampferfahrungen stützen können.
Nach diesem Vorfall veränderte Bruce seine Denkweise und sein Training. Er verabschiedete sich von der überholten Ausschließlichkeit der traditionellen Einstellung »Mein Stil ist der beste« und ging zu einem aufgeschlossenen, wissbegierigen Training über, indem er Techniken aus vielen verschiedenen Kampfstilen übernahm. Dazu zählten auch das westliche Boxen und das europäische Fechten. Ihm wurde klar, dass er das Training fortwährend daraufhin überprüfen musste, ob das, was man früher für effizient gehalten hatte, überhaupt irgendwann effizient gewesen war oder den heutigen Maßstäben noch genügte.
In einer von Bruces berühmtesten Filmszenen sehen wir beispielsweise einen Kampf, bei dem er durch seine praktische Erfahrung einem traditionell kämpfenden Gegner eine Lektion erteilt. Höflich sieht Bruce zu, wie ein Mann mehrere Bretter durchschlägt. Danach wendet sich dieser Mann in aggressiver Körperhaltung Bruce zu. Offensichtlich glaubt er, unseren Helden eingeschüchtert zu haben. Doch Bruce knurrt einfach: »Bretter … schlagen nicht zurück!« Und dann macht er sich daran, den Mann zu Brei zu schlagen.
In Sekundenschnelle begreifen wir alles. Bruce nimmt uns die Ehrfurcht vor raffinierten Kunststücken und ersetzt sie durch das Erfassen einer realen Situation. Das Zertrümmern von Brettern hat seinem Gegner nicht die unmittelbare Erfahrung vermittelt, die er für die Anwendung seiner Fähigkeiten in Situationen des wahren Lebens benötigt. Er weiß nur, wie man Bretter durchschlägt, was allerdings rein gar nichts mit Kämpfen zu tun hat, wie er auf schmerzhafte Weise feststellen muss.
Das war eine wichtige Lektion. Doch obwohl sie so leicht nachzuvollziehen war, verstanden sie nur wenige. Die meisten Schüler des Kampfsports waren immer noch wie besessen von der mystischen Aura des Übernatürlichen, die damals die Kampfkünste umgab. Sie machten sich selbst vor, eine besondere Fähigkeit zur Durchführung übermenschlicher Kunststücke erwerben zu können, und begriffen nicht, dass die Ausbildung in den Kampfkünsten etwas ganz anderes beinhaltet: die Entwicklung einer realistischen, praktischen Anwendung körperlicher Fähigkeiten durch unglaublich harte und sich ständig wiederholende Arbeit an sich selbst. (An dieser Stelle muss ich anmerken, dass es vor allem die Lehrer der Kampfkünste und des buddhistischen Dharma selbst waren, die das Klischee der mystischen Aura aufrechterhielten, doch dazu später.)
Bruce Lees Erkenntnis und die Richtung des Trainings, die er daraufhin einschlug, veränderte den Kampfsport für alle Zeiten. Alle Kampfsportler müssen ihm für seine innovativen Vorstellungen und Theorien, soweit sie das praktische Training betreffen, äußerst dankbar sein. Doch Bruce blieb in diesen Vorstellungen und Theorien stecken, perfektionierte sie in einer kontrollierten Umgebung und setzte sie nie Tests in Alltagssituationen aus. Soweit es das Training betraf, wurde er zu einem Experten, aber nicht in dessen realer Anwendung.
Der Buddhismus weist auf ein solches Problem mit dem Ratschlag hin: »Sobald dein Boot das andere Ufer erreicht, steige aus, gehe an Land und weiter, denn jetzt brauchst du das Boot nicht mehr.« Leider blieb Bruce auf seinem Boot und betrat niemals das andere Ufer. Er revolutionierte das Training, doch verwechselte er das Boot – das Transportmittel zu neuen Ufern – mit dem Ufer selbst.
Auf dieses Dilemma stößt man nach wie vor in zahlreichen Dojos und Zendos. Viele Kampfsportler sind Meister der Trainingsmatte und Opfer der Straßenkämpfe – manchmal in körperlicher Hinsicht Opfer, jedoch stets in geistiger Hinsicht (mehr dazu später). Und viele Menschen, die meditieren, sind Roshis auf dem Sitzkissen, leiden aber sehr im wahren Leben. In beiden Fällen beherrschen sie ihre Übungen meisterhaft, können sie jedoch im Alltag nicht anwenden. Niemals haben sie ihre meisterlichen Fähigkeiten einer wirklichen Härteprobe ausgesetzt. Sehr schade, dass auch Bruce es nicht getan hat.
Zu Zeiten von Bruce Lee (Anmerkung für die jüngeren Leserinnen und Leser: also in den uralten Zeiten der 1960er und 1970er Jahre) erregte auch ein anderer Kampfsportler, Joe Lewis, mein Interesse. Joe war ein großer, starker Kriegsveteran, der in Übersee einen Schwarzen Gürtel erworben hatte – vor allem dadurch, dass er alle anderen »zu Brei« schlug. Nachdem er in die USA zurückgekehrt war, begann er an Karatewettkämpfen teilzunehmen (die, zumindest damals noch, ohne Schutzvorrichtungen stattfanden, das heißt die Teilnehmer schlugen wirklich aufeinander ein). Im Ring wurde Joe Lewis zu einer Sensation, da er fast jeden Gegner förmlich auseinander nahm. Wenn er wirklich einmal einen Kampf verlor, dann deshalb, weil er Zurückhaltung zeigen und sich an bestimmte Regeln halten musste. Es lag nicht etwa daran, dass sein Gegner bessere Kampffähigkeiten besessen hätte. Joe kannte den Unterschied zwischen einem Kampf im Ring und dem Kampf in einer realen Situation. Und denjenigen, die ihn im Ring tatsächlich mal auf die Matte legen konnten, war bewusst, dass Joe ihnen in einem Straßenkampf den Kopf abreißen würde, sofern er das wollte.
Joe erschütterte die Welt der Kampfkünste, als er in einem Interview erklärte, Bruce Lee und er seien Freunde und er habe großen Respekt vor Bruces Neuerungen, soweit sie das Training beträfen. Doch ein wahrer Kämpfer sei Bruce nicht. Er habe sich selbst niemals beweisen müssen, da er seine Fähigkeiten nur unter kontrollierten Trainingsbedingungen vorgeführt habe, wobei ihm seine Gegner »in den Hintern gekrochen« seien.
Als Bruce Lees jugendliche Fans als Reaktion auf Joes Erklärung darauf hinwiesen, dass Wettkämpfe zwar keine Messlatte für wirkliche Kampffähigkeiten bieten könnten, Straßenkämpfe jedoch sehr wohl (angeblich hatte Bruce als Teenager in Hongkong zahlreiche Straßenkämpfe ausgefochten), erwiderte Joe: »Ich bin ein Kriegsveteran, der ein Meter dreiundachtzig groß ist und mehr als neunzig Kilo wiegt. Bruce ist zirka ein Meter siebzig groß und wiegt etwa sechzig Kilo …«
Joe forderte seinen Freund niemals offiziell heraus, und Bruce reagierte niemals auf Joes Erklärung zu seinen Fähigkeiten. Es war klar, was nach Meinung von Joe passieren würde, sollten sie tatsächlich einmal in einem Straßenkampf gegeneinander antreten. Und Bruce war nicht besonders scharf darauf, das herauszufinden.
Die Welt der Kampfkünste rastete geradezu aus. Joes Erklärung kam einer Gotteslästerung gleich! Und so wurde er in dieser Welt gehasst wie kein anderer. Bruce Lees Anhänger bauten sozusagen eine »Wagenburg« rings um ihr Idol auf, um »den Meister zu schützen« und zu verteidigen. Sie rechtfertigten Bruce, versuchten zu begründen, warum Joe so falsch daran getan hatte, diese öffentliche Erklärung abzugeben, und Bruce so richtig daran getan hatte, Joe nicht praktisch zu widerlegen.
Ich war damals völlig fassungslos. Wie konnte jemand, dessen ganze Karriere, sein guter Ruf und selbst sein Leben darauf beruhten, dass er nicht nur eine neue Kampfordnung geschaffen, sondern auch neue, individuelle Kampftechniken entwickelt hatte, es ablehnen, sie unter Beweis zu stellen? Wie war es möglich, dass Bruce Lees Unterstützer das nicht nur akzeptierten, sondern sich um ihn scharten und seine Kampfunwilligkeit billigten – wobei sie alle typischen, im Kampfsport verbreiteten Rechtfertigungen dafür ins Feld führten? (Mehr dazu später.)
Bevor alle Bruce-Lee-Fanatiker unter euch jetzt einen Killer auf mich ansetzen, muss ich an dieser Stelle erklären, dass ich nach wie vor ein Riesenfan von Bruce Lee bin! Geändert hat sich lediglich, dass ich ihn und das, was er geleistet hat, mittlerweile aus einer anderen Perspektive betrachte. Immer noch bewundere ich seine großartige Weitsicht, seine Trainingsmethoden, sein sportliches Können und natürlich auch die Filme, in denen er seinen Gegnern in den Hintern tritt. Noch vierzig Jahre später schaue ich sie mir immer wieder an! Wäre es mir lieb gewesen, hätte Bruce sich dem Kampf mit Joe gestellt? Ja. Werfe ich es ihm vor, dass er es nicht getan hat? Nein. Ich werfe ihm nur vor, dass er nicht ehrlich und in aller Bescheidenheit erklärt hat, warum er es nicht getan hat.
Da ich mich so ausführlich über Kämpfe im wirklichen Leben ausgelassen habe, mag es ein bisschen heuchlerisch klingen, wenn ich mich an dieser Stelle nicht weiter um Bruce Lees Gründe dafür kümmern möchte, dass er sich vor einem Beweis seiner Fähigkeiten in einem realen Kampf gedrückt hat. Ich will euch aber auch davon abhalten, eurem Ego nachzugeben und euch auf gefährliche Situationen einzulassen. Als Kampfsportler sollten wir alle wissen, dass jede Menge übler Kerle unterwegs sind, die uns windelweich schlagen könnten – und bei passender Gelegenheit auch tun werden. Das müssen wir begreifen, denn davon hängt sogar unser Leben ab. Nicht zufällig hat die Natur uns den Instinkt »Kampf oder Flucht« mitgegeben. Es ist albern, sich auf der Straße Verletzungen auszusetzen oder mit jemandem zu kämpfen, der uns, wie wir wissen, auf der Matte kaputtmachen wird. Stattdessen sollten wir unseren Stolz einfach hinunterschlucken und uns selbst und anderen gegenüber zugeben, dass wir in diesem Fall nicht kämpfen wollen.
Zwar liegt mir viel daran, meine Fähigkeiten in einer realistischen Situation zu testen, aber ich werde mich nicht auf einen Kampf mit einem messerschwingenden Psychopathen in irgendeiner dunklen Gasse einlassen, wenn ich das Feld auch räumen kann. Und ich werde auch nicht freiwillig mit einem Mixed-Martial-Arts-(MMA)-Kämpfer in den Ring steigen, nur weil es mir mein Ego befiehlt. Allerdings würde ich einen solchen Kampf bei einer Herausforderung auch nicht verweigern, denn tatsächlich kann man seine Kampfkunst am besten dann verbessern, wenn man dem Gegner unterliegt. Und die praktische Anwendung des Buddhismus verbessert man am besten dadurch, dass man sich allen Widrigkeiten des Lebens stellt.
Doch statt Haltung zu bewahren und einfach zuzugeben, dass Bruce nicht mit Joe kämpfen wollte, und die Gründe dafür zu benennen, versteckte sich Bruces Lager hinter den uralten Vorwänden, die heute leider immer noch in Umlauf sind. Das galt nicht nur für die globale Organisation Gracie Jiu Jitsu, ein Netzwerk zertifizierter Trainingszentren, das damals Mixed-Match-Challenge-Kämpfe durchführte und später die Ultimate Fighting Championship (UFC) veranstaltete, doch dazu später – sondern auch für alle anderen.
Solche uralten Vorwände höre ich ständig von Kampfsportlern, in deren Training es nur um choreografierte Routinekämpfe mit entgegenkommenden Partnern geht, die niemals Widerstand leisten. Die am häufigsten vorgebrachten Erklärungen, die mich am meisten zum Lachen bringen, lauten: »In der Kampfkunst besteht die höchste Leistung darin, sie niemals anzuwenden.« (Im Großen und Ganzen verstehe ich das ja, ganz ehrlich. Es macht mir nichts aus, vor jeder Bedrohung, falls möglich, wegzulaufen oder auch Hals über Kopf davonzurennen. Aber heißt das wirklich, sie niemals anzuwenden?)
Diese Leute behaupten dann als Nächstes, der wichtigste Grund, sich in den Kampfkünsten zu üben, bestehe darin, den eigenen Geist und das meditierende Denken weiterzuentwickeln. Und darauf entgegne ich: »Warum zum Teufel übt ihr euch dann in einer Kampfkunst, wenn es euch vor allem darum geht, keine Kampffähigkeiten zu entwickeln? Ich meine, ihr könnt euer Denken und euren Geist ja auch durch das Zusammenstecken von Blumensträußen oder durch die Teezeremonie schulen. Aber wenn ihr euch in Kampfkunst ausbildet, solltet ihr das tun, um realitätsnahe Fähigkeiten in dem Leistungsspektrum zu entwickeln, das die Kampfkunst lehrt.«
Und hier liegt auch das eigentliche Problem: Solche Leute müssen rechtfertigen, dass sie nicht kämpfen – genau wie es das Lager von Bruce Lee getan hat –, weil sie sich in Wahrheit gar nicht in einer Kunst des Kämpfens üben, zumindest nicht in einer, deren Ausbildungsprogramm an der Wirklichkeit orientiert ist und sich bei einer realitätsnahen Anwendung bewährt hat. Leider muss ich sagen, dass solche Leute entweder wissen, dass sie die Kampfkunst nicht anwenden können, oder sich ständig fragen, ob sie es tatsächlich könnten. Da sie ständig an ihren Übungen und Fähigkeiten zweifeln, müssen sie sich selbst gegenüber ständig lahme Entschuldigungen vorbringen, statt sich der Wahrheit zu stellen.
Es gibt nichts Traurigeres als einen Kampfsportler, der dauernd mit der Frage lebt, ob er sich im Fall des Falles wirklich verteidigen könnte! Manche können diese Frage ihr Leben lang nicht beantworten. Und was noch schlimmer ist: Sie merken nicht einmal, dass keine Antwort auch eine Antwort – ihre Antwort – ist.
Anfangs ging es mir genauso. Erst viele Jahre später begriff ich, welche wertvollen Lektionen der Kampfkunst und des Dharma ich durch alle meine Erfahrungen gelernt hatte. Von Caine und den Kung-Fu-Fernsehshows bis zu den Kung-Fu-Filmen am Samstagnachmittag, von Bruce Lee bis zu Joe Lewis: Meine Reise führte mich von der traditionellen Kampfkunst bis zur modernen Welt der Mixed Martial Arts und durch alle Höhen und Tiefen des Kampfsports.
Und ich gelangte dahin, keinen Unterricht mehr zu akzeptieren, der nicht Erfahrungen in der realitätsnahen Anwendung von Kampfkunst vermittelte, und niemandem bloße Worte abzukaufen, ohne zu prüfen, wie er sich eigentlich in der Praxis verhielt.
Das entspricht dem, was Buddha über die Suche nach Wahrheit gesagt hat: »Sei dein eigenes Licht und glaube niemandem auf ein bloßes Wort hin. Mache deine eigenen Erfahrungen und finde die Wahrheit selbst heraus.« Der Meditierende muss prüfen, ob das, was er in der kontrollierten Umgebung eines Zendos an Erfahrungen sammelt, nur das Ergebnis dessen ist, dass er sich in eben dieser kontrollierten Umgebung befindet. Er muss sich fragen, ob sich die Erfahrungen unter veränderten Bedingungen wandeln.
Ähnlich heißt es für den Kampfsportler, die eigenen Fähigkeiten beim Kampf gegen einen Widerstand leistenden Gegner in einem realitätsnahen Szenarium zu erproben. Funktionieren die Kampftechniken? Kann man sie praktisch anwenden? Kannst du sie anwenden?
Während ich breitbeinig auf der Matte stehe und meinen Gegner fixiere, ist mir klar, dass mein wahrer Gegner ich selbst bin. Ich habe diesen mentalen Prozess im Laufe meiner vielen Jahre im Kampfsport häufig durchlebt. Als praktizierender Buddhist habe ich ihn schließlich als Befreiung von einer Identifikation mit dem Ego und von der Bindung an das Ego verstanden, als Freisein von jeglicher Konditionierung, als Erleben des gegenwärtigen Moments, als Wahrnehmung der Echtzeit, gemäßigt durch die Konzentration auf einen einzigen Punkt – als einen Augenblick, der frei ist von allen festgelegten Vorstellungen und so ungebremste Spontaneität entstehen lässt.
Während ich in fester Haltung dastehe und meinen Gegner niederstarre, konzentriere ich mich darauf, den Augenblick von allem freizuhalten, was der Verstand beisteuern möchte. Ich lasse den Gedankenstrom an mir vorbeifließen, ohne mich von ihm davontragen zu lassen. Er erinnert mich an meine Verletzungen, daran, wie mein Arm einmal während eines Kampfes aus der Gelenkpfanne gerissen wurde. Ich stoße mit der Linken ein paar Mal in die Luft, und das unmittelbare Erleben, wie ich die schnellen, forschen Hiebe durchführe, zeigt mir, dass jede Sorge, die die Erinnerung bei mir ausgelöst hat, angesichts des jetzigen Zustands des Arms überflüssig ist. Der Arm fühlt sich großartig an und die Erinnerung an die Verletzung verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist.
Dann geht mir durch den Kopf, dass ich fünfzehn Jahre älter bin als mein Gegner, zirka siebeneinhalb Zentimeter kleiner und mehr als neun Kilo leichter als er. Das löst einen Moment lang Selbstzweifel bei mir aus, auf die ich gedanklich sofort und bewusst reagiere. Ich rufe mir meine Erfahrungen ins Gedächtnis, und die Selbstzweifel legen sich. Die geschickten Tritte meines Gegners schüchtern andere Kämpfer ein, und ich habe auch gesehen, wie sie durch seinen Angriff mit diesen kraftvollen Tritten zu Boden gingen. Doch was sie als seine Stärke betrachten, sehe ich als seine Schwäche an.
Der Kampf beginnt, und innerhalb meines allgemeinen Wahrnehmungsfeldes konzentriere ich mich schnell auf seinen rechten Fuß, den er jetzt fast unmerklich von der Matte hebt und rasch wieder senkt.
Kaum ist der Fuß unten, schießt er wieder hoch und holt zu einem schnellen, harten Rundschlag aus. Hätte ich die anfängliche Bewegung seines rechten Fußes übersehen, wäre ich auf diesen Rundschlag überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Ich habe einen Plan in petto, wie ich auf einen solchen Angriff reagiere, aber ich brauche mich nicht unbedingt an diesen Plan zu halten, denn unterbewusst ist mir klar, dass ich ganz natürlich und spontan reagieren muss. Wenn man an einem Plan für eine mögliche Kampfszene unbedingt festhalten will, bleibt einem nicht die Flexibilität, angemessen auf die reale Situation zu reagieren.
Meine Taktik sah ursprünglich vor, den Rundschlag von innen her mit einem Fausthieb meiner rechten Hand abzufangen. Doch da ich das anfängliche Hochzucken seines Fußes gesehen habe, konnte ich seinen Rundschlag so abfangen, dass er meinen linken Arm nur mit verminderter Wucht traf. Das erlaubte es mir, sein rechtes Bein mit meinem linken Arm einzuklemmen und sein anderes Bein unter ihm wegzufegen, so dass er auf die Matte krachte.
Wir beginnen auf der Matte zu ringen. Die meisten Menschen würden das wohl für eine Steigerung des Kampfes halten, doch in Wahrheit verlangt einem das die meiste Geduld ab. Je mehr man sich abmüht und mit voller Kraft kämpft, desto weniger Kontrolle hat man. Was beim Ringen am meisten zählt, sind Körperhaltung, Gewichtsverteilung und Zeitgefühl. Man ist dabei durchaus angriffslustig, aber der Angriff vollzieht sich als langsamer, fortwährender und methodischer Prozess, Schritt für Schritt – eher ein Fluss von einem Moment zum nächsten als die einmalige, explosive Anwendung von Kraft.
Ein Ringer muss sich bei einem Kampf dem dauernden Wechsel temporärer Bedingungen anpassen, genau wie ein Buddhist auf den Fluss des Lebens reagieren muss, bei dem ein Moment auf den nächsten folgt. Was beim Kämpfen die einmalige, von panischer Verzweiflung gespeiste Reaktion purer Angriffslust ist, ist für den Buddhisten der Augenblick des (falschen) puren Festhaltens an einer vorgefertigten, fest umrissenen Einschätzung der gegebenen Situation – die Unfähigkeit, sich auf den gegenwärtigen Moment in Echtzeit einzulassen. Für den Ringer bedeutet die (falsche) Reaktion purer Angriffslust, dass er in diesem Augenblick dem Gegner genau die Chance bietet, auf die jener gewartet hat, so dass er von ihm flachgelegt wird.
Während mein Gegner verzweifelt bemüht ist, die Position zu wechseln, wendet er die Schultern gerade so weit von mir ab, dass ich hinter ihn gleiten und seinen Rücken erwischen kann, indem ich schnell meine »Fanghaken« einsetze. Das müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen: Ich setze mich hinter ihn, klemme ihn zwischen meine Beine, ziehe seinen Rücken zu meiner Brust und verhake jedes meiner Beine über seinen. Dann lege ich meinen rechten Arm über seine rechte Schulter und um seinen Hals. Zugleich lege ich meinen linken Arm über seine linke Schulter. Mit meiner rechten Hand greife ich in die Innenseite meines linken Ellenbogens und sichere somit die Umklammerung, während meine linke Hand sich auf die Rückseite seines Kopfes senkt. Während ich zudrücke und dabei gegenläufigen Druck anwende – das heißt seinen Hals nach hinten und seinen Nacken nach vorne presse –, gibt er auf, da er sonst keine Luft mehr bekommen würde.
Die Matte ist für den Kampfsportler der Ort der Wahrheitsfindung. Hier muss er sich allen inneren Dämonen, Ängsten und Selbstzweifeln stellen, hier treten Unsicherheiten offen zu Tage. Wenn man kämpft, kann man sich nicht verbergen. Hier ist kein Raum für Selbsttäuschungen. Man muss sich schonungslos das wahre Selbst ansehen.
Das heißt nicht, dass alle Kampfsportler die eigene Wahrheit finden. Manche können oder wollen sich nicht mit der Realität ihres Trainings auseinandersetzen. Doch wenn man meint, brauchbare, in der Realität anwendbare Trainingsmethoden könnten darin bestehen, Körperschutz anzulegen, kaum Körperkontakt mit dem Gegner aufzunehmen, stets dieselben Selbstverteidigungsübungen mit einem willfährigen »Angreifer« durchzuführen oder mit der Methode des Kata herumzutänzeln und ein choreografiertes Ritual von Bewegungen in der Luft gegen einen imaginären Feind zu veranstalten, ist das nichts anderes als Selbstbetrug.
Viele Kampfsportler, die auf diese unrealistische Weise trainieren, wollten mich davon überzeugen, dass sie in einer kritischen realen Situation plötzlich fähig sein würden, völlig anders als im Training zu agieren. Ich habe nie verstanden, woher sie die Gewissheit nahmen, auf eine reale Situation vorbereitet zu sein, der sie niemals ausgesetzt gewesen waren. Doch genau das ist ja das Heimtückische an Selbsttäuschungen. Je größer die Selbsttäuschung, desto leichter kann sie einem vorgaukeln, sie sei gar keine.
Im Buddhismus nennt man ein ähnliches Dilemma das »Wenn nur«-Syndrom. Es besteht darin, dass jemand glaubt, es würde anders und besser für ihn laufen, »wenn er nur« umziehen, eine andere Arbeit machen, eine feste Beziehung eingehen oder sich aus einer festen Beziehung lösen, mehr Geld oder weniger Geld haben, ein besserer Buddhist sein, eine Erleuchtung erleben würde und so weiter und so fort. Das ist die buddhistische Version von Ausweichen oder Verdrängung, die darin besteht, der Wahrheit nicht ins Auge zu sehen. Wie der sich selbst täuschende Kampfsportler hält ein solcher Buddhist lieber an der Vorstellung fest, wie die Dinge seiner Meinung nach sein könnten, als sich zu verdeutlichen, wie sie sind.
Bei diesem »Wenn nur«-Syndrom besteht die Ironie darin, dass selbst im Fall einer Annäherung der Wirklichkeit an die eigenen Wunschvorstellungen die Erwartungen meistens enttäuscht werden. Und im Fall einer kurzzeitigen Befriedigung folgen dann schnell weitere »Wenn nurs«. Die Wirklichkeit wird niemals mit unseren eigenen Vorstellungen übereinstimmen. Wenn wir die Wirklichkeit klar vor Augen haben, uns ihr stellen, das, was wir vorfinden, zu akzeptieren lernen, und zufrieden mit dem sind, was wir haben, brauchen wir jedoch gar keine »Wenn nurs«.
Und das lässt sich auch auf den Kampfsportler übertragen. Ein verlässliches Training ist eines, das die angemessene Anwendung des Eingeübten in jeder gegebenen Situation vermittelt und die Härteprobe besteht, auch wenn diese Situation von der ursprünglichen Vorstellung abweicht. Und das tut sie immer, ob geringfügig oder stark. Szenarien des wirklichen Lebens sind stets Ergebnis von Bedingungen, die ständig im Fluss sind. Also braucht man ein Training, das Anwendungen und Reaktionen vermittelt, die genauso im Fluss sind.
Kampfkünste sind ebenso wie buddhistische Lehren reine Theorie, bis man sie unter realen Bedingungen erprobt. Dort werden sie sich entweder bewähren oder aber nicht bewähren. An einer Theorie festzuhalten, ohne sie einem Test auszusetzen, ist schädlich und verhindert die Weiterentwicklung. Auch das Scheitern bei einer Härteprobe führt weiter: zur Erarbeitung neuer Techniken für künftige Anwendungen.
Und das gilt auch für den Buddhismus. Wer den Buddhismus praktiziert, erfährt schnell, dass die kluge Anwendung buddhistischer Lehren nicht davon abhängt, was man über den Buddhismus weiß, sondern wie man mit buddhistischen Prinzipien im Alltag umgeht.
Und auch das muss man erst einmal lernen.
Da es in diesem Buch nicht zuletzt um das Praktizieren des Buddhismus geht, möchte ich an dieser Stelle auf einige doppelsinnige, scheinbar widersprüchliche Floskeln in der Art des großen Meisters Po (oder auch in der Art von Weisheiten in Glückskeksen) eingehen. Mir ist zwar bewusst, dass ich über die weit verbreiteten Fallen des »Wenn nur«-Syndroms und der Annahme »in einer realen Kampfsituation wüsste ich schon, wie ich reagieren müsste« gewettert und gesagt habe, beides sei realitätsfremd, doch was könnten sie in Wahrheit anderes sein als bestimmte Aspekte unserer Realität? Anders ausgedrückt: Während man in solche Fallen tappt, stellen sie tatsächlich unsere Realität dar, wenn auch eine schädliche, obwohl wir das nicht merken.
Wie also können wir erfahren, ob wir Selbsttäuschung mit Realität verwechselt haben? Wie können wir erkennen, dass unser Leben eher auf dem beruht, was wir annehmen, als auf dem, wie die Dinge in Wahrheit liegen? Eigentlich ist das gar nicht so schwer! Jedes Mal, wenn unsere Wunschvorstellung mit der Realität kollidiert, können wir die Entscheidung treffen, dem, was wir erkennen, nicht mehr auszuweichen oder aber eine andere Perspektive einzunehmen. Statt der Selbsttäuschung vertrauen wir nun unserem inneren Wissen, erkunden uns selbst mit gründlicher, unerschrockener Ehrlichkeit, sehen unserer Selbsttäuschung ins Auge und lösen uns unverzüglich aus diesen Fesseln.
Keine Bange! Okay, kann sein, dass das frustrierend schwer ist! Nicht schwer ist es jedoch, die Gelegenheit zur Durchführung zu finden, sie ist immer da, wenn wir nur bewusst Ausschau danach halten.
Völlig entnervt von einem Tag voller Probleme eilte ein Meditationsschüler zum Zendo. Er freute sich auf die Stille der Meditation, die ihn vom Druck des Tages entlasten würde, und darauf, sich hinzusetzen und seine Fähigkeiten zu Gelassenheit und Akzeptanz weiterzuentwickeln.
Als er das dem Meister mitteilte, lachte der. »Klingt ganz so, als hättest du einen Tag voller Gelegenheiten gehabt, dich in diesen Fähigkeiten zu üben und sie weiterzuentwickeln, und du hast keine davon genutzt.«